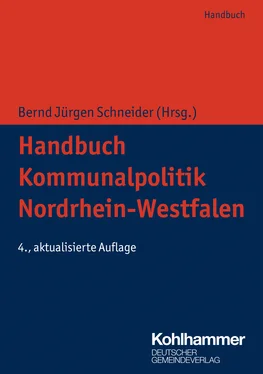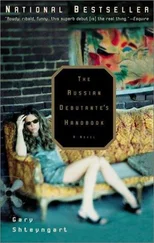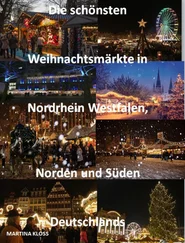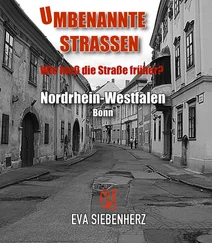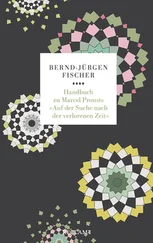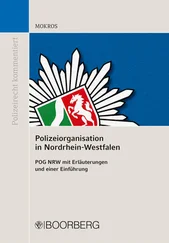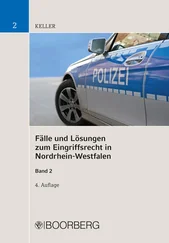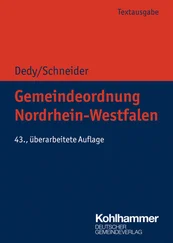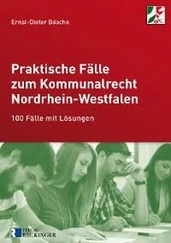– Social Media Management Tools
Wachsende Verbreitung finden in der Arbeit mit Social Media sogenannte Management Tools wie beispielsweise hootsuite, Buffer oder SocialHub. Sie dienen als zentrales redaktionelles Cockpit, mit dem sich Beiträge erstellen und auf die einzelnen Kanäle verteilen lassen. Als nützlich erweist sich für das Social Media-Management vor allem, dass man in einem Kalender den Veröffentlichungszeitpunkt der Beiträge planen und festlegen kann. Zudem erleichtern derartige Tools das Monitoring: Über eine zentrale Ansicht können das Geschehen in der Community sowie die Resonanz auf die eigenen Inhalte beobachtet und statistisch ausgewertet werden. Auch die Kommunikation mit den Nutzern erfolgt über das Cockpit. Grundsätzlich gilt: Je mehr Kanäle zu betreuen sind, desto hilfreicher ist eine solche Plattform für das Social Media-Management.
Der Anteil von Videos im Netz wächst rasant. Nutzer erwarten zunehmend Bewegtbilder, soziale Netzwerke belohnen Clips mit zusätzlicher Reichweite. Mit jedem Smartphone und minimalem Zusatzequipment lassen sich mittlerweile lebendige Videos erstellen, die auch professionellen Ansprüchen genügen. Spätestens in der Corona-Krise wurde deutlich, wie gut sich mit Filmen Botschaften vermitteln lassen. Zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister richteten sich mit Video-Ansprachen an die Bevölkerung, teilweise sogar im Livestream, so dass Nutzer in Echtzeit Fragen stellen konnten. Aber auch schon zuvor haben viele Kommunen das Potenzial von Videos erkannt und Themen über kurze Filme transportiert – angefangen von Mini-Portraits der Beschäftigten in der Stadtverwaltung bis zu Grußworten von der Eröffnung des Stadtfestes.
Einmal aufgezeichnet und geschnitten kann das Material oftmals auf mehreren Kanälen verwendet werden, etwa der eigenen Homepage, Youtube, bei Facebook oder Instagram. Entscheidend für eine gute Resonanz sind abgesehen von der Botschaft eine kurzweilige Regie, Authentizität und guter Ton. Dies gilt insbesondere für eine Veröffentlichung in sozialen Netzwerken. Bei langatmigen, aus der Totalen aufgezeichneten Dokumentationen von Veranstaltungen verlieren die Zuschauer/innen schnell das Interesse.
In einigen Städten hat sich zudem ein wöchentlicher Video-Podcast etabliert. Darin berichtet der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin in gebotener Kürze über Neuigkeiten aus der Kommune. Das schafft Bürgernähe, Aktualität und bietet beste Gelegenheit, kommunales Handeln verständlich zu machen. Freilich dreht sich ein Video-Podcast nicht von allein, sondern setzt inhaltliche und gestalterische Planung voraus. Im Zweifel bietet es sich außerdem an, an kameragerechtem Auftreten und einer klaren Ansprache zu arbeiten. Im besten Fall wird die regelmäßig ausgestrahlte Videobotschaft zur festen Institution für Bürgerinnen und Bürger sowie die Medien. Alternativ ist es auch denkbar, sich auf einen Audio-Podcast zu konzentrieren. In den jüngeren Jahren hat dieses Format erheblich an Popularität gewonnen.
Der klassische E-Mail-Newsletter erfährt schon seit mehreren Jahren eine Renaissance. Er erweist sich zuverlässig als passgenaues Instrument zur Ansprache bestimmter Zielgruppen. Dies gilt für den kommunalen Verteiler mit den aktuellen Pressemitteilungen, mehr aber noch für klar definierte Zielgruppen. In der kommunalen Praxis finden sich beispielsweise Newsletter zu Themen wie Integration, Klimaschutz, Kultur oder Nachhaltigkeit. Oftmals vernetzen sich darüber Verwaltung, Politik und Ehrenamt. Bewährt haben sich auch ereignisbezogene Newsletter.
Eine Sonderrolle spielten in der Vergangenheit Newsletter, die über Whatsapp verschickt wurden. In den Kommunen wie auch in der Wirtschaft war dieser Kanal ausgesprochen beliebt, weil der Messenger fast flächendeckend verbreitet ist und darüber verschickte Nachrichten deutlich häufiger geöffnet werden als bei E-Mails. Seitdem Whatsapp Ende 2019 jedoch den Versand von Newslettern verboten hat, sind die Perspektiven ungewiss. Einige Kommunen testen alternative Anbieter wie Threema oder Telegram, andere warten ab, wie sich kostenpflichtige Modelle wie etwa Whatsapp-Business oder die Chatbot-Technologie entwickeln.
– Entwicklungslinien/Datenschutz
Sowohl die zunehmende Nutzung von Social Media als auch der verstärkte Dialog über Portale oder eine Bürgermeistersprechstunde sind Ausdruck eines wachsenden Trends zur Bürgerbeteiligung. Bürgerinnen und Bürger formulieren mehr denn je den Anspruch, frühzeitig über Planungen informiert und in diese eingebunden zu werden. Dies bringt oftmals viel Arbeit für die Verwaltung mit sich, insbesondere bei größeren Projekten und/oder politisch brisanten Themen. Je weiter die Interessen in der Bürgerschaft auseinandergehen, je umfassender der Umbau der Stadt, desto größer die Herausforderungen an die Kommunikation. Bewährt haben sich in diesem Zusammenhang neben den formalen Beteiligungsverfahren unter anderem offene Planungsforen oder moderierte Chats. Weitere technische Modelle werden folgen: Bei den Bemühungen um mehr Beteiligung und Bürgerdialog zeigen sich die Kommunen durchaus experimentierfreudig.
Bei der externen Kommunikation spielt auch der Datenschutz eine wichtige Rolle. Seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im August 2018 hat er einen höheren Stellenwert denn je. Als öffentliche Verwaltung sind Kommunen noch mehr als andere dazu verpflichtet, den Anforderungen gerecht zu werden. Nach anfänglicher Verunsicherung haben die meisten Kommunikationsstellen – in der Regel in enger Absprache mit dem oder der Datenschutzbeauftragten – DSGVO-konforme Verfahren entwickelt. Insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Social Media bleiben jedoch bis heute zahlreiche rechtliche Fragen ungeklärt, unter anderem wegen des sogenannten Facebook-Urteils vom Juni 2018. Darin spricht der Europäische Gerichtshof (EuGH) nicht nur Facebook, sondern auch den Betreibern von Facebook-Fanpages eine Mitverantwortung für den Datenschutz zu.
Die Auswirkungen auf die Praxis sind derzeit nicht absehbar. Auf jeden Fall erscheint es ratsam, durch sorgfältig formulierte Datenschutzerklärungen und größtmögliche Transparenz auf ein Maximum an Rechtssicherheit hinzuwirken. Gleichwohl gibt es nach dem aktuellen Stand der Dinge keine Veranlassung, den Rückzug aus den sozialen Netzwerken anzutreten. Social Media dienen insbesondere in Zeiten des Zeitungssterbens als wichtige Ergänzung, um der Informationspflicht der öffentlichen Verwaltung nachkommen zu können, demokratische Teilhabe zu fördern und Regierungshandeln zu erklären. Dass soziale Medien im Umgang mit Krisenlagen inzwischen eine unverzichtbare Rolle einnehmen, zeigten überdeutlich die Erfahrungen aus der Corona-Krise.
Maßgeblicher Einfluss auf die Arbeit in den Kommunikationsstellen dürfte zudem zwei Gerichtsurteilen zukommen, die der externen Kommunikation der Städte und Gemeinden deutlich die Grenzen aufgezeigt haben: So untersagte im Dezember 2018 zunächst der Bundesgerichtshof der Stadt Crailsheim, ein kostenfreies Amtsblatt zu verteilen, das presseähnlich über das gesellschaftliche Leben in der Kommune berichtet. Ende 2019 unterlag die Stadt Dortmund in einem ähnlichen Fall vor dem Landgericht Dortmund, weil das Internetangebot www.dortmund.denach Ansicht der Richter gegen das Wettbewerbsrecht und das Prinzip der Staatsferne der Presse verstieß. Für beide Fälle galt: Staatliche Publikationen dürfen privaten Medien keine Konkurrenz machen. Kommunale Kommunikationsstellen sind von daher gut beraten, in ihren Veröffentlichungen immer einen Bezug zum Verwaltungshandeln nachweisen zu können. Entscheidend bleibt am Ende die gelebte Praxis: Lokale Medien und Kommune sind aufeinander angewiesen. Nur wenn beide eigenständig agieren und sich gegenseitig ergänzen, sind die Voraussetzungen für eine demokratische Öffentlichkeit vor Ort gewährleistet.
Читать дальше