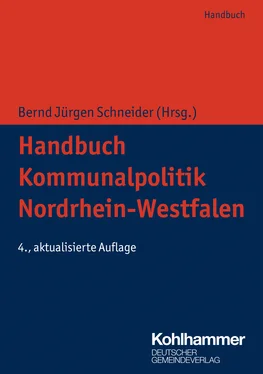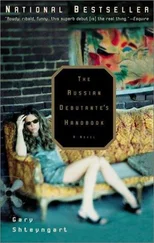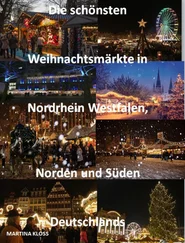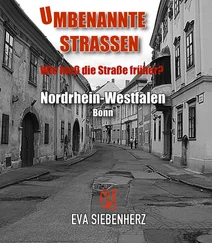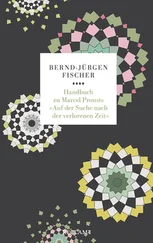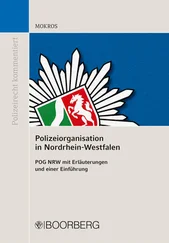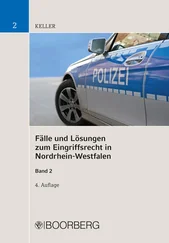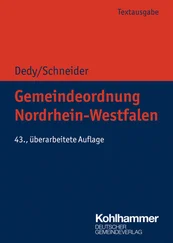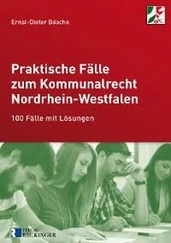Durch die Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes ist den Gemeinden ein unentziehbarer Kernbestand an Aufgaben zugesprochen. Die politische Wirklichkeit zeigt jedoch auch eine Kehrseite. Die Funktionsfähigkeit der Selbstverwaltung wird heute nicht so sehr durch zu wenige, sie wird heute eher durch zu viele Aufgaben gefährdet. Wenn den Gemeinden zu viele Pflichtaufgaben – insbesondere im Leistungs- und Sozialbereich, aber auch als Ordnungsfunktionen – zugemutet werden, dann gerät die Selbstverwaltung durch Überforderung in Gefahr. Insbesondere dann, wenn Bund und Länder nicht für die erforderliche Finanzausstattung sorgen. Es ist deshalb an der Zeit, Bund und Land bei der unkontrollierten Übertragung von Aufgaben Einhalt zu gebieten. Dazu kann das sog. Konnexitätsprinzip beitragen, das sich nunmehr in fast allen Landesverfassungen finden lässt. Auch in Nordrhein-Westfalen gilt: „Wer bestellt, bezahlt“.
Das Konnexitätsprinzip ist wichtig und notwendig als ein Instrument zur Disziplinierung der Politik. Denn nur mit seiner Hilfe können die Länder gezwungen werden, sich Klarheit über die Folgekosten eines Gesetzes zu machen und diese bei politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Das Konnexitätsprinzip verhindert so gesetzliche Wohltaten, die ansonsten von den Kommunen finanziert werden müssten. Diese erzieherische und präventive Wirkung kann deshalb gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Gleichzeitig versuchen der Bundes- und die Landesgesetzgeber auf immer mehr Tätigkeitsfelder kommunalen Handelns Einfluss zu nehmen. Dies zeigt die Gesetzgebungspraxis des Bundes und der Länder in den letzten Jahren. Regelungsdichte und -tiefe der einschlägigen Gesetze und Verordnungen erschweren es den Gemeinden zusehends, in freier Selbstbestimmung eigene Angelegenheiten den örtlichen Verhältnissen entsprechend und angemessen zu regeln. Angesichts der fortschreitenden Verrechtlichung vieler kommunaler Aufgaben, deren Wahrnehmung in die Eigenverantwortung der Kommunen gestellt war, wird deutlich, wie schmal der Grat ist zwischen der notwendigen Regelungsverantwortung der Bundesgesetzgebung einerseits und der Eigenverantwortung der Kommunen andererseits. Der Rechtsstaat verlangt Rechtssicherheit und einklagbare Ansprüche. Eigenverantwortung verlangt aber nach Gestaltungsspielraum und Ermessensausübung. Die Befürchtung der Gemeinden, dass ihnen ihre letzten Freiräume noch entzogen und die Institutionen sowie die Idee der kommunalen Selbstverwaltung dadurch letztlich untergraben werden könnte, ist nur allzu verständlich.
Bund und Länder müssen diese Sorgen ernst nehmen. Idee und Inhalt der kommunalen Selbstverwaltung werden nur dann eine Zukunft haben, wenn den Gemeinden im Rahmen einer ausreichenden Finanzausstattung substantielle Betätigungsfelder in eigener Verantwortung bleiben. Gefordert sind hier in erster Linie die Länder, die gegenüber ihren Gemeinden eine Obhutspflicht haben. Bundes- und Landesgesetzgeber sind zu einem „gemeindefreundlichen“ Verhalten aufgerufen. In lokale Aufgaben sollten sie nur dann eingreifen, wenn dies aus überörtlichen Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist. Zugegeben: Das sind Grundsätze und Formeln, die fast jeder akzeptiert und die Differenzen erst in der Konkretisierung hervorrufen. Aber die Zukunft von Kommunalpolitik hängt davon ab!
BGrundregeln der externen Kommunikation in der Kommune
I.Bedeutung der Kommunikation
Externe Kommunikation spielt für kommunale Führungskräfte eine zentrale Rolle. Wer durch Wahl in sein Amt gekommen ist, hat zuvor erfolgreich einen Wahlkampf bestritten. Er oder sie hat eine große Anzahl Wählerinnen und Wähler davon überzeugt, die beste Kandidatin oder der beste Kandidat für dieses Amt zu sein. Dies geht nicht ohne die Medien. Sie sind der Multiplikator der eigenen Botschaften.
Das positive Verhältnis, welches die Kandidatin oder der Kandidat während des Wahlkampfs zu den Medien aufgebaut hat, sollte sie oder er unbedingt in die Amtszeit hinüberretten.
„Man ist auf die Medien angewiesen nach der Wahl wie vor der Wahl“
Auch wenn sich der Status der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers mit der Wahl erheblich verbessert hat, sollte sie oder er dies die Medienvertreterinnen und -vertreter nicht spüren lassen. Ein Klima der Herzlichkeit und Offenheit, welches man im Wahlkampf – durchaus zweckrational – aufgebaut hat, sollte sich auch im Rathaus fortsetzen. Wer sich abschottet und die Offenheit gegenüber den Medien ablegt, bekommt über kurz oder lang Probleme – nicht erst in Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl.
II.Erscheinungsformen der externen Kommunikation
In diesem Rahmen sollen nicht sämtliche Methoden und Techniken der Medienarbeit erläutert werden. Dafür gibt es umfangreiche Spezialliteratur (siehe im Anschluss Ziff. XI). Zum anderen stehen – zumindest in größeren Kommunen – den Führungskräften für diese Aufgabe in der Regel weitere Beschäftigte zur Verfügung. Mit diesen sind lediglich Vereinbarungen zu treffen, welche Methoden in welchem Rhythmus anzuwenden sind und wie dazu der Arbeitsprozess zu gestalten ist. Sollte den Beschäftigten der Verwaltung das nötige Fachwissen oder das Handwerkszeug fehlen, müssen diese eine Schulung oder Fortbildung erhalten. Wenn eine Neueinstellung nötig ist, sollte Bewerberinnen und Bewerbern der Vorzug gegeben werden, die über eine journalistische Ausbildung oder zumindest über Grundkenntnisse der Medienarbeit verfügen.
Externe Kommunikation findet im kommunalen Alltag an vielen Stellen statt – auch dort, wo man sie nicht vermutet. Grob gesagt gibt es die formelle, organisierte Medienkommunikation – etwa durch Pressemitteilungen, Online-Statements, Pressekonferenzen, Stammtische, Hintergrundgespräche oder Ortstermine mit für die Medien Tätigen. Daneben vollzieht sich Kommunikation aber auch in sämtlichen Äußerungen der Kommune gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern – etwa in öffentlichen Bekanntmachungen, Abfallkalendern, Gesprächen im Bürgerbüro, in Rats- und Ausschusssitzungen, in der Internetpräsentation sowie in den sozialen Netzwerken. Wenn externe Kommunikation lediglich als Aufgabe einer Fachkraft – der oder des Kommunikationsverantwortlichen – angesehen wird und die übrige Verwaltung den Medien indifferent oder ablehnend gegenübersteht, kann selbst die exzellente Arbeit dieser Fachleute kaum erfolgreich sein.
III.Erfolgreiche externe Kommunikation in der Kommune
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister besitzt die Organisationshoheit über die Verwaltung. Diese Kompetenz qua Amt sollte man nicht unterschätzen – und gerade in puncto Kommunikation auch nutzen. Als Neuling im Amt sollte man sich zunächst einen Überblick verschaffen, wie Kommunikation in der Kommune bisher praktiziert wurde und welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Zu empfehlen ist eine komprimierte Bestandsaufnahme in Form eines eintägigen Workshops mit einem externen Beratungsunternehmen. Dabei kann der Verwaltungsvorstand – unter Anleitung – seine bisherige Praxis analysieren und Ansätze zur Optimierung erarbeiten.
In größeren Städten gibt es meist eine differenzierte, professionelle Struktur, die man ohne Bedenken übernehmen oder weiterentwickeln kann. In kleinen Kommunen kann es durchaus sein, dass für externe Kommunikation kein stringentes Konzept vorhanden ist und gelegentliche Medienanfragen „eben ’mal so zwischendurch“ – von wem auch immer – beantwortet werden. Grund ist das knappe Personal in der Verwaltung kleiner Städte und Gemeinden. Dadurch ist es nicht möglich, für die Kommunikation exklusiv eine Person abzustellen. Dennoch ist auch dann Konzeptionslosigkeit der schlechteste Zustand mit Blick auf erfolgreiche Kommunikation und Außendarstellung.
Читать дальше