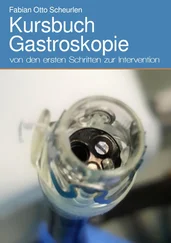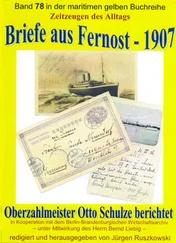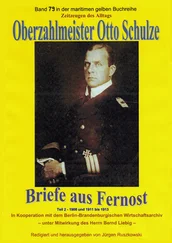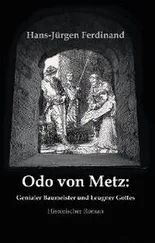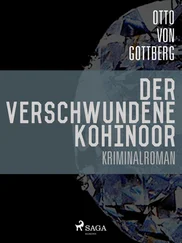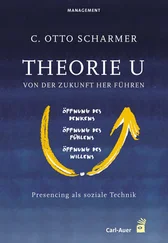Nur langsam kam er durch das Gedränge im Erdgeschoss. Das Sandsteinviereck des Hauses stand um einen Licht- und Packhof. Darum fiel Tageslicht von zwei Seiten auch ins unterste Stockwerk. Den zwischen kleinen Blumenbeeten, Pflanzenkübeln, Palmengruppen und Springbrunnen trödelnden Besucherinnen nahm kein Schatten etwas von dem Bild der bekleideten Wachsmodelle, die einzeln, zu zweien, dreien oder in Gruppen in dem weiten Garten standen. Oben zwitscherten Vögel. Unten schienen die Puppen zwischen den Beeten wandernde Kundinnen, und neben sie traten als lebende Modelle oft Probiermädchen. Längs der Hintermauer am Kurfürstendamm trat Hemmern in die Allee von zwei Reihen hochstämmiger Kübelpalmen. Unter den Bäumen trugen Stühle Schau- und Kauflustige. An den Sitzenden vorbei schritten die Palmenstrasse entlang von früh bis spät Mädchen im Gesellschafts- oder Strassenkostüm, im Tennis- oder Reisekleid, im Morgenrock, Strandanzug oder Frisiermantel, in jeder Art Gewand, das Frauen tragen konnten. Die Probiermädchen waren von grosser und guter Figur. Darum besuchte er gern die Palmenallee, deren Aufsehern er als Freund, obwohl nicht Gesellschafter ihres Brotherrn bekannt war. Doch in Erwartung edlerer Beute blickte er heute auf dem Weg zur Nordwestecke des Baues achtlos über die grossen Mädchen hinweg. In einem Schacht, der vom Keller zum Boden das Gebäude durchschnitt, hatte Gutschmidt dort am Kurfürstendamm seine eigenartige Geschäftsstube. Eigentlich war sie ein Fahrstuhl, denn das Zimmer stand auf einer Metallplatte, die der Druck auf einen Knopf an der Innenwand von einem Stockwerk zum anderen hob oder senkte. Auch das schien eine Idee, auf die nur Gutschmidt kommen konnte. Der unermüdliche grosse Arbeiter mit Stiernacken und Bulldoggenkinn geizte mit Sekunden, obwohl er das Tagewerk dreier Menschen versah. Wenn er diktierend, telephonierend, telegraphierend und stets dekretierend am Schreibtisch sass, kamen ohne Unterlass Fragen oder Bitten um Entscheidung. Weder er noch der Fragende sollte eine Sekunde der im Haus Gutschmidt hoch bewerteten Zeit verlieren. Der Chef schrieb oder sprach weiter und drückte auf einen der Knöpfe an der Wand. Die Platte trug sein Zimmer hinauf oder hinab. Die grüne Rolle der Telephonleitung wurde, mitwandernd, dicker oder dünner, bis er wieder zur Linken des Schreibtisches ein Fenster sah und ein Klicken hörte. Es meldete, dass jetzt das Öffnen der Tür zu dem gesuchten Stockwerk möglich sei. Der Buchhalter, der den Chef sprechen wollte, trat ein. Dem Auskunft heischenden Verkäufer konnte der Herr ohne Zeitverlust bis hinter den Ladentisch folgen.
Heute hing die Platte im Erdgeschoss. Ein kurzes Kopfnicken Gutschmidts dankte für Hemmerns Gruss. Georg diktierte weiter mit der Stimme, die klar, bestimmt, aber leise war und darum die besonnenen Überlegens schien. Jedem Satz folgte eine kurze Pause. Dann stiessen die Lippen schnell einen neuen, gleich knappen heraus. Er war so durchdacht und erwogen, dass er selten Änderung oder Verbesserung heischte.
Hemmern war gern der stille und bewundernde Zuschauer Gutschmidtschen Wirkens. Als Mehrer seines Einkommens schätzte er den Jugendgespielen mit fast zärtlicher Neigung und betrachtete ihn mit dem liebevollen Schmunzeln der Bäuerin, die vor der fleissig Eier legenden Henne steht. Oft spürte er gar Furcht, die Gesundheit des Unermüdlichen könne versagen und der kraftvolle Körper des Gleichaltrigen unter der stets gemehrten Arbeitslast zusammenbrechen. Doch kein Fältchen furchte Gutschmidts straffe und gesund gerötete Haut vom dunkelblonden Stirnhaar bis zu den viereckigen Backenknochen. Durch frische, breite Lippen leuchteten seine Zähne blank und weiss wie um die graue Iris sein klares Auge. Keinen weissen Faden trug des Fünfundvierzigjährigen Schnurrbart, der unter der stumpfen Nase in zwei dicken Quasten schräg über die Backenknochen fiel. Obwohl der altmodische Schnurrbart gepflegt war, gab er der Erscheinung Gutschmidts etwas Urwüchsiges und nahm der in einen dunklen Morgenanzug von neuestem Schnitt und fehlerfreiem Sitz gekleideten Gestalt zu ihrem Vorteil den Firnis moderner Eleganz. Obenein hing das Barthaar nicht glatt und ausgezwirnt wie an den Köpfen von Männern alter Rasse, sondern kräuselte sich in den dicken Quasten wie der Wuchs um das Kinn von Menschen, die auf dem Lande, in der Wildnis, im Urwald, fern von Barbier und Schermesser wohnen. Gutschmidt war Bauernsohn.
Der Drehstuhl wirbelte um seine Achse. Georg sah Hemmern scharf in die Augen und dehnte die vierschrötigen Glieder — nicht müde, sondern in Lust und Freude an Bewegung oder Betätigung. Er hob die Arme, als wolle er auch ihnen das Vergnügen sich zu rühren gönnen:
„Eilt es, Hemmern?“
„Ich möchte dich bitten, eine verständige Person in ein Auto zu setzen und meinen Kusinen zum Massnehmen zu schicken.“
„Machst du den Stadtreisenden?“
Das lachte er schon in das Schallrohr des Telephons, fragte nach Namen wie Adresse der Damen und rief Befehlsworts in den Apparat.
Dann griffen die derben, aber weissen Hände wieder an die Lehne. Der Stuhl wirbelte herum. Gutschmidt kehrte dem Freund den Rücken. Er wusste, wie gern Hemmern das Sprudeln der Quelle seines mühelosen Erwerbens hörte. Wieder bei der Arbeit griff er zu Briefen und diktierte. Der Sekretär stenographierte und Ernst schmunzelte, weil Worte oder Ziffern von neuem Gewinn erzählten.
Eine brave Beamtennatur war Freund Gutschmidt gewesen und sein Erfolg wahrhaftig nicht vorauszusagen. Der Vater, ein Bauer im Pyritzer Weizacker, wollte den Sohn zum „Doktor“ erziehen und schickte ihn nach Berlin aufs Gymnasium. In der Sexta sass Georg neben ihm, den die Hosenmätze unverträglich und Schnorchel Hemmern nannten. Vielleicht war er wirklich streitsüchtig, denn Georg Gutschmidt musste dem Bankgenossen eines Tages die Kraft der schon damals grossen Fäuste zu spüren geben.
Merkwürdig, wie die Tracht Prügel die Freundschaft zweier Sextaner für Lebenszeit geregelt hatte. Er war erst widerwillig, aber, weil es der Mühe wert schien, endlich gern der gefügige Knappe des Stärkeren geworden. Georgs Faust hatte ihn vor dem Zorn der Kameraden und Georgs Fleiss vor dem Tadel der Lehrer geschützt. Gutschmidt arbeitete schon als Knabe für zwei. Er lebte in der Familie eines Oberlehrers, aber durchstreifte oft mit dem Gefährten die Strassen von Berlin. Stundenlang starrte der Bauernsohn in Schaufenster, hinter denen Damentoiletten standen, und der Knabe schon sparte Taschengeld, um „auch einmal so etwas anzufangen“. Der Tertianer schrieb dem Vater, das Doktorn sei eine brotlose Kunst. Der junge Mann mit dem Einjährigenzeugnis bat den Schulkameraden um einen Lehrlingsposten in der Hemmernschen Tuchhandlung. Ernst Hemmern Senior fand Gefallen an dem helläugigen, rührigen Bauernjungen und liess ihn die grosse stumpfe Nase in alle Winkel des Hauses stecken. Georg schaute nicht nur, sondern lernte auch, aber trat nach sechs Monaten in den Dienst eines Frauenschneiders. Als Einjähriger glaubte er das Handwerk genugsam zu kennen und stand in freien Stunden vor den Fenstern von Hut- und Wäscheläden. Durch die Scheibe eines solchen machte er die Bekanntschaft einer hübschen Putzmacherin, die sich auf ihre Arbeit verstand. Als er den bunten Rock auszog, war Hemmern Senior tot und der Schulgefährte grossjährig. Er verkaufte das Geschäft, und Georg Gutschmidt fragte:
„Warum?“
„Mein Kapital soll höhere Zinsen bringen!“
„Gib es mir! Ich zahle mehr als andere!“
Er wollte lachen, aber Georgs Miene und Sprache waren wieder die des Meisters, der einem gefügigen Knappen zu seinem Vorteil gebot. Zudem hatte der Vater dem Freund eine geschäftliche Zukunft prophezeit. Also gab er Georg zunächst ein Weniges und nach dem schnellen Erfolg die Gesamtsumme des Kapitals. Gutschmidt heiratete die Putzmacherin und öffnete an der Ecke der Leipziger Strasse einen Laden, über dem schon damals zu lesen stand: Georg Gutschmidt — Frauenschneider.
Читать дальше