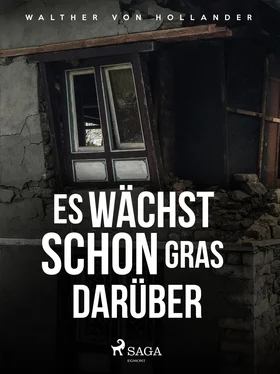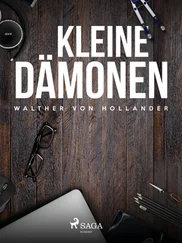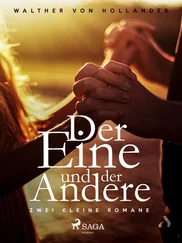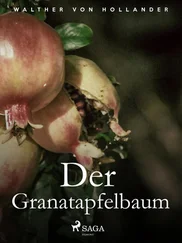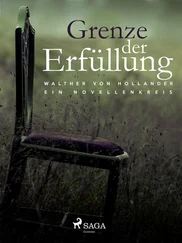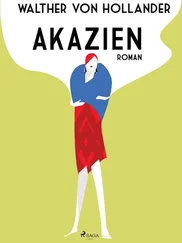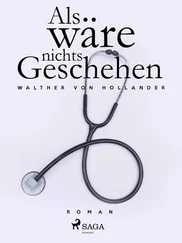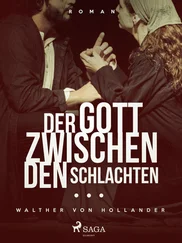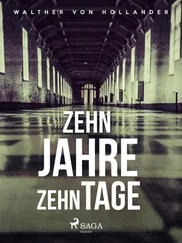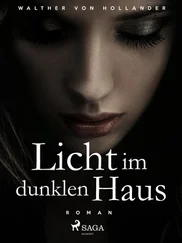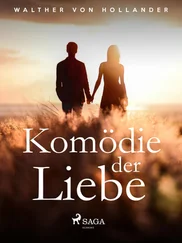Jetzt lag ein trüber Himmel über dem Jagdhaus. Von den Bäumen tropfte es ruhig und gleichmäßig wie schon seit vierzehn Tagen, und zwischen den Trümmern hatten sich Pfützen gebildet.
Paul Wolffenau kam vom Dorf, wo er seine kleinen Einkäufe gemacht hatte. Das Beste war eine zwei Meter lange Angelrute und zwanzig Meter erstklassige Angelschnur, die er in der Hand trug. Er hatte sie beim Kaufmann Klösters eingetauscht gegen ein hübsches, sehr buntes Aquarell, darstellend den Klöstersschen Kolonialwarenladen, der rechts und links von Sonnenblumen eingerahmt war. Eine etwas mühsame Arbeit, da Herr Klösters alles sehr genau auf dem Bilde zu haben wünschte, einschließlich der Firmeninschrift: Theodor Lüttjohanns Nachfolger, Inhaber Hermann Klösters. Die Reißfeder war kaum fein genug, um das alles aufzuzeichnen.
Übrigens hatte er noch zwei Pfund Grieß darauf bekommen, zwei Päckchen Tabak und eine große Tüte Tee, der in einem Winkel des Ladens den Krieg überdauert hatte und nicht besonders frisch roch. Aber es war Tee. Paul trug diese Sachen alle in seinem Koffer. Wie oft hatte er schon geflucht, daß er in einem Anfall von unangebrachtem Mitleid seinen Rucksack verschenkt hatte. Wahrscheinlich trug jetzt der stämmige Gatte der Dame den Rucksack, und er schleppte sich mit dem Koffer, den er allerdings jetzt, mit einer Wäscheleine verschnürt, auf den Rükken gebunden hatte.
„Guten Abend“, sagte Paul, als er das Zimmer betrat. „Da wären wir also. Und es hat sich gelohnt. Bitte schön ... eine Flasche Milch wie immer, Grieß, ein widerliches Gericht, aber ausreichend für drei Tage. Ein halbes Pfund Margarine, ein Klecks Butter — weniger als sonst, aber immerhin. Ein Sechspfundbrot, ein halbes Pfund Zucker, und zwar bester weißer, wie Herr Klösters betont hat, Kartoffeln ... und das meiste — ja, hier ist noch Tee — gegen ganz gewöhnliche, ins Käufliche herabgedrückte Kunst eingetauscht.“
Er kam, während er die Sachen wegpackte, an dem kleinen, grünlichen Spiegel vorbei, blieb stehn und brach das unsinnige Selbstgespräch ab. Er sah sich prüfend an. Eigentlich wäre es gut, mal wieder ein Selbstporträt zu machen. Jetzt hatte er doch Zeit, zu malen. Kein Bauherr kommandierte, keine Behörde verlangte die Entwürfe termingemäß. Immer wieder hatte er seufzend zu Gertie gesagt: „Laßt mich doch mal aus der Geldmühle heraus, ich will malen. Stein und Eisen und Glas ... das ist nicht biegsam, das leuchtet nicht.“ Also jetzt ein Selbstporträt. Ölfarben hatte er noch aus Dahlem mitgebracht. Eine Holzplatte ließ sich präparieren. Es gab also keine Entschuldigung. Bitte, hier ... statt in der Art eines einsamen Greises Selbstgespräche banalster Art zu führen, wäre es gut, das tiefste Selbstgespräch zu führen, das es gibt: das Selbstporträt. Ein schonungsloses, ein selbstenthüllendes, sich selbst enthüllendes Porträt. Das malen, was hinter dem selbstsicheren, frischen, braunen Gesicht steckte. Den Kummer etwa, der sich in den kantigen Schläfen barg. Die Grübeleien des Nachts, die sich in den winzigen Stirntälern versteckten. Die völlige Leere, die in den stahlblauen Augen langsam Platz nahm. Bitte! Wenn man mal wirklich einsam war — und wer hatte je dieses Glück in seinem Leben? — dann konnte man auch ehrlich sein.
Er kniete am Ofen und zündete ein Feuer an. Die kleinen Tannenäste, Abfälle von den Ästen, die die Granaten heruntergeschlagen hatten, prasselten hell auf. Die Ofenplatte begann zu glühn, und das Wasser in dem kleinen Emaillekochtopf hob zu singen an. Keinen Grießbrei, bitte, sondern lieber einen starken, dunkelbraunen Tee. Dazu eine Pfeife von dem graubraunen Tabak des Herrn Klösters, Marke Flaggenstolz. Er betrachtete das Paket aufmerksam. Das Reklamebild stammte aus einer Zeit, die verschüttet und vergangen war wie die Zeit, bevor Herculanum und Pompeji untergingen. Es zeigte zwei Matrosen mit nacktem Hals, kleinem Spitzbart und roten Backen, die gerade eine Flagge am Mast emporzogen. Diese Flagge war mit weißem Papier überklebt. Aber als Wolffenau das Papier wie ein Abziehbild anfeuchtete und abzog, kam wahrhaftig die alte Seekriegsflagge mit dem schwarz-weiß-roten Gösch zum Vorschein. Er mußte sehr weit zurückdenken, um sich an die alte deutsche Fahne zu erinnern.
Zuletzt flatterte sie in einem trüben Novemberwind am Hause seines Großvaters Alexander Wolffenau, des Gründers der Firma, der sie als kaisertreuer Mann aus Trotz aufgezogen hatte, als das Kaiserreich zusammenbrach. Paul hörte jetzt wieder die empörten Rufe der demonstrierenden Arbeiter. Er hörte die schweren Stiefel einer eindringenden Rotte über die Treppe stampfen, er hörte das Triumphgeschrei der Massen vor dem Haus, und als er gleich darauf von seiner zitternden Mutter durch den Hinterausgang des Hauses hinausgeführt wurde, sah er, wie von dem breiten Balkon eine blutrote Fahne herabhing. Die Menge hatte sich seltsamerweise still entfernt. Den Grund erfuhr er am Abend. Der alte Alexander Wolffenau hatte sich voller Ingrimm den Arbeitern entgegengeworfen. Sie hatten ihn gepackt und beiseitegeschoben, und plötzlich war er unter den Händen der Festhaltenden zusammengebrochen. Ein Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gesetzt, und so lag er, während seine Schwiegertochter und sein Enkel durch die Straßen flüchteten, einsam auf seinem Ledersofa, den toten Blick auf die rote Fahne gerichtet, die langsam und feierlich im Novemberwind wehte. „Es war sehr heldenhaft, aber ein wenig lächerlich“, hörte Paul seinen Vater ein paar Wochen später zu Herrn Trümper von der Metall-Bau-AG sagen, „sich einer Fahne wegen in den Tod zu stürzen. Mögen sie aufziehn, welche Fahne sie wollen. Das ändert an den realen Tatsachen nichts. Und diese realen Tatsachen gilt es zu biegen, lieber Trümper, bis sie ein vernünftiges Gerüst für uns hergeben.“
Nach diesem Grundsatz hatte Paul I. gelebt und hatte die rote Fahne überstanden, dann die schwarz-rot-goldene, und er hatte auch gut, ja vorzüglich unter der Fahne mit dem Hakenkreuz gelebt. Es kam nicht auf die Flagge an, sondern ... Paul schüttete Tee in das sprudelnde Wasser. Ein Sieb besaß er nicht. So schwammen die Teefische in der henkellosen Tasse, auf die in Goldbuchstaben „Dem lieben Fritz“ gemalt war. Übrigens stank der Tabak, Marke Flaggenstolz, ganz abscheulich.
Es kommt nicht auf die Flagge an, dachte Paul wieder. Aber wenn es, wie jetzt, überhaupt keine Fahne gab, die man militärisch begrüßen, vor der man den Zylinder lüften, die man mit ausgestrecktem Arm beschwören konnte? Sicherlich, sobald es eine neue Fahne gab, würde Paul der Erste sie wieder an den gewünschten Tagen auf seinem Balkon hissen. Denn es kam ja nicht auf die Fahne an, sondern auf die realen Tatsachen, die man mit Kraft, mit Geduld, mit List zurechtbiegen konnte, weil man eben kräftiger, geduldiger und listiger war als die anderen.
Der Tee schmeckte wundervoll. Es war jetzt behaglich warm. Ein ziemlich kräftiger Wind blies von der Elbe her. Die lockeren Balken klapperten vor der Tür. Der Regen klatschte in Stößen gegen die Bäume und tropfte auf das Jagdhaus. Wolffenau warf noch ein paar Hände voll Kienäpfel auf das Feuer und stellte Kartoffeln auf. Es war vernünftiger, irgend was zu essen. Zum Holzsuchen war es außerdem zu naß. Er beschloß also, dazubleiben, es sich behaglich zu machen. Behaglich? Das klang ganz schön, und er hätte es ja auch wirklich behaglich haben können, wenn er nicht zufällig ein gutes Gedächtnis gehabt hätte, eine starke Vorstellungskraft. Wenn nicht in dieser Einsamkeit die Erinnerungen, die er längst abgestorben gewähnt hatte, zu wuchern begonnen hätten, unkrauthafte, die seit Jahrzehnten ihre Keimkraft behalten hatten und nun, da sie nicht von der Flugsandschicht der täglichen Erlebnisse überschüttet und niedergehalten wurden, mit krausen Blättern und seltsamen Blüten ans Licht kamen, einander bedrängend und wegdrängend und je nach ihrer Kraft wechselnd ins Bewußtsein emporwachsend.
Читать дальше