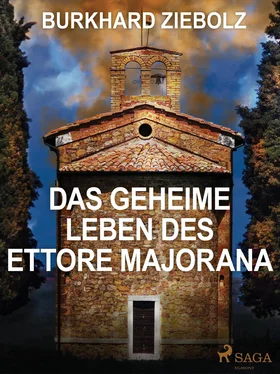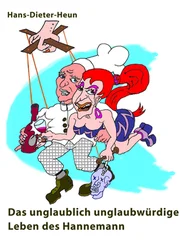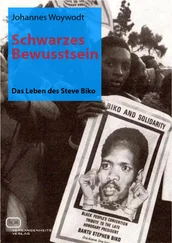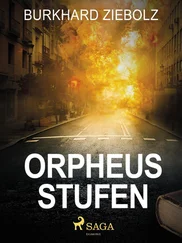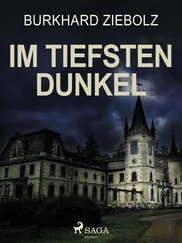Auch wenn dieser jemand ein Mörder ist.
Victor Himmelreich ist Student der Physik im achten Semester in München im Jahr 1933, als man an ihn herantritt. Ob er Lust hätte, nach Leipzig zu gehen, zu Heisenberg. Man könnte das arrangieren. Um das Geld würde man sich auch kümmern, um finanzielle Unterstützung und um ein Zimmer. Das wäre alles kein Problem.
Himmelreich ist, als träume er.
Werner Heisenbergs Ruf ist schon von internationaler Bedeutung und durchbraust die wissenschaftliche Gemeinde überall auf der Welt wie ein Sturm, der alles durcheinander wirbelt und nichts an seinem Platze läßt. Nach der Gastprofessur in Chicago hat er den Lehrstuhl für Physik in Leipzig übernommen. In seiner Nähe zu arbeiten, durch seine Schule zu gehen, ist eine Empfehlung, höhere Weihen mit dem Beigeschmack der Zugehörigkeit zur Elite. Und wenn Himmelreich zurückdenkt, muß er feststellen, daß ihn die Zeit dort wirklich und in jeder Hinsicht weitergebracht hat. Es ist nicht allein der Stoff, der vermittelt, und die Projekte, an denen gearbeitet wird, es ist ganz einfach das intellektuelle Klima und besonders Heisenbergs Genius, der allem seinen Stempel aufdrückt. Man spürt, man ist unter denkenden Leuten, man diskutiert, und es entstehen Gedanken in einem, die an einem anderen Platz niemals entstanden wären.
All das weiß der kleine, schlanke Student mit der energischen Nase, den tiefliegenden Augen und dem sauber gestutzten Oberlippenbärtchen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Seine Vorstellungen sind auch nur vage, wenn er an seine berufliche Zukunft denkt, und dennoch hätte er alles getan, um an diesen Ort zu gelangen. Also fragt er nach der Gegenleistung, die er zu erbringen hat, denn eine Gegenleistung muß es geben. Sie sagen es ihm, freundlich, sachlich, und er findet absolut nichts dabei. Es ist nichts Kriminelles dabei, noch nicht einmal etwas Anstößiges in der damaligen Zeit.
Ein paar Informationen soll er beschaffen, über eine ihm damals noch völlig unbekannte Person, die mit ihm in Leipzig arbeiten würde.
Nein, nicht ganz unbekannt.
Er kennt den Mann, um den es geht, aus der Fachpresse und aus dem, was über ihn geredet wird.
Und was er über ihn gehört hat, macht ihn gespannt.
Im Frühjahr 1933 treffen sich zwei Männer in einem repräsentativen Büro des Berliner Reichstages. Der Raum ist riesig, fast schon ein Saal, und komplett mit Holz vertäfelt, dunkel mit feinen Intarsien, die Wappen, Fahnen und allegorische Tiere darstellen. Um einen großen, runden Tisch in der Mitte stehen ledergepolsterte Stühle aus massivem Ebenholz, und die Wände schmücken zwei riesige Schlachtengemälde aus dem vorigen Jahrhundert; ein Gemenge von blauen und roten Uniformen, gezückten Säbeln, stolzen Pferden und ästhetisch leidenden Verwundeten, bunter, glorifizierender Abgesang der Kriegskunst einer anderen Epoche, bar jeglicher Realität und von jemandem gemalt, der nie ein wirkliches Schlachtfeld gesehen hat.
Am anderen Ende des Büros, direkt vor den hohen Fenstern, sitzt hinter einem Schreibtisch von riesigen Ausmaßen ein Mann und blickt Friedrich von Callwitz kühl entgegen.
»Mein lieber von Callwitz. Es freut mich, daß wir uns endlich kennenlernen.«
»Ist mir eine Ehre, Herr Reichskriegsminister.«
Callwitz´ Hacken knallen mit einer Lautstärke zusammen, die sicher bis auf den Flur zu hören ist. Er schrickt selbst ein wenig zusammen. Alte Angewohnheiten wie diese wird man schwer wieder los, und in seinem Geschäft kann man sie sich eigentlich nicht leisten. Einmal, vor vier Jahren in Bulgarien, hat sie ihn fast das Leben gekostet. Er konnte sich damals nur retten, indem er seinen Gesprächspartner erschoß; eine sehr bedauerliche Konsequenz angesichts der Tatsache, daß er ihn eigentlich als Informationsquelle hatte nutzen wollen.
Ohne aufzustehen, weist der Minister mit einer kleinen, präzisen Bewegung der rechten Hand auf den Besucherstuhl vor seinem Tisch.
»Ich habe wenig Zeit, darum will ich gleich zur Sache kommen. Sie sind mir empfohlen worden, beziehungsweise, ihre Referenzen haben Sie empfohlen. Einer der fähigsten Agenten der alten Regierung, loyal, Auslandseinsätze, mehrere Sprachen fließend, und so weiter und so weiter, sehr beeindruckend, das.«
Callwitz schweigt. Es gibt Situationen, da profiliert man sich am besten durch Schweigen. Die Wirren der letzten Monate haben sich auch auf sein Geschäft ausgewirkt, und er ist froh, nach zwei Jahren Verwaltungstätigkeit wieder für etwas anderes im Gespräch zu sein. Als Sprößling eines alten Adelsgeschlechtes mit vierhundertjähriger Tradition in der Armee verbindet ihn wenig mit den neuen Machthabern, aber letztendlich ist ihm egal, wer die Befehle gibt, wenn sie nur interessante Aufgaben für ihn bringen.
»Danke, Herr Reichskriegsminister.«
Von Blomberg lehnt sich zurück und mustert eindringlich den jungen Mann, der kerzengerade aufgerichtet auf seinem Stuhl sitzt und wartet, gleichzeitig entspannt und aufmerksam. Groß, blond, blauäugig, der arische Urtypus, als Agent leicht zu erkennen und daher für die Aufgabe wenig geeignet; dennoch, seine Erfolge sprechen für sich. Blomberg fragt sich, was intelligente, gebildete Menschen in einen solchen Beruf treibt, in Unsicherheit, Gefahr und ständige Anspannung.
Wahrscheinlich muß man dazu geboren sein.
Er seufzt, setzt seine runde Nickelbrille ab und beginnt, sie akribisch mit einem Taschentuch zu putzen, das er frisch gebügelt einer Schublade des Sekretärs entnimmt.
»Wir haben eine Aufgabe für Sie, Callwitz. Wie gut waren Sie in Physik, damals auf dem Gymnasium?«
»Oberes Drittel der Klasse, Herr Reichskriegsminister. Nicht unbedingt mein Lieblingsfach, aber ganz ordentlicher Abschluß.«
»Natürlich. Nun, eigentlich ist es auch egal, aber der Mann, um den es geht, ist Physiker, und er arbeitet an Dingen, die möglicherweise von großer Bedeutung für das Reich sein könnten. Der Führer hat ein großes Interesse daran, daß wir uns seiner Dienste versichern.«
Callwitz wartet. Die Sache mußte einen Haken haben, sonst wären sie nicht zu ihm gekommen, sondern hätten nur die Staatskasse bemüht.
Blomberg läßt sich Zeit. Er beugt sich vor, greift nach einer großen, polierten Zedernholzkiste und zieht sie über die lederbezogene Schreibtischoberfläche zu sich heran. Er öffnet sie und hält sie Callwitz hin.
»Zigarre?«
Callwitz greift zu, auch der Minister bedient sich. Die Zigarre könnte ein Hinweis auf die Länge sein, die das Gespräch noch haben wird, und damit auf seine Bedeutung. Wenn der Reichskriegsminister sich eine Stunde Zeit für ein Gespräch mit einem Fremden nimmt, kann es keine Lappalie sein, über die geredet wird.
Sie setzen die Havannas umständlich in Brand.
»Es gibt zwei Dinge, die uns im Weg stehen. Zum einen ist der Mann Italiener, gehört also einer uns nahestehenden Nation an. Wir haben deshalb nicht ganz so viel Bewegungsraum wie in anderen Fällen.«
Callwitz weiß immer noch nicht, worauf der andere hinaus will.
»Eine Frage, Herr Reichskriegsminister, wenn Sie gestatten.«
Er wartet Blombergs Nicken ab, bevor er fortfährt.
»Warum nutzen wir nicht die offiziellen Kanäle und bitten die italienische Regierung um Unterstützung?«
Blomberg wehrt ab.
»Es gibt bestimmte politische Gründe gegen ein solches Vorgehen. Und dann – wir glauben, daß die Italiener gar nicht wissen, was Sie an diesem Mann haben, und wir möchten nicht diejenigen sein, die sie darauf hinweisen. Uns würde das Wissen dieser Person jedenfalls mehr nützen als den Italienern, so nahe uns diese auch im Herzen stehen mögen. Wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Keine weiteren Fragen dazu. Callwitz weiß, wann er noch mit Antworten zu rechnen hat und wann nicht mehr. Sein Geschäft kann schmutzig sein, aber die Politik ist es in noch viel stärkerem Maße.
Читать дальше