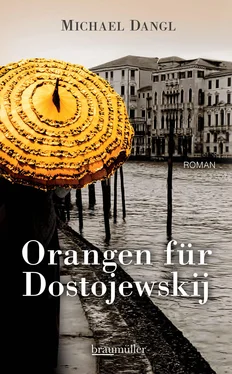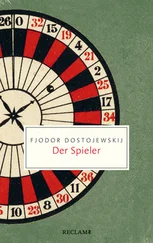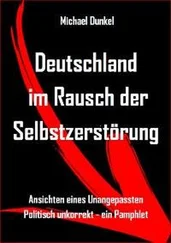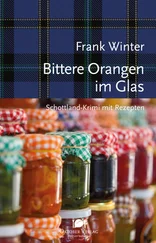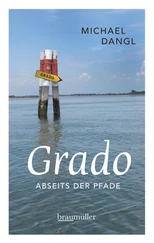„In Mestre.“
„Würde mich nicht wundern, wenn Sie schon einen Spitzel auf den Fersen hätten.“ Er sah sich im Lokal um, aber da war nur der Wirt, der gerade ein Weinfass hereinrollte. „Die Ordnung“ – das Wort kam auf Deutsch – übersieht keinen. Venedig ist ein Überwachungsstaat geworden. Viele kleine Teufel liefern ihre täglichen Berichte an den Beelzebub in Wien. Und wieder wandern ein paar ‚subversive Objekte‘ in die Bleikammern. Es heißt, dass sich der Polizeidirektor schon einmal gezwungen sah, sich selbst zu denunzieren.“ Er trank, und der Finger, den er zum zuletzt Gesagten an die Stirn gelegt hielt, wurde so zu einem grotesken Trinkgruß.
„Achtzehnachtundvierzig. Der Aufstand. Österreichische Soldaten wurden auf dem Markusplatz mit Steinen beworfen. Im Arsenale revoltierten die Arbeiter, verschafften sich Waffen und Munition. Tapfere Männer. Giaccopo!“, rief er zum Wirt, der aufschaute, und prostete ihm zu: „Viva San Marco!“ Der antwortete leise, fast mechanisch: „Viva San Marco!“ und arbeitete weiter. „Die tedeschi kapitulierten, und auf der Piazza wehte die tricolore . Aber dann kamen die Belagerung, der Luftangriff, das Aushungern. Dreizehn Jahre ist es nun her, es war ein Augusttag, heiß wie dieser, dass zwei Vertreter der neuen ‚Repubblica di San Marco‘ in einer Gondel nach Mestre fuhren und die nun ihrerseitige Kapitulation unterschrieben. Doch die Belagerung hielt an bis vor sieben Jahren. Wissen Sie, was es für einen Gefangenen bedeutet, wenn er kurz die Freiheit gesehen, die Freiheit gekostet hat – und dann wieder eingesperrt wird?“
Dostojewskij reagierte nicht. Er wusste es. Der Andere redete weiter. „Es ist schlimmer als vorher. Du weißt: Jetzt haben sie dich wirklich.“
Plötzlich stand er auf, wodurch zum ersten Mal seine altertümliche, geradezu höfische und erbarmungswürdig abgerissene Kleidung sichtbar war, setzte sich aber sofort wieder und sprach leise auf sein Glas hinunter, das er in den feinen, langfingrigen Händen hielt wie eine Kerze im Gebet: „Meine Familie reicht weit zurück und über den ganzen Kontinent, von den Pyrenäen bis an den Ural. Unsere palazzi waren die festlichsten am Canale . Heute siehst du meinesgleichen als Gondolieri arbeiten. Gräfinnen verdingen sich als Putzfrauen. Um uns irgendwie bei Laune zu halten, schenkt uns der Kaiser in Wien täglich zwei ‚Svanzica ‘, diese neue Habsburger Währung in Venedig. Gnadenbrot für die Nobili! Eine Schande!“
Dostojewskij verstand nun Beppos Reaktion auf die Münze. Sie war nicht zu wenig, sondern zu viel gewesen. Und vor allem: ein falsches Symbol.
„Wir hassen die Österreicher aus vollem Herzen.“ Nun schaute der Redende gerade vor sich hin, weniger eine Mitteilung als ein Bekenntnis formulierend. „Sie sprechen kein Italienisch. Wir kaum Deutsch. Es gibt keinen Austausch zwischen uns und den Kroaten, Ungarn, Böhmen, aus denen ihre Garnisonen bestehen. Keine Berührung. Sie leben in derselben Stadt, aber als unsere Herrscher. Jeden Tag, jeden Moment begegnen wir ihnen auf den Plätzen und streifen an sie in den engen Gassen, aber wir sind getrennt von ihnen wie der Sträfling von seinem Kerkermeister. Wir hassen sie. Kein Venezianer, der nicht den Tag ersehnt, an dem Venedig wieder frei wird. Eine italienische Stadt.“
Nun drehte er sich um, seiner Flasche zu, dem milchigen undurchsichtigen Fenster, seinem Alleinsein. Dostojewskij nahm an, dass er ihn wahrscheinlich jetzt schon vergessen hatte. Doch da schickte er ihm noch einen Satz über die Schulter: „Schafe und Wölfe sollen nicht aus einem Fluss trinken“, sagen wir in Italien. Und kichernd wie zu Beginn schenkte er den Rest aus der Flasche in sein Glas, roch daran, als wäre es sein erstes und nippte wie ein Mann, der Maß zu halten gewöhnt ist.
Als Dostojewskij in die Hitze des Abends trat, befielen ihn Übelkeit und Magenschmerzen. Im nächstbesten Restaurant, in das ihn ein draußen paradierender Kellner nötigte, aß er ein Stück Fleisch mit goldbrauner Ummantelung, das aussah wie eine unter Wagenräder gekommene Kiewer Hühnerbrust ohne Füllung, einen ungenießbaren Pudding und ein Stück schimmeligen Käses und trank ein Glas zu warmen Weißwein. Zudem unterhielten sich die Gäste an den Nebentischen derart laut, dass er sich fortwährend ärgerte und die ganze Zeit nur darauf wartete, wieder wegzukommen. Die Rechnung war unverschämt hoch. Schimpfend verließ er das Lokal.
Am Platz, der noch immer voll Menschen war, sah er sich automatisch nach einem Wagen um, der ihn hätte nach Hause bringen können. Natürlich gab es keinen. Also ging er los in die Richtung, aus der er gekommen war. Dostojewskij ging nicht gerne zu Fuß. Was ist hier nur los?, dachte er. Es ist zehn Uhr, und das Leben tobt in den Straßen so ausgelassen wie in Petersburg in den weißesten Nächten nicht. Als keine Ausnahme nämlich, sondern als etwas Grundsätzliches, das keinen Widerspruch und keine Infragestellung duldet. Auf einmal fand er sich auf der anderen Seite des Kanals, an dem sein Abend begonnen hatte, gegenüber dem Lokal Schiavi , das jetzt mit Holzklappläden verschlossen recht abweisend aussah. In einiger Entfernung erkannte er das Haus der Gondelwerkstatt, hinter sich im Dunkeln die Fassade einer Kirche. Erst jetzt fiel ihm der Campo San Pantalon ein, nun war er zu weit. Auch die Kirche hier war versperrt. Auf dem grasbewachsenen Vorplatz setzte er sich auf eine Bank. Büsche von Oleander verströmten ihren süßen Duft und mischten sich mit dem Geruch der Algen aus dem Kanal. Ihn irritierte, dass es so spät noch so warm und dabei schon so dunkel war. Nächtliche Wärme war für ihn automatisch mit Helligkeit verbunden. War es wirklich Sehnsucht nach Sankt Petersburg gewesen, was er heute Mittag im Schwall der Salzluft empfunden hatte? Er war Russe, da war der Verdacht auf Heimweh schnell bei der Hand. Aber nach Sankt Petersburg? Für ihn war es – wie oft hatte er es sich gesagt, seit er dort lebte – die finsterste, mürrischste, grämlichste Stadt der Welt. Ihr Klima gebar Halbverrückte. Selten wo fand man so viel schwermütigen Einfluss auf die menschliche Seele wie dort. Auf Sumpf gebaut war sie, und der Sumpf quoll im Winter durch die Straßenpflaster und holte sich, als harmlose tauende Eispfütze getarnt, seine Opfer und zog sie unrettbar in die Tiefe. Die Architektur der größten russischen Stadt drückte für Dostojewskij ihre ganze Charakterlosigkeit und Unpersönlichkeit aus. Kein Drittel der halben Million Einwohner war von dort gebürtig. Und es starben jedes Jahr mehr, als geboren wurden. Von Oktober bis April herrschte Winter, der nicht bloß kalt war wie in Sibirien, sondern feucht und beißend. Der ewige Wind trieb heimtückische, aggressive Luft in jede Fenster- und Mantelritze, vom zu leicht bekleideten Betreten eines frisch gelüfteten Zimmers konntest du dir den Tod holen. Dieses klamme Verließ des Winters zeugte skeptische, verschlossene, griesgrämige Naturen; an einem halben Tag in Venedig hatte er mehr offenes Lachen in den Gassen gehört als zu Hause in einem halben Jahr. Und dorthin sollte er sich sehnen? Wegen seiner Frau etwa?
Er seufzte, öffnete sein Päckchen und zog die kleine Schokoladentafel heraus. Sie war vollkommen aufgeweicht. Trotzdem gelüstete ihn danach, und er schälte das Papier von der cremigen Masse. Seine Frau konnte, des Klimas wegen, den Großteil der Zeit nicht in Petersburg leben. Sie war krank, die Tuberkulose war kurz nach ihrer Hochzeit ausgebrochen, bald nach ihrer grauenvollen Hochzeitsnacht, in der er sie mit einem gewaltigen epileptischen Anfall zu Tode erschreckt und für immer von ihm entzweit hatte. Seit fünf Jahren lebten sie nun als sich zusehends entfremdendes Paar mit Pascha, ihrem Sohn aus erster Ehe mit einem Mann, der sich in Sibirien zu Tode getrunken hatte. War ihre Ehe nun ein Irrtum? Marija Dmitrijewna, ein wenig jünger als er, extravagant und launenhaft, war zweifellos dieser Ansicht. Mit Mühe hatte er sich gegen einen Rivalen durchgesetzt, den sie in der ersten Zeit nach der Heirat als Geliebten behalten hatte. Der Ehe hatte sie erst zugestimmt, als sicher war, dass Dostojewskij aus der sibirischen Verbannung nach Petersburg zurückkehren und sie durch ihn in die Hauptstadt ziehen dürfe. Dort war sie dann enttäuscht gewesen, dass sie wie neben einem Geist spazieren ging, den keiner kannte. Nach zehn Jahren Abwesenheit musste er sich selbst erst wieder einleben und in Erinnerung bringen. Wie hatte er diese Frau geliebt und begehrt. Doch bald war ihm klar geworden, dass für ihn als Dichter das Familienleben eine Last war. Und heute, während er unter südlichem Himmel auf einer Bank saß und die schmelzende Schokolade aus ihrer Papierhülle leckte, musste er sich zum ersten Mal eingestehen, dass er die falsche Frau geheiratet hatte. Und wie um sich zu trösten, lenkte er, als er mit spitzer Zunge gierig die letzten Ritzen der Verpackung auf Schokoladenreste untersuchte, die Gedanken auf die erst zweiundzwanzigjährige Dichterin Apollinaria Suslowa, Kämpferin in Frauenfragen und für viele der Inbegriff einer femme fatale , die seit zwei Jahren, seit sie ihm bei einer Lesung zugehört hatte, seine Geliebte war.
Читать дальше