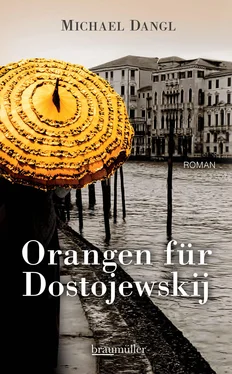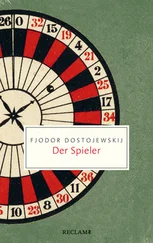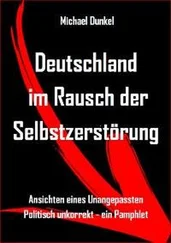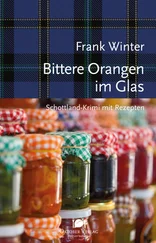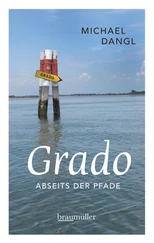1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Dann bürstete er das leichte Sakko aus, schlüpfte hinein und stellte sich vor den Spiegel. Ein Fremder blickte ihn an, wie ihm das in Hotelzimmern öfter geschah. Und zeigte ihm plötzlich die Zunge. Sie war belegt, ein böses Zeichen. Konnte der Mensch, die Krone der Schöpfung, so von seiner eigenen Leber abhängen? Vielleicht, dachte er, kommt die belegte Zunge auch vom schwarzen Tee. Einem Übermut folgend, entnahm er dem Koffer seine uralten hellvioletten Handschuhe, hielt sie vornehm in der linken Hand und sah sich das Ergebnis im Spiegel an. Es gefiel ihm nicht. Er legte die Handschuhe in eine Schublade, lehnte die Fensterflügel an und verließ, leise vor sich hinsingend, das Zimmer.
Die Post war wirklich nicht weit, und Beppo wirklich weniger in Hast. Fast konnte Dostojewskij den Gang genießen, über die noch menschenleeren Brücken, durch die engen Gassen, in denen noch etwas von Morgenfrische war, auch wenn auf den Plätzen jetzt, am Vormittag, schon die Hitze buk wie gestern bei seiner mittäglichen Ankunft. Es würde also heute noch heißer werden. Fast konnte er den Gang genießen, aber ihn plagte das Rheuma in den Füßen, das er sich in Sibirien zugezogen hatte, und jeder Anstieg verursachte ihm Hustenreiz. Beppo machte sich einen Spaß daraus, die Brücken, die sie überstiegen, rückwärts abzuzählen, bei „sieben“ fing er an, und als sie die letzte hinabstiegen und schon den Eingang zur Post sahen, drehte er sich um und fragte in schlingerndem Französisch, ob sein Gast wisse, wie viele Brücken Venedig habe. Da keine Antwort kam, gab er sie selbst: „Plus des quattrocento!“
„Saint-Pétersbourg en a plus“ , knurrte Dostojewskij zurück, als hätte man ihn persönlich beleidigt, obwohl es ihm egal war, aber er hatte gelesen, dass jemand sich die Mühe gemacht hatte, die Brücken beider Städte abzuzählen und bei der nördlichen auf mehr gekommen war.
Erst als er den Brief seines Bruders Michail öffnete, fiel ihm ein, dass er ihm ja heute früh hatte schreiben wollen, aber Dostojewskij schrieb nicht gern Briefe. Käme er in die Hölle, so scherzte er oft für sich, bestünde seine Strafe darin, täglich zehn Briefe schreiben zu müssen. Bettelbriefe waren die einzige Motivation, die er finden konnte, und dann fand er auch die schönsten, romantischsten Formulierungen. Die Briefe aus seiner Anfangszeit in Petersburg an den Vater in Moskau waren voll davon gewesen: Herzensergüsse gegen Geldfluss. Rührung für Rubel. Sprache als Rechnung. Ein Tauschgeschäft. Ein Leben ohne Schulden kannte er nicht. Immer hatte er Furcht, jemandem zu begegnen oder von jemandem aufgesucht zu werden, dem er Geld schuldete. Immer schrieb er um längst ausgegebene Vorschüsse. Er kämpfte mit den Gläubigern wie Laokoon mit den Schlangen. Manche Weitschweifigkeit in seinen Romanen schoben Bösmeinende darauf, dass sein Honorar von der Zahl der Druckseiten abhing.
Der Wechsel war geringer, als er gehofft hatte, und die Botschaft seines Bruders eindeutig: Er möge bitte raschestmöglich zurückkommen, dies sei das absolut Letzte, was er ihm schicken könne, „Die Zeit“ stecke in ernsten Schwierigkeiten, ein Geldgeber sei abgesprungen und überhaupt wäre es schön, wenn er nach über zwei Monaten seinen Kompagnon wieder an der Seite hätte. Für Michails Verhältnisse waren das ernste Vorwürfe. Aber Dostojewskij dachte an die langen Jahre in Sibirien, in denen er vergeblich auf ein paar Zeilen seines Bruders gehofft hatte, und sein schlechtes Gewissen beruhigte sich, ohne wirklich erwacht zu sein. Dass er „über seine Verhältnisse“ lebe, musste er sich seit jeher anhören, nicht von Michail, aber immer von denen, die selbst um Wahrung eines gewissen Status notdürftig bemüht waren: den Bürgern. Dass er mehr Aufwand treibe, als es ihm Verstand und Vernunft, wie er sie doch ausreichend besäße, eingeben müssten. Das war so, als gäbe es nichts anderes und als müsste nach nichts anderem gestrebt werden als „finanzieller Sicherheit“, und all die vielen anderen Absicherungen und Sicherheiten, durch die sich das bürgerliche Leben definierte, schienen auf diese eine große Weltsicherheit gegründet, die, dadurch zur existenziellen Sicherheit gemacht, in Wahrheit das Unhaltbarste, Kleinste, Ungesichertste und alleine aus sich heraus nichts Verheißende und nie und in nichts Seligmachende war: der Mammon, das Geld. Dostojewskij hatte kein „Verhältnis“ zum Geld, und er ärgerte sich, dass die Menschheit die gleiche Bezeichnung dafür verwendete, mit der sie über Liebesdinge sprach.
In der Bank gleich daneben machte er den Wechsel zu Geld und bat Beppo, ihn zurück zum Hotel zu bringen. Während dieser ihn rechts und links auf Gebäude aufmerksam machte und selbsterheiternde Geschichten dazu erzählte, dachte er über sein Leben nach. Angenommen, ich hätte zwanzigtausend Rubel, sagte er sich. Viertausend wären für Schulden, dreitausend für Schulden, noch mal viertausend für Schulden. Seine Frau und Pascha erhielten dreitausend, Apollinaria zweitausend, dann blieben viertausend zum Leben für ein ganzes Jahr. In Venedig? Beinahe hätte er geschmunzelt über diesen verwegenen Gedanken.
Als er in ein Café treten wollte, weil ihm einfiel, dass er auf das Frühstück vergessen hatte, drängte Beppo ihn weiter – es war voll österreichischer Soldaten. Dafür führte er ihn in eines, wo er wieder mit lautem Hallo begrüßt wurde, und hielt, als Dostojewskij Platz genommen hatte, an der Schank stehend schon ein kleines Weinglas in der Hand.
Die gekochten Eier waren angenehm weich, die Aprikosenmarmelade gut und mit ganzen Fruchtstücken durchsetzt, der Kaffee aber zu wenig heiß und das mondsichelförmige Gebäck, das er in Paris geschätzt hatte, kam hier in einer traurigen, glatten, unknusprigen venezianischen oder vielleicht auch Wiener Version, zudem kleiner, was dadurch nicht besser gemacht wurde, dass es im Mund mehr zu werden schien. Da im hinteren Teil des leeren Cafés eine Tür und vorne ein Fenster offen standen, zog es genau zu seinem Tisch hin, und er war froh, nach fünfzehn Minuten wieder draußen zu sein, ohne sich erkältet zu haben. Eine französische Zeitung von gestern nahm er vom Nebentisch mit.
Auf einem Platz, zu dem sich die Straße kurz vor seinem Hotel vergrößerte, standen vier Bänke jeweils am Fuß einer alten Platane, zu dieser Stunde drei in deren Schatten, eine in der Sonne. In der Mitte des Platzes ein großer Brunnen. Dostojewskij entließ Beppo, der ihn gern noch zu einer „Galleria dell’Accademia“ mitgeschleppt hätte, die seinem Fuchteln zufolge am Ende der Straße lag, mit einer ähnlichen Münze wie beim letzten Mal und ließ sich müde auf eine der schattigen Bänke fallen. Wie kann man in einer derartigen Hitze leben und arbeiten, dachte er. Er schlug die Zeitung wie üblich aufs Geratewohl auf, und sein Blick fiel auf den Namen Pierre-François Lacenaire. Er hatte schon in Paris von diesem spektakulären Fall der jüngeren französischen Kriminalgeschichte gelesen, in dem ein Sohn aus bürgerlich gut situierter Familie, der früh Zurücksetzung und Lieblosigkeit erfahren hatte, zu einem gewaltigen Schlag gegen die Gesellschaft ausholte und mit zweiunddreißig unter der Guillotine starb. Die ersten Raubüberfälle beging er anscheinend nur, um ins Gefängnis zu kommen, das er die „Hochschule der Kriminalität“ nannte, und dort das Handwerk des Schwerverbrechers zu lernen. In Freiheit beging er mehrere Raubmorde, unter anderem an seiner Mutter, später im Gefängnis schrieb er Gedichte und empfing Journalisten, im Warten auf die Hinrichtung verfasste er seine Autobiographie. Er erklärte seine Verbrechen zu einem „Duell mit der Gesellschaft“, deren Ungleichheit und Ungerechtigkeit, Egoismus und Verlogenheit ihn dazu gezwungen hätten.
Dostojewskij wollte sich eben in den Artikel vertiefen, als der eruptive Schrei eines Mannes, dem ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen sein musste, ihn herumfahren ließ. Doch es war nichts geschehen, als dass der Mann im Gehen einen Freund erkannt hatte, der ihm entgegenkam, und diese Freude lautstark kundtat. Der Andere echote ähnlich euphorisch und schon fanden sich die beiden im lebhaftesten Gespräch und direkt hinter seiner Bank. Zwar verstand er kein Wort, aber die Heftigkeit des Wortwechsels machte konzentriertes Lesen unmöglich. Auch, dass er sich mehrmals mahnend umdrehte, half nichts, einer von den beiden sah sogar im Reden auf ihn hinunter und lächelte ihn an, es gab nicht den Funken einer Ahnung, dass sie stören könnten. Da sie weit auseinander-liegende Stimmlagen hatten – einer im rauen, gequetschten Falsett, der zweite im sonoren und beinahe noch durchdringenderen Bass –, deckten sie alle Frequenzen ab und hackten gleichsam von zwei Seiten auf den armen Kopf des vor ihnen Sitzenden, der keine andere Hilfe sah, als auf die andere schattige Bank auf derselben Seite des Platzes zu flüchten, wo er, ein paar Meter entfernt, wenigstens sein Trommelfell in Sicherheit wusste. Doch kaum hatte er den ersten Absatz des Artikels gelesen – neue Schriften des Verbrechers waren gefunden worden –, kamen die beiden Schreihälse, deren einer offenbar beschlossen hatte, den anderen, der in größerer Eile war, ein Stück seines Wegs zu begleiten, an seine neue Bank heran und blieben exakt hinter ihr stehen. Als sich der verzweifelt an seine Zeitung Klammernde nun sehr energisch umdrehte, hielt der Bass gerade im Reden inne, weil er einen Namen suchte, der ihm entfallen war, und in diesem Innehalten schaute er auf den Fremden, und im Suchen des Namens suchte sein Blick die Bank, auf der er den Zeitungsleser doch eben noch hatte sitzen gesehen, aber bevor noch eine Verwunderung darüber aufkommen konnte, fand sein Blick den entfallenen Namen auf der leeren Bank, und beides, Gespräch und Aufmerksamkeit, kehrten aus noch vollerem Hals zum Partner zurück, der über der Brisanz des Themas seine Eile vergessen hatte und mit verschränkten Armen und offenem Mund dastand.
Читать дальше