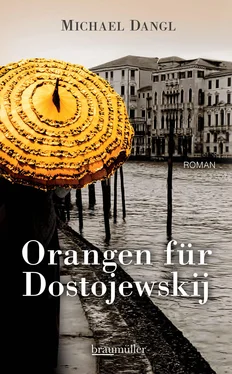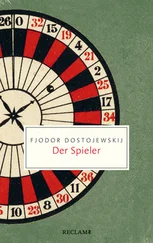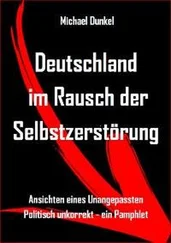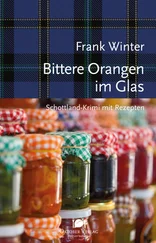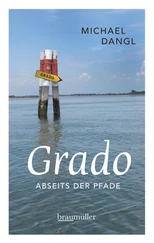Amüsiert dachte er an eine Begebenheit, über die er sich geärgert hatte, als er in Dresden einen Mann auf der Straße gefragt hatte, wo die Gemäldegalerie sei.
„Was?“, war dessen Nachfrage gewesen.
„Wo ist die Gemäldegalerie?“
„Gemäldegalerie?“
„Ja, Gemäldegalerie.“
„Die Königliche Gemäldegalerie?“
„Ja, die Königliche Gemäldegalerie.“
„Ich weiß nicht, ich bin hier fremd.“
Die Straße säumte ein Spalier von Bäumen ungewöhnlich roten Oleanders, und er ging gerade in der Mitte durch wie ein General, der solche Ehrenbezeugungen gewohnt ist, ernst und mit gesenktem Kopf, und sog den Duft heimlich durch die Nase ein. Das Gebäude erinnerte ihn in der Eingangshalle noch unglücklich an die Florenzer Uffizien, doch schon nach den Treppen zum ersten Stock konnte er den Blick nicht von der Decke des prächtigen Saales wenden, aus deren Vertäfelung Hunderte Köpfe auf ihn herniedersahen, und er stellte sich vor, dass sie lebendig wären und die dazugehörigen Menschenkörper flach am Bauch lägen und ihre Gesichter durch die ovalen Öffnungen nach unten steckten. Wurden sie alle paar Stunden von anderen abgelöst?
Im Saal selbst waren Ikonen ausgestellt, italienische von vor zwei- bis fünfhundert Jahren, und er blieb lange vor jeder stehen. Die Gesichter der Heiligen hatten einen ganz anderen Ausdruck, als er es von den altrussischen Ikonen kannte, weniger streng, offener, man konnte sagen: vermenschlichter. Und er wusste nicht, ob ihm das so gefiel. Die Madonna von da Bologna sah lächelnd, geradezu keck auf den Betrachter, während sie Gottes Sohn stillte, und der Heilige Markus von Veneziano erinnerte ihn mit seiner routinierten Freundlichkeit an den Rezeptionisten im Hotel. Als er die weiteren Säle durchschritt, merkte er, dass er wahrscheinlich zu viel Zeit und Energie für den ersten verbraucht hatte, denn schon war er, wie rasch in Museen, müde. Der Heilige Hieronymus von della Francesca schaute skeptisch und eigentlich recht hochmütig auf den ihn anbetenden devoto , wie ein alter Krämer, der die Kaufkraft einer um Ware heischenden Kundschaft anzweifelt. Doch drei sehr unterschiedliche Madonnen von Bellini und deren Knaben ließen ihn lange nicht aus ihrem Bann. Wiewohl – oder weil – sie recht hoch hingen und er sie nicht gut sehen konnte. Als er einen in der Ecke des Raums stehenden Stuhl nahm und sich darauf einer Madonna in Augenhöhe stellte, kam ein Saaldiener und sagte, das sei verboten. Kaum war der Saaldiener draußen, stieg er vor einer anderen Madonna auf den Stuhl, der Saaldiener kam wieder und wies ihn nun schärfer zurecht. Dostojewskij schimpfte auf Russisch: „Lakaienseele!“ und verließ erzürnt den Raum.
In einem Saal mit einer langen Bank in der Mitte setzte er sich dankbar auf deren Rand und verschränkte die Beine. Die „Ankunft der englischen Gesandten am Hof des Königs der Bretagne“, wie sie Carpaccio in einem großen Gemälde vor ihm schilderte, schien ihm eine Veranstaltung, bei der er nicht so gerne dabeigewesen wäre, von hohem politischen Ernst und Angst vor der falschen Geste, dem falschen Gesicht. Eine Figur zu seiner Rechten zog seine Aufmerksamkeit auf sich, es war seine eigene, reflektiert von einem in eine Tür eingelassenen Spiegel. Dostojewskij staunte. Er fand es seltsam, dass sein Inneres noch immer so wenig Einfluss auf sein Äußeres genommen hatte. Nach außen schien er nach wie vor ein sittsamer Bürger, ein aufgeräumter, biederer, pflichtbewusster Beamter zu sein, und war doch ein verurteilter Revolutionär, ein entlassener Sträfling, ein Spieler, Freigeist und Lebemann – zumindest war er das alles phasenweise gewesen. Nichts davon manifestierte sich in seinen Zügen und in seiner Haltung. Selbst in Uniform, er wusste es, verlor sich das Beamtische seiner Positur nicht, nur weitete das Militärische die leichte Entrüstung, die – worüber auch immer – für gewöhnlich in seinem Gesicht saß, auf seinen Oberkörper aus, als würde die Uniform dem Kriegerischen in ihm irgendwie Mut machen. Seine im Sitzen übereinandergeschlagenen Beine aber, fiel ihm auf, schienen von all den vermeintlichen oder echten Entrüstungen der höheren Körperpartien nichts zu wissen, sie wirkten frei und unabhängig, ein selbstständiges, selbstbewusstes, im Leben stehendes Beinpaar, das den offensichtlichen Verunsicherungen der Menschenhälfte über ihnen eine verlässliche Stütze bot. So zerfiel seine Erscheinung, dachte er, an seinem eigenen Bild eine Art Kunstkritik übend, zumal im Sitzen in zwei, wenn nicht drei Teile: einen gedrungenen, schutzlosen, sich vergeblich stark gebenden Torso mit einem wie halslos daraufgesteckten mürrisch in die Welt gereckten Kopf einerseits – und zwei unaufgeregten, geradezu eleganten und, vergaß man den Rest, eigentlich aristokratisch unbekümmerten schlanken Beinen, die in fast schon kokett schmalen Schuhen und also Füßen ausliefen. Er fand, er sah aus wie eine Zeichnung in diesem Kinderbuch, in dem man die Körperdrittel unterschiedlichster Figuren zueinanderklappen und die groteskesten Erscheinungen kreieren konnte. Wobei in seinem Fall der Kopf durchaus zu den Beinen zu passen schien und nur ein in der Relation zu klein geratener Oberkörper eingeschoben war, die Arme eng angelegt, dessen große, beinahe fleischigen Arbeiterhände wie unterbeschäftigt auf dem feiertäglich ruhenden Oberschenkel lagen. Im Ganzen war er sehr unzufrieden mit seinem Anblick.
Auf der Suche nach dem Ausgang hielt ihn noch ein Bild fest, auf dem ein Geistlicher in einem Kanal schwamm; der Titel des Bildes von Bellini erklärte, dass nicht der Priester von der Brücke San Lorenzo – auf der, wie an den Ufern, Hunderte Schaulustige standen – gefallen war, sondern eine Reliquie des Heiligen Kreuzes, und das titelgebende „Wunder“ bestand wohl darin, dass sie nicht untergegangen, sondern auf der Wasseroberfläche geblieben war, da der sie jetzt stolz zur Schau stellende, schwimmende Geistliche am Oberkörper trocken und also nicht nach ihr getaucht war.
Vor der Galerie stand Dostojewskij am Fuß einer steil nach oben führenden eisernen Brücke über einen breiten Kanal. Sie lag in praller Sonne, und da er die Anstrengung des Aufstiegs fürchtete, bog er im Schatten des Gebäudes nach rechts und ließ sich von seinen Beinen mehr oder weniger von selbst durch das Spalier der Oleanderbäume in sein Quartier führen, wo er sich, seiner Schwäche nachgebend, ohne Rock und Weste auf sein Bett warf und etwa zwei Stunden versuchte, sein heftig heraufschlagendes Herz mit ruhigem Denken und schlummerähnlichen Zuständen gewissermaßen zuzudecken, hinunterzudrücken. Dabei hüpfte ihm der Affe im roten Kapuzenmantel, der ihm vom unteren Bildrand Carpaccios vorhin bei seiner Selbstbespiegelung zugesehen hatte, kreuz und quer durch seine Halbschlafbilder, die von leisen elegischen Melodien einer Ziehharmonika unterlegt waren.
Er saß schon länger über seinen Skizzen am Schreibtisch, als es an der Tür klopfte. Statt des erwarteten Beppo stand ein kleiner dunkelhäutiger Junge da, barfuß, mit kurzen Hosen und nacktem Oberkörper, und zuerst dachte Dostojewskij, der Affe sei aus dem Bild gesprungen und zu ihm gekommen. Der Junge, bei dem nicht klar war, was Sonnenbräune, Naturfarbe oder Schmutz war, hatte einen Hammer in der Hand und rief aus einem Mund, der aus mehr Lücken als Zähnen bestand:
„Validsa!“
Durch die Ähnlichkeit mit dem französischen Wort verstand Dostojewskij, dass Beppo ihn geschickt haben musste, um seinen Koffer zu reparieren, und ließ ihn ein. Der Kleine erspähte das Gepäckstück, begutachtete das verbogene Schloss und schlug dreimal mit dem Hammer so fest darauf, dass es vollends in Stücke brach. Dann stellte er sich daneben, hielt die Hand auf und sagte:
„Zwanzig, s’il vous plaît.“
Dostojewskij hob die Hand zu einer gestischen Ohrfeige und jagte den Kerl hinaus.
Читать дальше