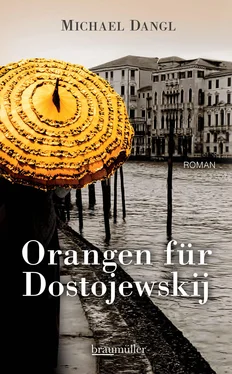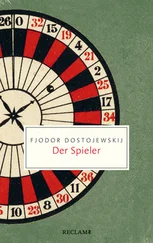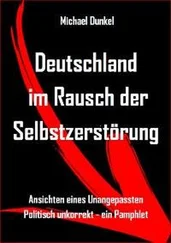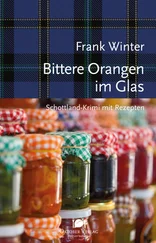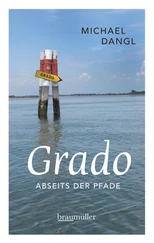„Das wusste ich nicht“, sagte der Maestro, und Victoria lachte auf.
Die Küchengehilfen stellten vier große, dampfende Schüsseln auf den Tisch. Sie waren, der Russe schluckte, bis oben voll mit Pelmeni.
„Vorsicht“, scherzte Victoria und schüttelte eine Schüssel, wodurch die Nudeltaschen auf und ab sprangen, „die leben noch!“
„Ich kenne das“, erwiderte der Gast wie einer, der mit den Feinheiten der inländischen Küche vertraut ist, „das sind … Tortelli.“
„Tortellini?“, verbesserte das Mädchen, und der Komponist sprang ein: „Ravioli. Mit viererlei Füllung: Fleisch, Ricotta, Trüffeln, und hier: Ravioli tirolesi – eines der wenigen bemerkenswerten Dinge, die uns die Österreicher gebracht haben, gefüllt mit Käse und Spinat, die sogenannten Schlutzkrapfen. Sagen Sie Schlutzkrapfen, Dostojewskij.“
„Schltzkrpfn“, wiederholte er, alle lachten, aber die Aussprache fiel ihm aufgrund der überwältigenden Mehrheit der Konsonanten weniger schwer, als man gehofft hatte. Frische Gläser wurden gebracht und neuer Wein, diesmal in Flaschen.
„Ein Frascati aus Lazio.“ Rossini hielt seine Nase tief ins Glas. „Einmal habe ich – es war der sechsundzwanzigste November achtzehnhundertsiebenunddreißig – bei einem Baron in Umbrien zu Ravioli einen Rosé aus Apulien bekommen.“ Dies sagte er zu Pantalone hin, den es angewidert beutelte. „Es war ein schrecklicher Abend.“
Dostojewskij ließ sich von allen vier Sorten auf seinen Teller geben. Die Nudeln waren flacher und an den Rändern gezackt, aber wenn er die Augen schloss, konnte er dabei an Pelmeni denken.
Nach den Nudeln kamen große Fleischteile, die sich als ganze gebratene und geköchelte Gänselebern herausstellten. Der Maestro ging selbst von Teller zu Teller und überhobelte sie mit schwarzen Sommertrüffeln aus dem Périgord, die er, wie er stolz verkündete, am Pariser Markt gekauft hatte. „Der Trüffel ist der Mozart der Pilze“, sagte er, als er zu seinem Platz zurückkehrte. Dazu gab es Gavi di Gavi aus dem Piemont. Dostojewskij konnte sich nicht erinnern, je so viel gegessen zu haben, aber die verschiedenartigen Geschmackskapriolen, die die Gerichte auf seiner Zunge schlugen, überstrahlten ihren Sättigungswert, und die anregende Gesellschaft mit ihrer niemals stagnierenden Lebendigkeit nivellierte ihn geradezu. Als die Männer überraschend in die Küche gerufen wurden und Dostojewskij aufstehen wollte, legte ihm Rossini wieder eine Hand auf den Unterarm und befreite ihn von der Pflicht. Wie beim ersten Mal empfand der sonst Berührungsängstliche die Geste nicht als unangenehm. Und das kam nicht bloß, weil es Rossini war, der sie ausführte – dessen Hände übrigens auffallend schön, weiß, aristokratisch waren –, nicht bloß, weil Rossini für ihn Teil des großen, von klein auf erträumten und lebenslang idealisierten Mysteriums Europa und damit der Vervollkommnung von Kunst und Kultur und es ein wenig so war, als legten Schiller, Hoffmann, Bach und Balzac mit ihre Hand auf, sondern weil in der leichten, fast nur angedeuteten Berührung so viel Takt, Vorsicht, Respekt lagen, dass sie sich in der Ausführung beinahe selbst verneinte und für den Berührten alles andere als Besitzergreifung, Befehl, Maßregelung, vielmehr eine Bewusstmachung der eigenen Willenskraft und vielleicht – in der vermeintlichen Geste von Überlegenheit – ein tastendes Suchen nach der Stärke des Anderen, ein kurzes Ausruhen in dessen Energie war.
Die Männer schleppten eine riesige Schüssel – eher eine kleine Badewanne – heran, die sehr schwer zu sein schien. Sie war bis oben mit einer gelblichen Flüssigkeit gefüllt, aus der Gliedmaßen ragten, in der schwachen Beleuchtung war es schwer auszumachen, von was oder wem. „Hier kommt unser Kastrat“, sagte Rossini und hieß die Anderen mit einem „Sch!“ ruhig zu sein. Einer hob eine Art Schenkel aus der Wanne und ließ ihn wieder hineinfallen, wodurch diese ins Ungleichgewicht kam und fast umgekippt wäre, aber die Männer, allesamt athletisch, stemmten die Beine in den Boden und tarierten geschickt aus. Die Flüssigkeit gluckste unheimlich in der plötzlichen Stille des Raums. „Keine Sorge“, flüsterte Rossini. „Seit heute Morgen badet er zerteilt in mehreren Litern Zitronensaft. Ein sizilianisches Rezept: castrato marinato .“
Und auf Dostojewskijs erschrockenen Blick: „Ein castrato heißt castrato , ob es sich um einen Sänger oder, wie in diesem Fall, um einen Hammel handelt – ein kastriertes Schaf. Gleich wird er abgegossen, in gehacktem Knoblauch gewälzt – Letzteres traditionell von den Frauen – und am Grill gegart. Al lavoro, amici!“
Und die starken Männer, um die sich nun auch die Frauen scharten, schleppten das vorgeführte Tier zurück in die Küche, nahmen ihr Geplauder und Geschnatter wieder auf und machten sich an die Arbeit, und der Dichter und der Musiker saßen auf einmal allein an der langen Tafel mit den Kerzen und abgegessenen Tellern, schwiegen und schauten einander in die Augen, was man im Halbdunkel tun konnte, ohne aufdringlich zu sein oder sich belästigt zu fühlen. Zurückgelehnt ahnte man die Augen des Anderen mehr, als man sie sah.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.