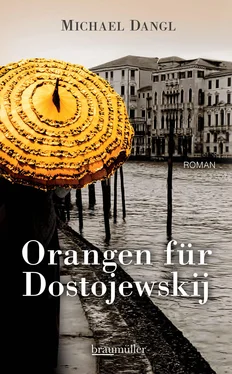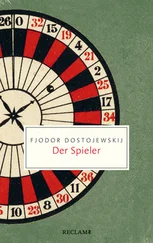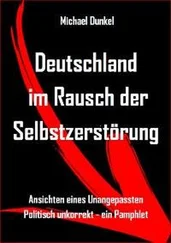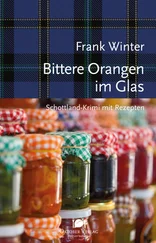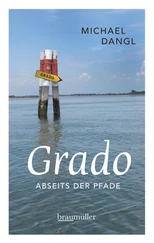„Wir warten hier in Europa schon lange auf den neuen Puschkin. Sind Sie es?“
Bevor Dostojewskij rot werden konnte, legte ihm Rossini die Hand auf den Arm und lachte gewinnend. „Entschuldigen Sie. Wir Italiener sind schrecklich direkt. Sie haben eine erstaunliche Physiognomie. Ich habe im ersten Moment geglaubt, ich kenne Sie. Sie sehen aus wie jemand, den man kennen sollte. Sie sind noch jung?“
„Vierzig.“
„Mit vierzig habe ich aufgehört, Opern zu schreiben. Und mich dem Genuss des Lebens hingegeben. In meinem Landhaus bei Paris koche ich für Freunde. Auf Reisen lasse ich kochen. Aber nach meinen Angaben und Bestellungen.“ Er zeigte auf den Wirt und drei Küchenhilfen, die große Platten mit Wurst, Käse, Tomaten, Trauben und Brot brachten. „Oliven aus Kalabrien, Gorgonzola aus der Lombardei, Schinken aus Sevilla. Und unser Hauptstück.“ Mit der Andeutung einer großen Operngeste zeigte er auf eine gut zwei Meter lange Wurstrolle mit dem Durchmesser eines Wagenrades, die am Ende der Tafel auf einem hölzernen Gestell stand. Der Wirt zog sich gerade weiße Handschuhe über und fing an, mit einem langen, feinen Messer dünne Scheiben des rosafarbenen Kolosses abzuschneiden. „Mortadella aus Bologna. Aber in ihrer ursprünglichen Form als Myrtatella, mit Myrtenbeeren statt mit Pfeffer gespickt.“
Damit bekam er die erste Scheibe direkt vom Messer des Wirts, hob sie mit den Fingern hoch und sog tief ihren Geruch ein. „Im Mittelalter war ein Viertel der Bevölkerung Bolognas ausschließlich damit beschäftigt, Mortadella zu machen.“ Er öffnete den Mund und ließ die gefaltete Scheibe sehr langsam von oben hineingleiten, was die Runde mit einem gedehnten „Aaah!“ untermalte. Er kaute und beschrieb den Genuss gestisch mit kreisenden Bewegungen der rechten Hand, während die linke zum Glas griff. „Der Papst erließ ein Gesetz, in dem die Zubereitung festgeschrieben war. Wer noch vor hundert Jahren ohne Befugnis Mortadella herstellte, musste dreimal auf die Streckbank. Heute zahlt er eine enorme Strafe.“ Dies sagte er mit erhobenem Zeigefinger zu Dostojewskij, wie um diesen, sollte er je auf die Idee kommen, unerlaubt Wurst zu produzieren, vor den Folgen zu warnen. Dessen Gesichtsausdruck verriet in seinem gleichbleibenden staunenden Ernst, dass dies nicht in seiner Absicht gelegen hatte, erhellte sich aber, weil das Mädchen zurückkam, Rossini einen Kuss auf den Hinterkopf drückte, sich neben ihn setzte und dem russischen Gast das strahlendste Lächeln schenkte.
„Victoria ist der Glanz der hiesigen commedia“ , erklärte der Komponist. „Ich möchte sie gerne zur comédie nach Paris entführen, aber sie hängt schrecklich an ihrem Venedig. Ich verstehe sie.“ Er nahm einen tiefen Schluck Wein. „Ich hatte die glücklichsten Zeiten meiner Jugend hier. Mit achtzehn komponierte ich meine erste Oper für das Teatro San Moisè. Mit achtzehn ein Opernauftrag für Venedig! Ich habe damals gar nicht verstanden, was das heißt. Ich schrieb eine farsa in einem Akt. Einige weitere Opern folgten. Der Erfolg war nicht riesig, aber das Honorar war gut. Meine Musik hat viele irritiert, die Lieblicheres gewohnt waren. Noch war ja die Oper die Königin der Musik. Aber sie war für den Augenblick gedacht, nicht für die Ewigkeit. Ich bin mein Leben lang beim Success ruhig geblieben … wie beim Fiasko. Ein fiasco “, deutete er ans untere Ende der Tafel, „ist im Italienischen auch die ‚Weinflasche‘. Schrieb ich meinen Eltern nach einer Premiere, deutete ich auf dem Couvert bereits das Ausmaß des Fiaskos an, indem ich eine mehr oder weniger große Weinflasche darauf zeichnete.“
Da lachte Dostojewskij zum ersten Mal, abgehackt und kurz, aber ehrlich. Rossini freute sich darüber und hob sein Glas, doch ohne ihm, was er befürchtet hatte, zuzuprosten. „Der ‚Tancredi‘ hier im Fenice war dann, was man meinen Durchbruch nennt. Ein Siegeszug der Oper folgte durch ganz Italien. Dann München, Wien, Dresden, Berlin, London, Paris, New York. Jetzt spielen sie mich gerade wieder im Fenice. Aber deswegen bin ich nicht hier.“ Er schaute seinem Gegenüber direkt in die Augen und sagte ohne eine Spur von Sentimentalität, eher heiter und wie nebenbei: „Ich wollte Venedig noch einmal sehen, bevor ich sterbe.“ Darauf tranken die beiden fremden Herren aus ihren Kristallgläsern und behielten einander im Blick.
Dostojewskij hatte sich von der Art Schock, plötzlich einem der größten Genies der Musikgeschichte, einem Helden seiner Jugend, gegenüberzusitzen, noch nicht erholt. Er musste seinen Schnitzer von der falschen ‚Barbiere‘-Oper wettmachen und sagte heiser: „Ich habe eben Ihr Stabat Mater in Wiesbaden gehört.“ Er hatte das Gefühl, im Lärm der Tischgesellschaft unhörbar zu sein, aber Rossini schien ihn anstrengungslos zu verstehen, denn er nickte lächelnd. Doch das war nicht genug, er musste etwas von seiner Begeisterung, von seiner tiefen Ergriffenheit zum Ausdruck bringen. „Ich glaube, dass …“ Er machte eine Geste mit der Hand und schämte sich sofort dafür, im Kreise dieser sich so geschmeidig und ungezwungen bewegenden Menschen wirkte sie hölzern und steif, und Rossini und das schöne Kind hingen an seinen Lippen und warteten darauf, zu hören, was er denn nun „glaube“, außerdem hatte er einen belegten Hals und trockene Lippen und kam sich unmöglich vor, doch ein Blick in die Augen der beiden gegenüber zeigte ihm, dass sie ihm das, auch wenn sie es natürlich empfinden mussten, nicht übel nahmen, und er raffte seinen Mut zusammen und sagte schließlich: „Ich weiß nicht, ob es in der Musik so viele schöne Stücke gibt.“ Und schämte sich schlagartig auch dafür. Aus lauter Angst, etwas Laienhaftes zu sagen, hatte sein Ton etwas Nüchternes, Besserwisserisches gehabt, als spräche irgendein trockener Musikologe; von einem Schriftsteller wäre wohl eine weniger plumpe Formulierung zu erwarten gewesen. Rossini lachte leise auf, aber nicht, um ihn auszulachen – dafür hatte Dostojewskij ein feines Gespür –, sondern mit wiegendem Kopf und, ja tatsächlich, aus aufrichtiger Bescheidenheit.
„Danke“, sagte er, und es klang wie von einem, der zum ersten Mal Lob über sein Werk hört, nicht wie von einem, der seit Jahrzehnten daran gewöhnt ist. „Das war vor dreißig Jahren. Meine Stücke liefen überall. Ich brachte gerade den ‚Barbiere‘ nach Madrid. Ein Triumph. Am Tag der Premiere kam ein Geistlicher und gab mir den Auftrag zu einem Stabat Mater. Ich komponierte, wurde krank, es dauerte lang. Von da an …“, er hob die Schultern und wischte auf dem Tisch ein paar Brotkrümel herum, als suche er zwischen ihnen die Erklärung für etwas, das er selbst nicht verstand, „… habe ich nie wieder einen Opernauftrag angenommen. Ich zog in eine einfache Mansardenwohnung im Théâtre-Italien in Paris, obwohl ich gut situiert war. Ich wollte unter meinesgleichen sein, unter Musikern, Theaterleuten.“ Er zeigte in die Runde, deren Gesichter jetzt alle auf ihn gerichtet waren. „Der fünfte Stock war gut für mich, denn ich fing an, dick zu werden.“ Er lachte und wischte wieder die Brotkrümel umher. „Ich hatte seit jeher die Passion der Faulheit. Meine zweite Lebenshälfte begann. Ich brauchte Ruhe … später zog ich mich nach Bologna zurück, und … così finita la comedia …“
Das Letzte sagte er schon mit Blick auf eine weitere Wurstplatte, die der Wirt an seiner massigen Schulter vorbei auf den Tisch hievte. „È arrivata la nuova mortadella“ , dozierte er mit gespieltem Ernst, als käme mit der neuen Wurst das Eigentliche des Lebens ins Spiel. Er zeigte auf verschiedene Sorten. „Hier haben Sie Mortadella aus Schweineleber, hier die besonders zarte Mortadellina, die Österreicher würden sie ‚Fräulein Mortadella‘ nennen …“ Und in das Lachen der Gesellschaft erhob zum ersten Mal Victoria ihre Stimme: „È la mia amata mousse!“ Sie nahm einen Tontopf, fuhr mit dem Mittelfinger in die rotbraune cremige Masse, hob eine kräftige Portion in die Höhe, roch daran, steckte sie sich mit dem Finger tief in den Mund, sog und zog ihn völlig sauber wieder heraus. „Mmh“, stöhnte sie laut, und wieder lachten alle.
Читать дальше