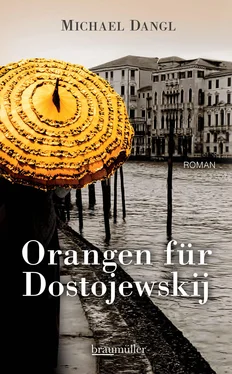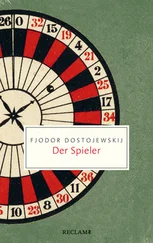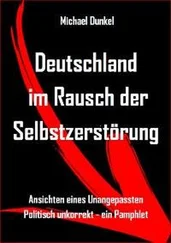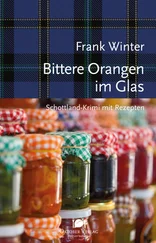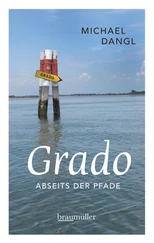Die brannte, wenn auch tiefer stehend, unvermindert auf die Boote und Gondeln der breiten Wasserstraße zwischen Venedig und einer großen Insel, von der nicht klar war, ob sie noch dazugehörte. Schutz suchend, bog Dostojewskij in eine Gasse und ging, wieder weg vom Wasser, stadteinwärts. Aber gab es hier überhaupt ein Zentrum? Irgendwo musste der berühmte Markusplatz sein. Einmal abgebogen, war man sofort allein mit den „Steinen von Venedig“, über die er bei Ruskin so viel gelesen hatte. Für dessen Satz, dass die schönsten Dinge auf der Welt die nutzlosesten seien, würde er ihm ewig dankbar sein. Passend dazu schickte eine Lilienhecke ihren betörenden Duft voraus, noch bevor er sie sah. Vor einem Haus saßen alte Frauen und schnitten Gemüse. Dostojewskij grüßte sie stumm. Sie erwiderten mit verhaltenem Staunen. Dann wieder stille Kanäle, fragile Brücken, Wäsche, Lichtreflexe in Fensterscheiben. Eine Kirchenglocke von weither. In einem winzigen Geschäft, in dem es nach Schokolade roch, kaufte er Kerzen, Streichhölzer, Zucker und Tee. Und, dem Geruch nachgebend, eine kleine Tafel Schokolade. Ein Trupp Soldaten kündigte ihm den Eintritt in eine belebtere Gegend an. Vielleicht würde er hier etwas zu trinken bekommen. Ein weiter Platz öffnete sich vor ihm, doch konnte das nicht der Markusplatz sein, den kannte er von Darstellungen, auch fehlte der Dom. Der „Campo Santa Margherita“ – diesen Namen las er nun auf einer Tafel – war weniger repräsentativ als volkstümlich und schien eher den Italienern zu gehören. Es gab weniger Uniformierte, dafür viele Kinder, die mit zu Bällen gebundenen Lederfetzen spielten oder Scharen von Tauben nachliefen, sie fütternd und verjagend in einem. Die Menschen hatten alle Stimmen wie Sänger, mit dem Zwerchfell gestützt und selbst auf Abstände von zwei, drei Metern so „gesendet“, als müssten sie damit den vierten Rang eines Opernhauses erreichen. Da sie das von klein auf taten – die Kinder schrien ihre Eltern so an, dass sie in Russland dafür Ohrfeigen bekommen hätten –, waren ihre Stimmen offen und sangesrein und zugleich rau, rau wie es die Stimmen der Russen vom ungestützten, im Rachen sitzenden Reden und, manchmal, vom Wodka wurden.
Obgleich sein Durst inzwischen schwer erträglich war, ging Dostojewskij an den nicht wenigen Lokalen vorbei, über den Platz hinaus und über eine Brücke und stand auf einmal vor dem Portal einer vollkommen schmucklosen Kirche. Vergeblich drückte und zog er an der Tür, sie war verschlossen. Und würde es wohl zumindest für heute bleiben. Außer, es gäbe später noch eine Messe. Er beschloss, sich den „Campo San Pantalon“ einzuprägen und wiederzukommen. Von einem Heiligen dieses Namens hatte er noch nie gehört, Pantalone kannte er bloß als eine Figur aus der italienischen Komödie. Und es war das französische Wort für „Hose“. Er ging zurück auf den großen Platz. Ein herrenloser Fußball kam ihm entgegengerollt. Als er sich bereits freute, ihn zu den spielenden Kindern in zwanzig Meter Entfernung, die ihn verschossen hatten, zurückzubefördern, ja schon stehen blieb und sein Gewicht auf das linke, das Standbein verlegte, rannte ein Junge schnell auf ihn zu, als liefe er um sein Leben, um den Ball nur ja nicht der Berührung durch den fremden Mann preiszugeben, und im allerletzten Moment stoppte er die Kugel mit der Schuhspitze und versetzte ihr gleich darauf, als Dostojewskij schon den rechten Fuß zum Schuss gehoben hatte, einen Stoß mit dem Absatz und brachte ihn so zu den Mitspielern zurück und Dostojewskij, der durch die fehlende Schussbewegung das Gleichgewicht verlor, ins Taumeln und fast zu Fall. Eine Gruppe junger Mädchen ging vorbei, alle schwarzhaarig und hübsch, eine sagte etwas auf Italienisch und alle lachten. Nun war es genug. Er musste einkehren. Da er in Florenz ein einziges Mal gut gegessen hatte und das in einer Osteria gewesen war, trat er in ein Lokal dieser Bezeichnung auf der Schattenseite des Platzes.
Es war noch früh, und das Gasthaus fast leer. An der Schank stand ein alter Mann mit Klappe über einem Auge. Mit dem anderen schaute er den Gast neugierig an. Der fragte, ob er Tee bekommen könne. „Tè“ , wiederholte der Alte ohne Ausdruck. Und wies mit einem Spültuch auf die langen ungeschmückten Holztische, die parallel zueinander, von lehnenlosen Bänken getrennt, vom Fenster neben dem Eingang bis in die Tiefe des Lokals aufgestellt waren wie zu einem Volksfest. Dem Fenster zugewandt saß ein Mann alleine mit einer Flasche und einem Glas. Ein Zopf geflochtener Haare fiel ihm über den Rücken. Dostojewskij setzte sich drei Tische dahinter und schaute an dem Mann vorbei auf die milchige Scheibe, die keinen Blick durchließ und wenig Licht. Das kleine Päckchen aus dem Geschäft legte er neben sich. Er fühlte sich schwach und fürchtete, seine Schlaffheit könne einen neuen Anfall ankündigen. Morgen musste er zur Post. Den Markusplatz besuchen und übermorgen nach Hause abreisen. „Ich eile aus den Alpen in die Ebenen Italiens“, hatte er vor ein paar Wochen Strachow geschrieben. „Ach! Ich werde Neapel sehen, nach Rom gehen, eine junge Venezianerin in der Gondel liebkosen …“ Diese von Puschkin gestohlenen Aussichten hatten den Freund wohl veranlasst, sich der Reise anzuschließen. Von der Euphorie war wenig übriggeblieben. Herrgott, dachte er, und wie viel ich mir von dieser Reise versprochen habe. Auf den Tee wartend, trommelte er leise mit den Fingern auf der Tischplatte.
„Die Kirche bleibt heute geschlossen“, hörte er eine Stimme auf Russisch sagen. Er erstarrte. Sie konnte nur von dem Mann vor ihm kommen, der regungslos mit dem Rücken zu ihm saß. „Trinker haben Augen nach hinten“, hatte er vor Wochen in London notiert (wo es mehr als genug Anschauungsmaterial gegeben hatte). Der Mann drehte sich abrupt um. Das längliche Gesicht war vollkommen weiß mit roten, glühenden Backen und schwarzen, glasigen Augen. Der wie zu einer Fratze verzerrte grinsende Mund trug kaum Zähne, und die waren beinahe schwarz, einer golden. Die zum Zopf geflochtenen Haare entsprangen den letzten bewachsenen Stellen über den Ohren, ansonsten war der Schädel kahl.
„Woher wissen Sie …?“
„Man kennt sich doch“, sagte der Mann nur. Der Tee kam. Dostojewskij hatte längst gelernt, dass in Europa keine Samoware benutzt wurden. Der Tee, das merkte er gleich, war dünn und lauwarm, die Kanne nur wenig über halbvoll. Dafür konnte er den schlimmsten Durst sofort stillen. Der Mann hatte sich wieder seiner Flasche zugewandt.
„Die Verpflegung in Gefängnissen ist nicht besser“, sagte er jetzt zum Fenster hin, doch wieder so, dass es für den hinter ihm gemeint war. Sein Russisch war gut, nur die zu deutliche Artikulation verriet den Italiener.
„Vor allem, wenn die Herrscher keine Kultur haben.“ Er schenkte sein Glas voll. „Haben sie Kultur? Nein. Die Deutschen haben die Kartoffel, sonst nichts.“ Er kicherte und trank einen kleinen Schluck Wein. Dostojewskij schaute ernst, was bei ihm vieles heißen konnte, viel Gegensätzliches, manchmal, dass er etwas zum Lachen fand. Auch in Russland war die Kartoffel Synonym für deutsche Küche und deutsches Wesen. „Fad wie eine Kartoffel“ war eine beliebte Redewendung.
„I tedeschi“ , deklamierte der Mann. „Ein Trauerspiel in keinem Akt.“ Und kicherte wieder. „Die Totengräber Venedigs“, sagte er auf einmal sehr ernst. „Die Schergen Napoleons. Napoleon hat Venedig umgebracht, die Deutschen begraben es. Noch nie haben sie eine so schöne Kulisse für ihre schrecklichen Pompes funèbres gehabt. Haben Sie gewusst, dass sie Venedig beschossen haben?“, damit drehte er sich wieder um. „Venedig beschossen“, wiederholte er mit der italienischen Geste, die drei Finger jeder Hand wie zu einer Blüte formt, um das Gesagte hervorzuheben. „Auch aus der Luft!“ Eine Hand fuhr in die Höhe. „Natürlich erst von der terraferma aus, von Mestre, dreiundzwanzigtausend Geschosse, drei Wochen lang. Bumm – bumm! Auch die Rialto-Brücke: bumm – getroffen. Aber dann kamen sie aus der Luft. Das hat es noch nie in der Geschichte gegeben. In der Weltgeschichte! Ein Luft-Angriff! Auf einmal zogen am Himmel, am heitersten venezianischen Himmel wie von Canaletto gemalt, Ballone auf mit Flammen, sichtbaren Flammen, hundert Heißluftballone, die Brandbomben mit Zeitzündern über die Stadt trugen, Bomben für die Kirchen von Palladio, für die Bilder von Tintoretto, Bomben! Was für Barbaren! Und rechnen können sie auch nicht. Sie haben die Explosionszeit falsch eingestellt. Keine einzige der hundert Bomben wollte über der Stadt zerplatzen. Sie flogen über unsere Köpfe dahin ins Meer, und einige nach Osten aufs Festland und da fielen sie auf ihre eigenen Leute. Che farsa!“ Er klatschte in die Hände wie zu einem gelungenen Schauspiel. „Werr andern aina Gruba gräbt“, sagte er in gespreiztem Deutsch und lachte. „Trotzdem haben sie Venedig erobert. Und wie?“
Читать дальше