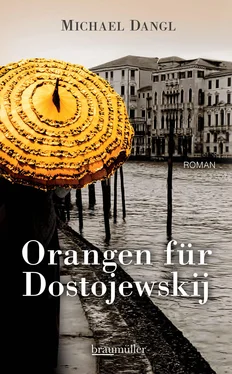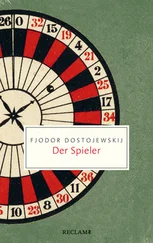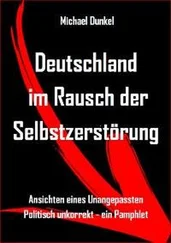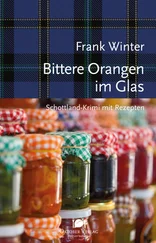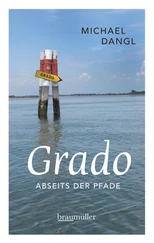Zudem war jede letzte Station einer Reise von den Bekümmernissen um die Heimkehr beschwert. Privat und beruflich hing der streng wirkende zugeknöpfte Herr mit dem sacht ausufernden Bart nämlich völlig in der Luft. Sein sogenannter literarischer Durchbruch, der Roman „Arme Leute“, lag sechzehn Jahre zurück, und nach dem Veröffentlichungsverbot, Teil der zehnjährigen Haftstrafe in Sibirien, war es schwer gewesen, an diesen Erfolg wieder anzuschließen. Immer wenn er daran dachte, verschlimmerte sich das Stechen in seiner Seite, das von der Leber kam und ihn daran erinnerte, dass es gesundheitlich mit ihm in mehrfacher Hinsicht im Argen stand. Abrupt und mit einer Energie, dass alle fünf Augenpaare im Abteil zu ihm sprangen, zog er ein dünnes Heft aus der Rocktasche und schlug es auf. Vor einem guten Jahr hatte er begonnen, über seine epileptischen Anfälle Buch zu führen. Dauer und Heftigkeit waren verzeichnet (leicht/mittel/schwer) sowie die Abstände zwischen ihnen, die von einem halben Tag bis zu einem halben Jahr reichen konnten. Jedem Anfall ging eine längere Phase der Niedergeschlagenheit voraus, den schweren folgte tagelange Arbeitsunfähigkeit. Der letzte Eintrag („mittel“) nannte den einunddreißigsten Mai, eine Woche vor der Abreise. Schon vor Jahren, noch in Sibirien, hatte ihn der Arzt, der die Erkrankung zum ersten Mal diagnostizierte, gewarnt, bei einem der Anfälle werde er an dem Schaum, der ihm aus dem Mund stieg, am Rücken liegend ersticken. Inzwischen hatte er eine gewisse Übung darin bekommen, das Aufsteigen einer neuen Eruption in sich zu verspüren und sich, vor allem wenn er alleine war, wie immer möglich darauf vorzubereiten.
Der Zug hatte die Lagune überquert und fuhr in den Bahnhof ein. Unter großem Rascheln und Poltern rafften die Reisenden ihre während der Fahrt um sich verstreuten Gegenstände zusammen, und Dostojewskij dachte daran, wie ihm der Schaffner in Mailand dieses Coupé, in dem nur ein junges, sehr hübsches Mädchen gesessen war, zugewiesen und sich dafür Trinkgeld erhofft hatte. Da hatte er sich getäuscht. Und das Mädchen war an der nächsten Station ausgestiegen. Diesmal ließ er den Anderen den Vortritt, nickte zu ihren Verabschiedungen und blieb in Gedanken verfangen sitzen, als ginge die Fahrt für ihn allein weiter. Sein Reisegeld, Vorschuss auf einen ungeschriebenen Roman, war längst aufgebraucht, und als Erstes, dachte er, würde er nachsehen müssen, ob auf der Post schon der nächste Wechsel seines Bruders Michail lag. Der deutsche Ehemann kam noch einmal zurück, vom Korridor aus krähte er durch die offene Tür: „Ich weiß, warum die Sonne dort so früh aufgeht.“ Er machte eine kleine Kunstpause und sagte belehrend: „Weil es so weit östlich liegt.“
„Ja“, gab der Russe zur Antwort und schaute ernst zu Boden. Womit der einzige Dialog seiner Bahnfahrt zu Ende war.
Italien kannte er bislang nur aus Zügen und Equipagen heraus. In Florenz hatte er sich schlecht gefühlt und war wenig ausgegangen, außerdem war es regnerisch und seltsam kühl gewesen. Sodass ihm nun, als er aus dem Bahnhof Santa Lucia auf den Vorplatz trat, zum ersten Mal in seinem Leben die volle Glut eines mediterranen Sommertags entgegenschlug. Und die war anders als jede andere bisher, ein weiches, freundliches Meer, in das man eintauchte, ein alle Sinne vereinnahmendes Spektakel aus Farben und Licht, Stimmen und Bewegung, als wäre man in ein zum Leben erwecktes Gemälde getreten und zum ersten Mal nicht mehr dessen Betrachter, sondern Akteur. Und wie es den Augen war, als hätte man ihnen einen Schleier abgenommen, schienen die Ohren von Pelzklappen befreit und wunderten sich über die Symphonie von Rufen, Reden, Singen und Schreien in einem Dutzend von Sprachen, aus denen das Italienische herausklang und -schmetterte wie eine fröhliche Trompetenmelodie aus aufgeregtem Orchesteraccompagnement.
Noch hatte der Angekommene keinen Faden der Anknüpfung an dieses bunte Gewebe gefunden und stand starr in der um ihn wehenden, ihn schubsenden Menge von Händlern, Wasserträgern, Reisenden und spielenden, herumlaufenden Kindern, hielt den Griff seines Koffers fest umklammert, schaute mit schmalem Blick auf den breiten Kanal, der sich um den Bahnhofsvorplatz schlängelte und Boote mit roten und schwarzen Segeln auf seinem unverschämt leuchtenden Blau trug, und fühlte sich so schwach, dass er am liebsten umgekehrt und in irgendeinen Zug gestiegen wäre, Hauptsache weg. Richtungslos, nur, um einen Anfang zu machen, bewegte er sich ein paar Schritte nach links, wo ihm ein Lokal in den Blick kam, das scharenweise Menschen ausspuckte und einsog und ihm seinen dringenden Wunsch nach etwas zu trinken erfüllen würde. An einen Laternenmast vor dem Lokal gelehnt, stand ein kleiner Mann mit kugeligem Bauch, in dem zwei Arme und Beine steckten, und kugelrundem kahlen Kopf, aus dem zwei lebendige, feurige Augen blitzten.
„Ciao!“ , rief er, und der auf ihn Zugehende drehte sich halb um, um den Freund hinter sich zu sehen, der offenbar mit diesem Ruf begrüßt wurde, doch da war niemand, „Ciao!“ kam es dafür noch einmal und nun ganz unzweifelhaft auf ihn hin und schon sprang der Fremde mit einem „Benvenuto a Venezia!“ auf ihn zu und griff nach seinem Koffer. Vor Diebstählen in Italien mehrfach gewarnt, legte Dostojewskij auch die zweite Hand um den Griff und sah den Angreifer finster an, als wollte er ihn kraft seines Blicks in die Flucht schlagen. Doch der hob beide Arme weit über die Schultern und gab mit dieser Gebärde und einem lauten Ausbruch von Vokalen, die aus seinem Mund quollen, seiner guten Absicht Ausdruck. Die Suada kam offensichtlich mit einer Frage zu Ende, der ein Schulterzucken folgte. „Indirizzo“ , wollte der Kugelmensch wissen und „Albergo“ , und der Russe, der sicher war, dass der Andere Geld forderte, sah sich betreten um. „Address“ , verstand er nun endlich, und zugleich, dass der Kleine ihm den Koffer tragen und ihn führen wollte. Er zeigte ihm einen Zettel, auf dem Name und Anschrift des Hotels geschrieben standen. Das ermutigte den Fremden zu einer neuen Koloraturarie von Vokalen, mit der er den Reisenden so verblüffte, dass er ihm geschwind den Koffer aus den Händen nehmen konnte und schon, heftig mit dem freien Arm bedeutend, ihm nachzukommen, davonlief. Der vielleicht nicht Ältere, aber ungleich Schwerfälligere, der zudem von der Reise ganz steife Beine hatte, protestierte und sah doch keine andere Möglichkeit, als dem flinken neuen Besitzer seines Koffers nachzugehen. Da blieb der unvermittelt stehen und drehte sich um.
„Scusate, Signore“ , sagte er und verneigte sich leicht, „sono Pepi.“
„Pepi?“ Da erhellte sich das blasse, bis dahin ausdruckslose Gesicht, auf dem die Sonne zuvor unsichtbare Sommersprossen aufblühen hatte lassen, und die grauen, tief liegenden Augen bekamen einen seltsamen weichen Glanz.
„Beppo!“ , rief er nun fast, und der Andere, wie um nicht kleinlich zu sein und seine gute Laune nicht zu verlieren, stieß lachend und schulterwerfend aus „Pepi … Beppo …“ – und erklärte sich mit der Namensveränderung einverstanden.
„E lei?“ , zeigte er auf den Herrn.
„Je m’appelle Dostojewskij.“
Beppo/Pepi schickte mit den Augen ein Stoßgebet zum Himmel und sagte etwas, das wahrscheinlich „Das merke ich mir nie“ hieß, lachte wieder herzlich und setzte seinen Weg fort.
Dostojewskij warf einen Blick auf das Lokal, in dem er Menschen mit Getränken sitzen sah, doch da lief sein Kofferträger schon über die ersten Stufen der Steinbrücke über den Kanal. – Beppo! Dostojewskij schüttelte den Kopf. Dieses Sinnbild seiner venezianischen Sehnsucht, der Name des Byron’schen Gedichts, das ihm die ersten Phantasiebilder seiner jugendlichen Schwärmerei eingegeben hatte, hier war es Fleisch und Blut, sprang ihm auf den ersten Metern vor die Füße, trug sein Gepäck, wurde sein Cicerone … die „Steine aus ‚Beppo‘“ hatte er, so lange er denken konnte, zu sehen, zu berühren begehrt, und folgte nun einem leibhaftigen Nachfahren dieser literarischen Erfindung auf Stufen aus Stein, die sicher auch Byron betreten hatte.
Читать дальше