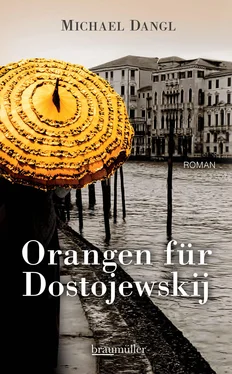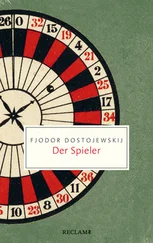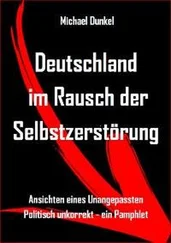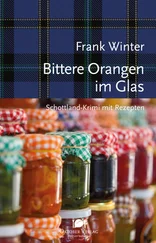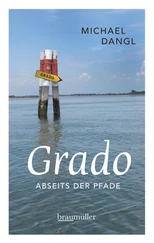Im Sitzen, im Dunkeln, im Kühleren war es in ihm friedlicher geworden. Und bei den ersten Schlucken Bier. Das musste er sich für seinen Roman – dessen Pläne er schon lange in sich trug und für die er auf seiner Reise nichts zustande gebracht hatte als Skizzen –, für den Roman „Die Trinker“ merken: Im ersten Schluck lag’s. Bis dahin hatte jeder, auch der gewohnheitsmäßigste Trinker, immer wieder eine Chance. Danach nicht mehr. Der erste Schluck Bier, Wein, Wodka verwandelte dich und zog dich in seine Macht. Als das Glas leer war, befiel ihn bleierne Müdigkeit und eine unangenehme Mischung aus Hunger und schlechter Laune. Was hatte diese Herumreiserei für einen Sinn? Was tat er in dieser lauten, unübersichtlichen Stadt? Die Woche in Florenz war er die ganze Zeit in einer Lesehalle gesessen und hatte russische Zeitungen studiert. War die Lesehalle zu, hatte er sich in seine Pension, eine muffige Absteige mit dem prätentiösen Namen „Suisse“, gesetzt und „Les Misérables“ gelesen. Eine literarische Neuerscheinung, die ihm gefiel, weil sie ihn an seine eigenen „Erniedrigten und Beleidigten“ erinnerte. Dessen Honorar längst aufgezehrt war. Strachow, ein Freund, den er in Genf getroffen und der ihn nach Florenz begleitet hatte, war im Duomo gewesen, auf dem Ponte Vecchio, in den Boboli-Gärten, beim Abendtee hatte er davon erzählt und nur einmal Dostojewskij in die Uffizien geschleppt, ein in dessen Augen unfassbar hässliches Gebäude, mehr Amt als Museum, er war davongelaufen, noch bevor sie zur Venus von Medici gekommen waren. Danach hatten sie auf der Piazza della Signoria Eis gegessen und gestritten.
„Du bist ein schlechter Reiser“, (Strachow) „dich interessieren weder die Natur – als wir an den Schweizer Seen vorbeigefahren sind, hast du nicht einmal aus dem Zugfenster geschaut –, noch historische Sehenswürdigkeiten, noch Kunstwerke.“
„Vielleicht.“ (Dostojewskij.) „Mein Interesse geht im Wesentlichen auf den Menschen. Was gibt es Faszinierenderes? Was Widersprüchlicheres?“
Im selben Moment war ein Buckliger an ihrem Tisch vorbeigegangen, und Strachow hatte gelacht, und Dostojewskij war böse geworden und hatte Strachow angeschrien, dass er ihn nicht ernst nähme, außerdem sei das Eis ihm zu kalt und er ziehe es vor, ins Hotel zu gehen und „Les Misérables“ zu lesen. Jetzt war er froh, wieder allein zu sein. Strachow war wohl schon in Russland. Der hatte es gut.
Beppo und die zwei Hünen hielten in ihrem „Gespräch“ – das daraus bestand, dass sie einander in bester Laune anschrien – inne und prosteten vom Tresen her dem stummen Gast zu, der aber betreten zu Boden sah. Schon immer, selbst in seinen ausgelassensten Stunden, war es ihm unangenehm gewesen, wenn Gläser gegen ihn gehalten wurden, und auch er selbst führte die Bewegung ungern aus. Welche Gottheit wurde da hochgehalten und hofiert? Und auch in der katholischen Kirche, wenn der Priester den Kelch hob, um das „Blut Christi“ zu preisen – und damit sozusagen seiner Gemeinde zuprostete –, empfand Dostojewskij das als verunglücktes Ritual, eine peinliche Äußerlichkeit eines im Wesen tieferen Gedankens.
Am Kirchenvorplatz schoss ihm das Bier aus allen Poren. Zum Glück bogen sie jetzt in schattige und gleich erfrischend kühlere Gassen ein. Aus den Häusern hörte man das Klappern von Geschirr, Fetzen von Tischgesprächen, Babyweinen, Lieder, gesungen von Frauen aus wer weiß welcher Freude, wer weiß welcher Not. Auf der Anhöhe einer der unzähligen Brücken war es dann, dass ihm auf einmal Salzluft in die Nase stieg, vom Wind hergetragen aus der Lagune oder vom Meer. Das Meer hatte er in Europa zweimal, auf der Überfahrt nach und von England kennengelernt. Doch wie hier der Salz- und Tanggeruch in die Stadt wehte, das kannte er nur von einem Ort: von Sankt Petersburg. Je näher sie nun ihrem Ziel und damit dem Wasser kamen, desto mehr stieg ihm dieser Duft nicht nur in die Nase, sondern ins Gemüt und schürte, zugleich mit dem tieferen Eintauchen ins Venezianische, Fremde, mehr als je zuvor in den zwei Monaten seiner Reise die Sehnsucht nach Zuhause.
Das Hotel Belle Arti war ein eleganter Palazzo mit Garten, und sofort ärgerte sich Dostojewskij, dass ihn seine Pariser Bekannten, die er um Empfehlung für ein „günstiges Quartier“ in Venedig gebeten hatte, hierher schickten. Doch der Rezeptionist erklärte ihm in schlechtem Französisch, dass sich seine Reservierung auf das „andere Gebäude“ beziehe, und das hieß auf ein schlichtes Wohnhaus auf der anderen Straßenseite, wo das Hotel einfachere Zimmer vermietete. Den Schlüssel händigte er ihm mit den Worten aus: „Benvenuto, Signor Dostojewitsch!“ Dieser korrigierte sachlich und fragte nach dem Postamt, der Beschreibung hörte er nach dem sechsten à gauche und à droite zu folgen auf, außerdem winkte Beppo, der mit dem Koffer an der Tür zwischen Garten und Foyer wartete, heftig fuchtelnd ab, was heißen sollte, er würde ihn hinführen. Die Frage nach einer „Lesehalle“ fiel auf Unverständnis, die Umschreibung „wo man hier Zeitungen lesen“ könne, beantwortete der Portier mit einem verlegenen Deuten auf ein Fauteuil. Beppo ließ es sich nicht nehmen, den Koffer auch über die Straße und in den ersten Stock zu tragen. Als er ihn abgestellt hatte, sich den Schweiß von der Stirn wischte und anfing, sich im schlichten, doch praktikabel eingerichteten Zimmer umzusehen, fand Dostojewskij, dass es Zeit zum Abschied wäre. Mit der Bezahlung des Weins vorhin war es nicht getan, aber mit der venezianischen Währung, die er in Mailand eingetauscht hatte, kannte er sich nicht aus, sodass er ihm nur zu wenig oder zu viel geben konnte, und Protest gäbe es wahrscheinlich nur im ersten Fall. Er zog die erstbeste Münze aus der Tasche und hielt sie ihm hin. Beppos Gesicht lief rot an, er streckte beide Arme von sich und stieß aus: „Ma no!“ – Natürlich, zu wenig. „Ma è uno Svanzica!“ , rief Beppo und zeigte auf Dostojewskijs Hosentasche. Der holte alle Münzen heraus und präsentierte sie in der flachen Hand. Beppo stocherte darin herum und pickte sich die zwei, drei heraus, die ihm für seine Dienste angemessen schienen, wies noch einmal auf die erste Münze und sagte lachend und mit drohendem Finger: „Ma non uno Svanzica!“ Ging zur Tür und statt hinauszugehen, hielt er sie mit einer leichten Verbeugung auf: „Alla Posta?“
Der Gedanke, dem unermüdlichen Spaßvogel, der ohne Koffer sicher noch schneller wäre, gleich wieder hinterherzulaufen, war dem erschöpften Reisenden unerträglich und er schickte ihn mit einem „plus tard“ eilig weg. „Plus tard“ , wiederholte Beppo, „va ben.“ Und bevor die Tür hinter ihm im Schloss war, machte er sie noch einmal einen Spalt weit auf, steckte seinen Kopf durch und sang: „Ah che più tardi ancor?“ , opernhaft klang es, als wäre er ein ganzer Chor, und fügte hinzu: „In Italiano: più tardi. Plus tard – più tardi.“ Und mit einem breiten Lachen beendete er seinen Auftritt, doch hörte man ihn noch lange singen, „Ah che più tardi ancor“ – am Korridor, die Stiegen hinab, bis er aus der Haustür war.
Dostojewskij ging zum einzigen Fenster an der Längsseite des Bettes. Es stand halb offen, und als er es ganz öffnete, überflutete ihn eine Welle heißer Luft. Er sah in einen begrünten Innenhof mit Palmen, Olivenbäumen und einem kleinen Gemüse- und Kräutergarten. Nach der Hektik der letzten Stunden tat die Stille gut. Nur zwei Tauben scharrten auf einem Fensterbrett und gurrten ihr internationales Lied. Die Fenster der anderen den Hof umfassenden Häuser trugen die Zeichen gewöhnlicher Wohnungen: Blumen, an einem eine Katze, Wäscheleinen. In Petersburg hatte der Dichter stets in Eckhäusern gewohnt. Warum, wusste er nicht. Auf jeden Fall waren sie an Straßenkreuzungen und mehr oder weniger laut. Auf der Reise hatte er mit blindem Geschick sowieso die lautesten Zimmer bezogen. In Paris ausgerechnet über einer Schmiede. Um vier Uhr früh, als er sich nach qualvollen Stunden über seinen Skizzen ins Bett legte, fingen sie unten gerade an, an einem Rad zu hämmern. In Dresden wurde die ganze Zeit die Fahrbahn gepflastert, ab fünf war an Schlaf nicht mehr zu denken gewesen. Ein wenig verunsichert sah sich Dostojewskij um, von wo hier Störungen zu erwarten waren. Er fand nichts. Seufzend ging er zu seinem Koffer. Das Schloss war verbogen, und erst nach langem Hantieren brachte er ihn auf. Ordentlich verteilte er seine Sachen im Raum: Das frische Tageshemd und den zweiten Rock hängte er in den Schrank, die Zugstiefel stellte er daneben, Wäsche, Handschuhe und Halstücher kamen in die Schubladen, das Nachthemd legte er aufs Bett, Papiere, Federn, Tinte, Aschenbecher und sein Zigarettenetui hatten ihren Platz auf dem Schreibtisch, die Bibel legte er auf die Kommode, die Flasche Emserwasser stellte er daneben. Dann entnahm er dem Koffer die Kleiderbürste, zog den Rock aus, entstaubte ihn gründlich und hängte ihn auf. Drehte den Schlüssel zweimal in der Tür und stellte sich wieder ans Fenster. In den wenigen Minuten war die Sonne so über das Dach gewandert, dass sie jetzt einen Teil des Kräutergartens beschien. Der Ausblick erinnerte ihn an die Kindheitswohnung in Moskau. Vom Vorraum weg hatte es da einen Korridor mit Fenster zum Hinterhof gegeben. Im hinteren Teil des Ganges, abgetrennt durch eine Bretterwand, lag das finstere Kinderzimmer. Eng und arm hatten sie gelebt in der Dienstwohnung des Marienspitals, wo der Vater als Arzt angestellt gewesen war. Der niedere Adel, der Familie seit dreihundert Jahren von Vaterseite inne, hatte nur mehr auf dem Papier existiert. Und in den Genen vielleicht. Ihn schwindelte und er gab dem leichten Druck, den er vom Bett in den Kniekehlen spürte, nach und setzte sich. Nun musste er sich strecken, um über das Fensterbrett hinunter in den Hof zu sehen. Eng sollte der Held seines neuen Romans leben, eng und dunkel, wie in einem Sarg, dachte er. Er sah zum Schreibtisch und überlegte, sich an die Arbeit zu setzen. Doch da überkam ihn die Müdigkeit erst recht, und in einer wie ihn selbst überrumpelnden schnellen Bewegung legte er die Beine auf das Bett und den Kopf auf das Kissen. Er wollte nicht schlafen, nur ruhen und nachdenken. Sommer musste sein, am Beginn des Romans, ein schwüler, drückender Sommerabend, an dem der Student, um den es ginge, ziellos durch die Gassen und über die Brücken Petersburgs wandert. Oder die Venedigs? Warum nicht. Den „venezianischen Roman“ zu schreiben, hatte er schon mit fünfzehn vorgehabt.
Читать дальше