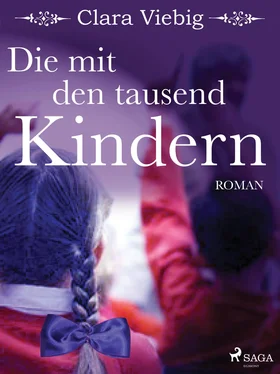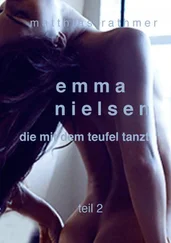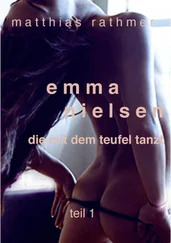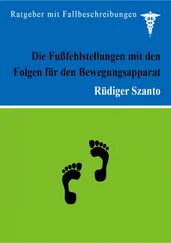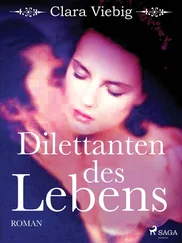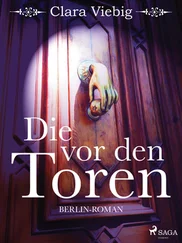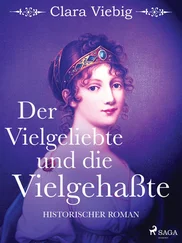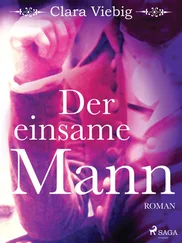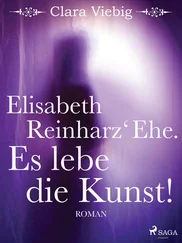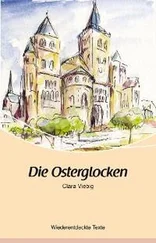»Und dann,« fuhr Fräulein Ebertz fort, »müssen wir Volksschullehrerinnen, in Gesamtheit geschlossen, zeigen, wer wir sind. Was wäre denn unser Volk, unser Schulwesen ohne uns? Einpacken könnten sie!« Sie schlug sich auf die flache Brust: »Wir, wir sind die Wurzel, durch die der Baum Nahrung saugt und Kraft bekommt. Herrje, und da bilden die an den höheren Lehranstalten sich ein, sie könnten auf uns herabsehen?! Gucken Sie sich mal so ’ne Oberlehrerin an, die auf der Universität ihre Semester hinter sich hat, wie’s jetzt Mode ist — schon so ’n kleines Fräulein Studienreferendar trägt uns gegenüber die Nase hoch — Josef mit ’m bunten Rock, der dünkte sich auch mehr als seine Brüder. Ich hätte ja auch studieren können, Sie auch, wir alle, wenn wir’s Geld dazu gehabt hätten. Keine von uns ist dümmer als die. Aber, wissen Sie, –« und sie nahm, wieder ruhig geworden, den Arm der jüngeren Kollegin — »Gott sei Dank, bloss aufs Studierthaben kommt es nicht an in der Schule; auf das am wenigsten!«
Für die Volksschule sicherlich nicht. Über Marie-Luises Gesicht war ein Schatten geflogen: sollte es wirklich so sein, wie Fräulein Ebertz sagte, gab es Missgünstigkeit bei den Lehrern gegen die Lehrerinnen, und eine vielleicht noch grössere Missgünstigkeit bei der Volksschullehrerin gegen die Lehrerin der höheren Schule? Sie sah in ihr eigenes Innere: ehrlich, wie sah’s da aus?! Sie senkte nachdenklich den Blick: ja, sie hätte lieber an einem Mädchenlyzeum unterrichtet als hier an der Gemeindeschule im proletarischen Osten. Es könnte ihr das auch gelingen, wenn sie nebenher noch weiter arbeiten würde, Sprachen trieb und Vorlesungen hörte, sie würde es erreichen, wenn sie das durchaus erreichen wollte, aber — und jetzt nickte sie der anderen lächelnd zu — »wir sind die Wurzel, durch die der Baum Nahrung saugt und Kraft zieht«. Ein Gefühl, das fern jeder Eitelkeit, aber nicht fern von Stolz war, stieg in ihr auf: ‚ich bin nun einmal Volksschullehrerin, ich bleibe es auch, und ich bleibe es gern.‘ Hier waren Kinder, so viele Kinder, unendlich viel mehr Kinder, als es Kinder in höheren Ständen gibt, Kinder, die das Volk ausmachen, das Deutschland, das wieder gross werden soll und auch wieder gross werden wird in der Welt, wenn diese Kinder, Früchte des Baumes, der in der Volksschule wurzelt, so erzogen werden, wie sie erzogen werden müssen. Oh, hier lag eine Aufgabe, eine weit grössere, eine weit lohnendere als jede andere! Wenn diese kleinen Mädchen mit den Strubelköpfen und Hängezöpfchen, einst Frauen, Mütter waren, musste man ihnen so viel mitgegeben haben, dass sie fest in ihren Schuhen standen, Kraft genug in sich hatten, dem Mann eine stützende Hand zu reichen. Und dass sie die Fähigkeit besassen, selber ihre Kinder so zu erziehen, wie sie erzogen werden mussten.
»Ich werde dem Verband der Volksschullehrerinnen selbstverständlich beitreten,« sagte Marie-Luise, wie um Entschuldigung bittend. »Es war eine grosse Gedankenlosigkeit von mir, das nicht gleich zu tun.«
Melitta Ebertz nickte versöhnt: »Na ja, das ist ja auch für Sie selber von Vorteil. Alle für eine — man ist durch den Verband persönlich sehr gestützt. Unsere Zentrale berät uns jederzeit und tritt für uns ein: Ruhegehalt und so weiter. Und Abfindungssumme bei ’ner Heirat — na?!« Sie blinzelte dabei.
Hatte Fräulein Ebertz etwa noch vor, sich zu verheiraten? Marie-Luise lachte auf einmal hell auf.
»Was lachen Sie denn?« sagte die Ältere ärgerlich. »Ich denke ja an so was nicht mehr, aber Sie — für Sie kommt doch so was noch in Betracht.«
»Ich würde meinen Beruf nicht aufgeben,« sagte Marie-Luise rasch. »Ich heirate nicht.«
»Na, na!« Fräulein Ebertz lächelte.
Und dieses Lächeln erboste Marie-Luise fast: musste denn doch eine Heirat so gewissermassen als Schlussstein des Lebens gesetzt werden, das man sich erbaut hatte? — – –
Mit Spannung sah Marie-Luise heute dem Vortrag entgegen. Ein öder Saal; vorn im Haus waren Restaurationsräume, warm und hell erleuchtet, man hatte durch sie hindurchgehen und dann über einen düsteren Hof tappen müssen. Es war schlechtes Wetter; Frau Professor hatte lamentiert, dass die Tochter sich noch einmal zur Stadt aufmachte: »Solch ein Unsinn! Das lohnt doch sicher nicht. Hast du auch Überschuhe an? Und ich sitze wieder allein, immer allein — es ist wirklich grässlich!«
Die Mutter tat Marie-Luise leid. In dem Kuss, den sie ihr rasch auf die Stirn drückte, lag es wie eine Bitte um Entschuldigung, aber sie hatte es ja der Kollegin fest versprochen, und das Thema des Vortrages interessierte sie auch: »Bekenntnisschule oder Weltanschauungsschule« — warum das »Oder?« Der bekannte Schulmann, der diesen Vortrag zu halten versprochen hatte, sollte ein ausgezeichneter Redner sein — wie würde er das »Oder« begründen? Müsste es eigentlich nicht heissen: »Bekenntnisschule und Weltanschauungsschule?« Jedes Bekenntnis war doch Weltanschauung. Das hatte sie heute morgen auch dem Fräulein Ebertz gesagt, aber die hatte sie ganz verwundert angesehen: »Na, kümmern Sie sich denn um gar nichts? Es ist doch so viel die Rede davon. Jede Eltern können verlangen, dass ihr Kind nur katholisch unterrichtet wird oder nur protestantisch, und wenn es man bloss vierzig katholische Kinder an einem Ort gibt oder vierzig evangelische, oder noch weniger, eine eigene Schule müssen die kriegen. Das nennt sich dann Bekenntnisschule. Weltanschauungsschulen, die haben nichts mit Religion zu tun.«
»So,« hatte Marie-Luise kurz gesagt. Und das Bild ihres Vaters stieg plötzlich vor ihr auf. Wie warm hatte er sie an seiner Brust gehalten, wie hatten seine Augen geleuchtet, als sie auf seinen Knien sass, und er ihr von dem Geist Gottes sprach, der in uns wohnt, der all unsere Gedanken kennt und dem Kinde helfen will, böse Gedanken zu überwinden, damit es gut wird. Gut sein, gut, das ist alles. Ein guter Mensch — das höchste Ziel für alle! Er hatte nie von »Bekenntnissen« gesprochen. Ach, ihr Vater, der wäre sicher nicht damit einverstanden: »Bekenntnisschule oder Weltanschauungsschule«.
Freilich, leicht war es nicht, Kindern, so jungen Menschen, den Geist, den man Gott nennt, nahezubringen. Aber dafür war man ja auch ein Lehrer, zum Lehren geschaffen. Marie-Luise erinnerte sich immer noch mit Entzücken an ihre allerersten biblischen Einführungen. Alle Wunder des Morgenlandes hatte der Vater in der Dämmerstunde, als sie auf seinen Knien sass, vor ihr ausgebreitet. Sie wunderten mitsammen im Garten des Paradieses, sie hörten die Stimme Gottes: »Adam, wo bist du?« — Sie sahen die ersten Menschen, ausgetrieben vom Engel mit dem flammenden Schwert, sich mühend auf dem Acker voll Dornen und Disteln. Sie sahen den hochsteigenden Opferrauch des guten Abel und den bösen Kain, auf dessen Stirn Gott das Zeichen des Mörders eingebrannt hatte, sahen die Sintflut alles verschlingen und nur die Arche des Noah treiben, in die dann die Taube das Zweiglein des Ölbaumes brachte — der Regenbogen stand leuchtend, als Zeichen der Versöhnung von Himmel und Erde. Sie sahen den kleinen Moses im Schilf des Nil, sahen ihn dann die Kinder Israel durch die Wüste führen, sahen Josua und Kaleb, die Riesentraube heranschleppen aus dem gelobten Land, sahen den Riesen Goliath und den Hirten David mit seiner Schleuder, sahen den Knaben Absalom an den Haaren im Baume hängen und den König Salomon in all seiner Herrlichkeit. Märchen, wundersame Märchen, aber voll von Symbolen und wunderbaren Erziehungsmöglichkeiten.
Und so wie Marie-Luise damals gelauscht hatte, lauschten ihr jetzt ihre Kleinen in der Klasse. Nun gerade, zur nahenden weihnachtlichen Zeit, erzählte sie ihnen von dem Stern, der am Himmel aufzieht und mit langem strahlendem Schweif wie mit einem Finger nach Bethlehem weist. Alle Leute laufen dahin, junge und alte, arme und reiche, Hirten und Könige. Und im niederen Stall, in der armen Krippe bei Öchslein und Esel, da liegt das Kind, ein König, mächtiger als alle Könige je auf Erden: das Christkind. Und es winkt: »Ihr Kinderlein kommet!«
Читать дальше