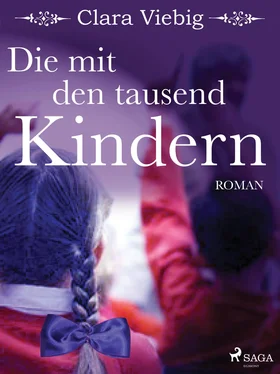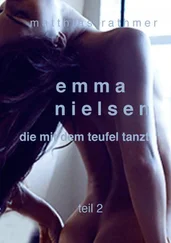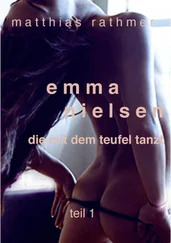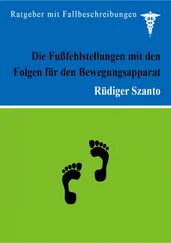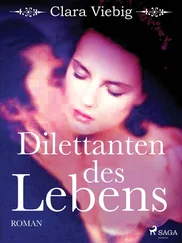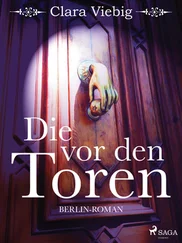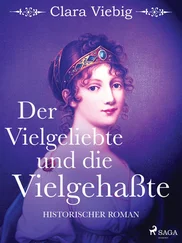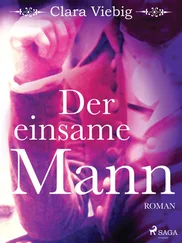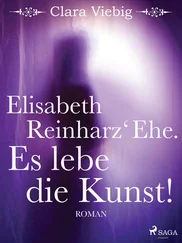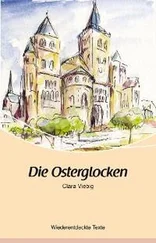So war es zur Übersiedelung nach Berlin gekommen. Mathilde Büchner hatte die sorglosesten Tage ihres Lebens und die ihr auch am meisten ‚konformen‘, wie sie sagte, in Berlin gehabt, damals, als sie bei einer Tante und einer gleichaltrigen Cousine dort zu Besuch gewesen war. Nun hoffte sie wieder auf solche Tage. Aber sie vergass, dass die Tante tot war, die Cousine verheiratet und gleich ihr alt geworden, und auch, dass Leute, die einstmals Vermögen hatten, jetzt keines mehr haben. Die Cousine nahm sie trotzdem freundlich auf; sie besass von alledem, was sie einst besessen hatte, nur noch ein Haus in einem westlichen Vorort, ziemlich weit ab, und darin trat sie den Büchners nun eine kleine Wohnung ab.
Die beiden Zimmer waren angenehm, auch geräumig, und schauten aus hellen Fenstern hinab in lauter Gärten. Die Küche teilten sie mit den Glässners, das war weniger angenehm, denn Herr Glässner war abgebaut und stand immer bei seiner Frau in der Küche herum. »Aber, Mutter, du brauchst doch nicht so oft in die Küche, was haben wir denn gross zu kochen,« sagte Marie-Luise. Sie war damit zufrieden, dass für sie ein Schlafsofa im Esszimmer stand, überliess der Mutter gern das andere Zimmer ganz allein. Auch die Entfernung von Berlin kam für sie weiter nicht in Betracht. Vorerst konnte sie sich ja die Stunden, in denen sie hospitierte — bald an einer Schule in Tempelhof, bald in Charlottenburg, bald in Schöneberg, auch am Wedding, oder im äussersten Osten — so wählen, dass sie nicht schon vor sieben Uhr morgens von Hause fort musste. Auch als sie Vorleserin bei einer erblindeten alten Dame geworden war, der sie täglich zwei Zeitungen von der ersten Zeile bis zur letzten — Politik, Roman, Feuilleton, Kunst- und Börsenberichte, Boxkämpfe, Heiratsanzeigen, Todesnachrichten und Ausverkäufe — vorlesen musste, störte ihr weiter Weg sie nicht. Auch dann nicht, als sie zwei Jahre lang bei einem Schriftsteller nach Diktat in die Maschine schrieb.
Jetzt freilich musste sie sehr früh am Morgen zur Fahrt nach Berlin aufbrechen. Aber es war Frühling, wurde dann Sommer — was störte sie in diesem ersten Halbjahr der weite Schulweg? Oh, wie die Vögel anstimmten! Es piepte, es zirpte, es flatterte ohne Scheu dicht vor ihr her; die Amsel bohrte den gelben Schnabel ins Rasenbankett, der Fink schwang sich auf den untersten Zweig der Baumreihe — ein Fliegen, ein Wiegen, ein Hin- und Herwippen. Marie-Luise kannte all diese Vögel kaum, sie hätte auch nicht zu sagen vermocht, wer von ihnen jetzt sang, so vielstimmig war das Konzert. Trillern, Flöten, Locken. Wenn sie nicht gedacht hätte, es könnten jetzt doch Menschen kommen, so hätte sie auch gesungen, oder auch nur einen Ruf ausgestossen, einen einzigen kurzen, hellen Schrei. In ihr war Jubel, noch nie hatte sie sich so jung gefühlt. Ihre Jahre, ah, die drückten sie nicht, sie fühlte sich so frisch, so jung, als hätte sie erst gestern das Examen bestanden. Die Jahre, die danach gekommen waren, die waren jetzt weggewischt, sie stand wieder am Anfang, voller Hoffnungen, voller Pläne, voller Eifer, voller Hingabe an ihren Beruf. Herrgott, was stellte der für Aufgaben! Aber sie fühlte sich jedem Anspruch gewachsen. Und die Kinder hingen an ihr, das fühlte sie auch, und das machte sie glücklich. Ein Gefühl, ein Wunsch, das Herz herauszutun, ihr Innerstes, ihr Bestes ihnen zu geben, überwallte sie. Es waren nicht ihre Kinder, und doch war es einem so natürlich, dass man immer sprach: meine Kinder.
Wie konnte der Rektor nur sagen: »Recht gut, Fräulein Büchner, aber ruhig, ein bisschen ruhiger. Sie treiben sonst Raubbau mit Ihren Kräften« –? Und wie komisch von Fräulein Ebertz, der Kollegin, die nebenan die Parallelklasse hatte, zu ihr zu sagen: » So ein Unterrichten, wie Sie es tun, das hält keine aus. Die Ernst, die Sie jetzt vertreten, die machte es auch so wie Sie — und was hat sie davon? Kinder sind ja undankbar, die haben sie gleich vergessen. Nun ist sie erst mal für ein Jahr beurlaubt — nein, nein, Fräulein Büchner, erschrecken Sie nicht« — Marie-Luise musste eine unwillkürliche Bewegung gemacht haben — »die werden Sie noch lange vertreten können, die kann nicht mehr!«
»Was fehlt ihr denn eigentlich?« hatte Marie-Luise kleinlaut gefragt; sie kam sich sehr egoistisch, ganz schlecht vor, dass ihr bei dem Gedanken, dass Fräulein Ernst bald wiederkommen könnte, alles Blut vom Herzen wich und zu Kopf stieg.
»Was ihr fehlt? Na, was uns allen mehr oder weniger fehlt: die guten Nerven. Bei ihr kam’s nur etwas früh. Ich bin schon fünfunddreissig Jahre im Amt, und, Gott sei Dank, bei mir geht’s noch immer, weil ich’s ruhiger nehme. Ich unterrichte noch so ziemlich nach der alten Methode. Wenn ich ein Gedicht aufsagen lasse, sagt es erst eine auf, und dann die andere — alle der Reihe nach — ich verteile keine Rollen wie auf dem Theater. Dann gibt’s auch kein Hallo und keine Unruhe. Sie sind auch so neumodisch — Gedicht aufsagen mit Gesten, mit Hüpfen und Herumtanzen womöglich, Gott bewahr mich! Da zieht man nur schlechte Schauspieler heran. Na, Sie werden ja auch schon noch klug werden. Und wie die Ernst sich aufregte, wenn mal ein Kind einem andern ein Bildchen wegnahm oder ein Zopfband! Lieber Gott, so was kommt eben vor, es sind doch noch unvernünftige Kinder. Und wenn ein unverschämter Kerl von Vater oder eine dämliche Mutter kam und sich beklagte, ihrer Ilse, Hilde oder Annemarie wäre Unrecht geschehen, denn die lögen niemals, was meinen Sie wohl, was die Ernst sich dann auf lange Auseinandersetzungen einliess! Zuletzt war sie so fertig, dass sie mitten in der Stunde anfing zu weinen. Bei mir kommt keiner ran, ich schliesse einfach meine Klassentür zu, bin nicht zu sprechen.«
Diese Kollegin war Marie-Luise nicht sehr sympathisch. Aber das schien nicht gegenseitig der Fall zu sein. Fräulein Ebertz legte der jungen Kollegin die Hand auf die Schulter, in ihr ältliches, sehr alltägliches Gesicht mit der straff zurückgekämmten unkleidsamen Frisur kam ein freundliches, es plötzlich viel angenehmer machendes Lächeln: »Sie müssen es mir nicht übelnehmen, Fräulein Büchner, nicht denken: was geht die das an? Fünfunddreissig Jahre sind lang, ich habe schon manch eine kommen sehen, aber auch manch eine gehen. Es tut mir direkt leid um Sie, wenn ich Sie morgens so anhetzen sehe in der letzten Minute, oder wenn Sie mittags bei der Hitze sich in die Elektrische quetschen und die weite Fahrt — mein Gott, was für ’n Ende! — bis nach Hause fahren. Ziehen Sie nach Berlin, näher zur Schule, ich meine es gut mit Ihnen.«
Was, in die Stadt ziehen, dazu noch näher zur Schule?! In eine dieser Strassen des Ostens, die nur zu ertragen war, wenn man nicht in ihr wohnte! Marie-Luise lachte fast, wenn sie am Morgen ihren Weg zur Bahn machte und zufällig ein Gedanke sich zu Fräulein Ebertz verirrte. Was wusste die von Vogelgesang, von Frühlingsgrün, von der Natur überhaupt und von Frische?! Eine gutmütige Seele und auch gar nicht dumm, aber doch schon recht verschrumpft, eingetrocknet in ihrem Beruf, mechanisch darin geworden, eine Maschine.
Fräulein Ebertz hatte die Aufnahmeklasse, die Kleinen im ersten Jahr. Die gab sie dann weiter und bekam wiederum die Kleinen im ersten Jahr. Und so immer dasselbe, immer die ersten Anfänge, immer wieder diese kleinen Geschöpfe, die noch vor dem Abc erst einmal lernen mussten, dass man nicht aus der Bank herauslaufen und nach Hause gehn darf, wenn man keine Lust mehr hat, in der Schule zu bleiben, dass man aufpassen muss, wenn die Lehrerin spricht, dass man die Nachbarin nicht heimlich zwicken darf und sich auch nicht in der Nase bohren.
Marie-Luise lächelte in sich hinein: ja, es war manches recht komisch. Diese Anfänge hatte sie ja auch durchgemacht, hatte sich auf die Lippen beissen müssen, um nicht laut herauszulachen, wenn die kleine Irma mit den Rattenschwänzchen erzählte: »Mein Vati is Frisör, der ondoliert mir an ’n Sonntag.« Lieber Gott, die paar Härchen! Verlegenes kam im Anfang auch genug vor, da hatte manchmal eine Kleine zu spät angesagt: »Fräulein, ich muss mal austreten.« Nun, so etwas hatte sie ja jetzt bereits hinter sich; sie würde die Aufnahmeklasse auch nicht lange behalten, nächsten Ostern ging sie mit ihren Kindern weiter, stieg mit ihnen in die folgende Klasse hinauf, das hatte ihr der Rektor zugesagt. Aber Fräulein Ebertz — o Gott, wenn sie denken sollte, immer und immer nur die ersten Anfänge! Aber die wollte nichts anderes; es war deren Spezialität, die ganz Kleinen — eine Domäne, die sie gepachtet hatte. Fünfunddreissig Jahre nur Aufnahmeklasse –?!
Читать дальше