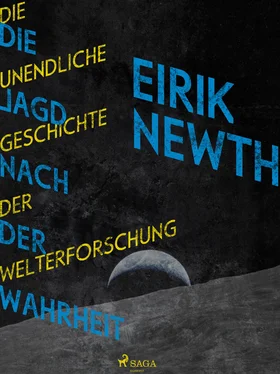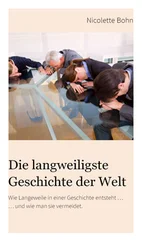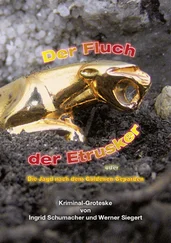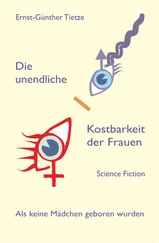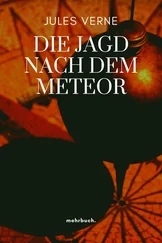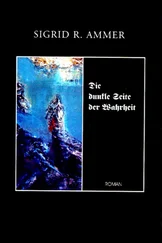Aber tieferes Denken und Forschen fanden die Römer nicht weiter interessant. Das überließen sie den Griechen. Für die Römer galt als Wahrheit über die Natur zumeist das, was die Griechen gedacht hatten, und nicht das, was sie selber sehen konnten. Die Römer hatten zum Beispiel gute Krankenhäuser, deren Ärzte gemerkt haben müssen, dass das, was griechische Wissenschaftler über die inneren Organe der Menschen geschrieben hatten, nicht immer mit ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmte. Aber irgendwelche Konsequenzen haben sie offenbar nicht daraus gezogen.
Da die römischen Kaiser die Philosophie nicht verboten hatten, wurden während der ganzen Römerzeit an der Akademie und an ähnlichen Schulen weiterhin Wissenschaftler und Philosophen ausgebildet. Und so hätte die Philosophie vielleicht für einige Jahrhunderte auf Sparflamme weitermachen können, ehe sie einen neuen Aufschwung nahm. Vielleicht wäre ein neuer Aristoteles aufgetreten, um der Forschung frisches Leben einzuhauchen.
Stattdessen endete alles mit einer Katastrophe. Denn die große Bibliothek von Alexandria, in der es schon einmal beim Angriff Cäsars im Jahr 47 v. Chr. gebrannt hatte, ging endgültig in Flammen auf.
Da nur sehr wenige Kopien der leicht brennbaren Papyrusrollen existierten, ging durch diesen Brand sehr viel vom griechischen Wissen über Geschichte, Kunst und Kultur für immer verloren.
Wir wissen, dass vermutlich Brandstiftung im Spiel war, kennen aber die Brandstifter nicht. Wir wissen auch, wer zuletzt die Bibliothek geleitet hat: die Mathematikerin und Philosophin Hypatia nämlich, die so berühmt war, dass Studenten aus dem gesamten Römischen Reich nach Alexandria kamen, um von ihr unterrichtet zu werden.
Hypatia wurde im Jahr 370 n. Chr. geboren, ihr Vater war Mathematiker. Vermutlich versuchte sie, die mathematischen Regeln zu verbessern, die wir in Euklids Buch Die Elemente (vgl. S.) und in der Syntaxis mathematike des Ptolemäus finden.
Ihre Aufgabe war bestimmt nicht leicht, wir wissen ja schließlich, was die meisten griechischen Philosophen von philosophierenden Frauen hielten. Außerdem ließen sich damals in Alexandria viele zum christlichen Glauben bekehren. Ihnen galt die Philosophie als Symbol für das vermeintlich heidnische griechische Wissen. Hypatia war eine sehr wichtige Philosophin, und vermutlich aus diesem Grund wurde sie im Jahr 415 von den Christen ermordet. Dieser Mord hatte zur Folge, dass die restlichen Philosophen Alexandria verließen.
Bald darauf zerfiel auch das Römische Reich, und in Europa kam es zu einer endlosen Folge von Kriegen. Die christliche Kirche wurde derweil immer mächtiger. In Griechenland rieten die Priester den Menschen, sich auf die christlichen Tugenden zu konzentrieren und ihre Zeit nicht mit Grübeleien über den Ursprung aller Dinge zu vergeuden. Im Jahr 529 wurde die Athener Akademie geschlossen, was für die griechische Wissenschaft das Ende bedeutete.
Historiker, die erforschen, wie die Menschen zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, teilen die Geschichte der Menschheit gern in Perioden ein. Die Glanzzeit der griechischen Philosophie wird als „klassische Periode“ oder „Antike“ bezeichnet, die achthundert Jahre nach dem Ende des Römischen Reiches heißen „Mittelalter“. Oft ist vom „finsteren Mittelalter“ die Rede, weil sich damals eine Art geistige Finsternis über Europa legte.
Viele Christen glaubten nun wieder, die Erde sei eine flache Scheibe. Krankenhäuser wurden geschlossen, weil die Priester erzählten, Kranke könnten geheilt werden, wenn sie zu Gott beteten. Freie Diskussionen wurden verboten, und eine neue Vorstellung von Wahrheit machte sich breit: Das einzig Wahre war das, was mit der Bibel übereinstimmte. Wer etwas anderes hören wollte, musste andere Erdteile aufsuchen.
Wir alle neigen dazu, uns für etwas Besseres zu halten als andere. Jungen halten sich für besser als Mädchen, Christen glauben, Muslimen überlegen zu sein, Weiße verachten Dunkelhäutige.
Das liegt zum Teil an unserer Erziehung. Aber Affenforscher haben nachgewiesen, dass Schimpansen ähnlich empfinden. Die Schimpansen leben in Gruppen, genau wie die Menschen. In der Regel fürchten sie sich und werden wütend, wenn ein fremder Schimpanse sich ihrer Gruppe nähert. Schlimmstenfalls bringen sie den Fremden um. Affen und Menschen sind eng miteinander verwandt. Dass wir dieselbe Angst empfinden, weist eigentlich darauf hin, dass sie Menschen und Affen angeboren ist.
Bei der Jagd nach der Wahrheit dürfen wir das nicht vergessen. Forscher sind nicht anders als andere Menschen, wenn es um Gefühle geht. Deshalb haben auch sie fremde Völker verachtet und nicht glauben wollen, dass auch die sich ihre Gedanken machten und die Natur erforschen konnten. In Europa war es üblich, Völker, die im Dschungel ein einfaches Leben führten, als „primitive Wilde“ zu bezeichnen. Erst seit einigen Jahrzehnten sehen wir das anders.
Nehmen wir zum Beispiel die Polynesier, die auf Inseln im Stillen Ozean leben. Dieses riesige Meer bedeckt die Hälfte unseres Planeten, und die Inseln, die die Polynesier bewohnen, sind im Vergleich dazu winzig klein. Im Stillen Ozean von einer Insel zur andern zu segeln ist ungefähr so, als würde ein Raumschiff in einem Sonnensystem von Planet zu Planet geschickt, in dem die Entfernungen riesig groß sind, weshalb man ganz genau steuern muss, um sein Ziel zu erreichen.
Die Polynesier hatten nur einfache Karten aus geflochtenem Stroh und Muscheln, aber sie wussten sehr viel über Sonne, Mond, Sterne, Meeresströmungen, Vögel, Wind und Wolken. Dieses Wissen hatten sie vermutlich teuer erkauft – mit Menschenleben. Das gilt für das meiste Wissen, das die Menschheit sich im Lauf der Zeit angeeignet hat. Damit wir wissen, dass eine Pflanze giftig ist, muss irgendwer diese Pflanze essen und krank werden.
Das erinnert an die Jagd nach der Wahrheit, wie die alten Griechen sie betrieben haben. Aber das bedeutet nicht, dass alle Völker ihre Philosophen hatten. Es gibt wichtige Unterschiede. Erinnern wir uns an Thales und das Wasser. Er interessierte sich nicht für Wasser, weil es nützlich ist oder weil er glaubte, die Götter würden sich über sein Interesse freuen. Thales versuchte, eine einfache Erklärung für das zu finden, was in der Natur vor sich geht.
Die Polynesier wussten sehr viel über die Bewegungen von Sternen und Planeten am Himmel. Aber wir wissen nicht, ob sie versucht haben zu erklären, warum der Himmel sich zu bewegen scheint. Und ob jemand die Frage gestellt hat: „Was sind Planeten und Sterne überhaupt?“ Aus Polynesien kennen wir keine dem Thales vergleichbare Gestalt, ebenso wenig wie unter den Wikingern und Samen in Nordeuropa, den Mongolen in Asien, den Massai in Afrika und den meisten anderen Völkern. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass wir nicht genug über die Geschichte dieser Völker wissen.
Der Wunsch, die Natur zu erforschen, ist so alt wie die Menschheit selber, aber nicht alle Menschen stellen Fragen so wie die Griechen. Uns sind nur zwei andere Regionen bekannt, in denen solches Denken vor unserer Zeit üblich war: China und das arabische Reich vor etwa tausend Jahren.
Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als in Athen die Akademie geschlossen wurde, waren die meisten Araber arme Nomaden, die die Wüstengebiete der arabischen Halbinsel durchstreiften (die Gegend, in der das heutige Saudi-Arabien liegt). Kaum jemand außerhalb dieses Gebietes wusste damals etwas von der Existenz dieses Volkes.
Aber schon zweihundert Jahre später erstreckte sich das arabische Reich von Indien bis Spanien. Nur selten ist in der Geschichte der Menschheit ein Volk so rasch so mächtig geworden. Wie war das möglich?
Vor allem war dafür der Kaufmann Mohammed verantwortlich, der um 570 n. Chr. in der Stadt Mekka auf der arabischen Halbinsel geboren wurde. Mit vierzig Jahren gelangte Mohammed zu der Überzeugung, er sei ein Prophet – jemand, der einen besonders guten Kontakt zu Gott hat. Obwohl Mohammed anfangs auf großen Widerstand stieß, konnte er schließlich die Macht über seine Landsleute gewinnen, weil er ein glänzender Redner und Heerführer war.
Читать дальше