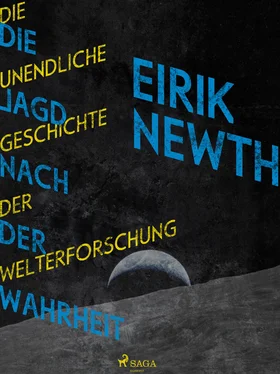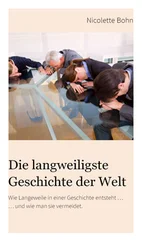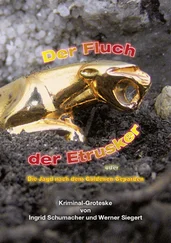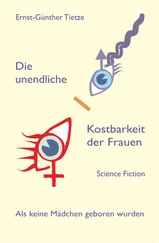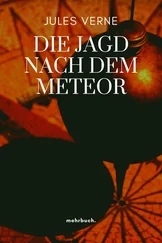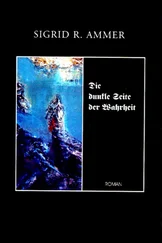Um diese Zeit setzte sich auch die Erkenntnis durch, dass Klöster nicht die beste Ausbildungsstätte für junge Menschen waren, die in der Gesellschaft tätig sein sollten. Im 12. Jahrhundert wurden deshalb in Städten wie Oxford und Cambridge, Bologna und Paris Universitäten gegründet.
Anfangs waren die Universitäten eine Art Kopie von Platons Akademie. Sie waren Orte, an denen reiche junge Männer Philosophie, Mathematik, Alchimie, Astronomie und Theologie (die Lehre von der christlichen Religion) studieren konnten. Die Studenten wurden von Professoren unterrichtet, Fachleuten für die verschiedenen Wissensgebiete. Das Wort Professor stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „dem Publikum etwas sagen“, und genau das war anfangs die Aufgabe der Professoren. Sie forschten nur selten, viel lieber diskutierten sie miteinander. Und zwar oft über die unglaublichsten Themen.
Zum Beispiel zerbrachen sich die Theologen damals den Kopf über die Frage, ob die Seele eines Mannes nach seinem Tod sofort gen Himmel fährt oder ob sie bis zum Jüngsten Gericht warten muss. Sie überlegten auch, ob Frauen überhaupt eine Seele hätten, und sie versuchten zu berechnen, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz hätten. Die Diskussionen der Professoren waren oft entsetzlich kompliziert, und sie brachten lange, verwickelte Argumente vor.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn wir versuchen, einer Fernsehdiskussion zu folgen, dann stellen wir oftmals fest, dass die Teilnehmer lauter komplizierte Wörter verwenden, um etwas zu sagen, das sich auch viel einfacher sagen ließe. Komplizierte Argumente können sehr hilfreich sein, wenn wir versuchen, einer unangenehmen Frage auszuweichen. Aber sie erschweren auch das klare Denken. Und klares Denken ist bei der Jagd nach der Wahrheit unbedingt nötig.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts versuchte ein englischer Mönch, daran etwas zu ändern. Er hieß Wilhelm von Ockham und studierte an der Universität Oxford Theologie. Dabei legte er sich so heftig mit seinen Professoren an, dass er von der Universität flog, ehe er seine Ausbildung beendet hatte. Für den Rest seines Lebens wanderte er von einem Kloster zum andern und schrieb Bücher, die großes Aufsehen erregten.
Wilhelm von Ockham war natürlich ein Christ, und viele seiner Schriften handeln von Gott. Aber er interessierte sich auch für die Logik, wie Aristoteles sie beschrieben hatte (vgl. S. 26). Er vertrat die Ansicht, die Menschen müssten ihre Vernunft gebrauchen und sich auf ihre Sinne verlassen, wenn sie verstehen wollen, was in der Welt passiert. Vor allem wollte er etwas gegen die komplizierten Diskussionen unternehmen, die in Klöstern und an Universitäten so beliebt waren. Deshalb stellte er eine Regel auf, um das Leben für Diskussionsteilnehmer und für Menschen, die verstehen wollen, was andere sagen, leichter zu machen.
Die Regel lautete ungefähr so: „Wenn man etwas beweisen will, dann beschränkt man sich auf die wirklich notwendigen Argumente.“ In der Wissenschaft ist ein Argument oft etwas, was ein Forscher beobachtet hat, es kann sich um eine mathematische Berechnung oder um das Ergebnis eines Experiments handeln. Oft können sehr unterschiedliche Dinge darauf hinweisen, dass der Forscher Recht hat. Und dann ist es wichtig, alles Überflüssige zu streichen, damit er und die Menschen, die seine Berichte lesen, nicht verwirrt werden.
Wichtig ist das, was ein Wissenschaftler sagen will, nicht, ob er es auf eine besonders ausgefeilte Weise sagt. Ockhams Regel ist noch immer eine große Hilfe bei der Jagd nach der Wahrheit. Studenten lernen sie an der Universität, Forscher wenden sie immer wieder an. Die Regel ist auch als „Ockhams Rasiermesser“ bekannt. Rasiermesser sind scharf, und Wilhelm von Ockham schnitt mit dieser Regel bei Diskussionen alles Überflüssige ab. Kein Wunder, dass er nicht sehr beliebt war!
Wilhelm von Ockham starb zwischen 1347 und 1350 im Alter von rund 65 Jahren in München. Es war kein Zufall, dass er gerade zu dieser Zeit starb, denn zu diesem Zeitpunkt erlagen in ganz Europa Millionen von Menschen einer Krankheit, die der „schwarze Tod“ oder die „Pest“ genannt wurde. Damals wusste niemand, wie diese Krankheit entstand. Die Menschen wussten nur, dass Kranke mit schwarzen Beulen am ganzen Leib und hohem Fieber fast immer zum Tode verurteilt waren. Ein Drittel der Bevölkerung Europas fiel dem schwarzen Tod zum Opfer, wie auch Millionen von Menschen in anderen Erdteilen. Der Pest war es egal, ob jemand arm oder reich war, und die damaligen Ärzte konnten nur zusehen, wie ihre Patienten starben. Auch Gebete, zu denen die Priester rieten, brachten keine Hilfe.
Man stelle sich vor, ein Drittel aller Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung stirbt innerhalb weniger Wochen. Einer von drei Menschen im Haus, wo wir wohnen, in der Straße, der Schule oder der Familie. Was wäre das für ein Gefühl, überlebt zu haben? Was spielte sich nach einer derart einschneidenden Katastrophe in den Köpfen der Menschen ab? Da es damals noch keine Meinungsumfragen oder Zeitungen gab, wissen wir nicht, wie die einfachen Menschen reagiert haben. Aber vielleicht haben damals viele ihren Glauben an Gott verloren.
Das kann jedenfalls eine Erklärung für die seltsame Entwicklung sein, die in Italien einsetzte, nachdem die Pest abgeklungen war. Man sollte eigentlich annehmen, dass eine solche Katastrophe die Gesellschaft vollständig zerstört. Zahllose Bauern und Arbeiter waren umgekommen, Kinder hatten ihre Eltern, Klöster und Universitäten viele ihrer fähigsten Gelehrten verloren. Nach einigen Jahrzehnten jedoch, als die Lage sich endlich wieder stabilisiert hatte, machte sich eine erstaunliche Veränderung bemerkbar.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.