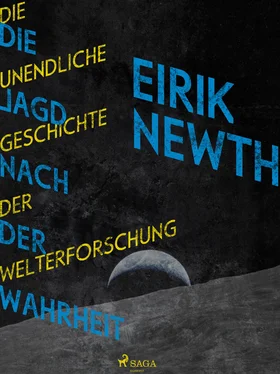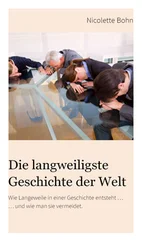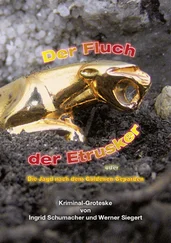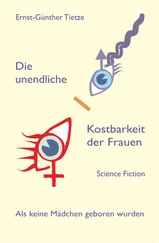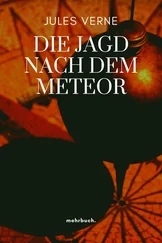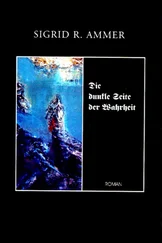Eines der größten Probleme bei der Jagd nach der Wahrheit ist, dass wir nicht immer wissen, welche Folgen eine Erfindung nach sich ziehen kann. Es war kein purer Zufall, dass der Erfinder des Schießpulvers aus China stammte. Die Chinesen haben nämlich hunderte von wichtigen Entdeckungen und Erfindungen gemacht, die das Leben der meisten Menschen erleichterten. In China wurde zum Beispiel zum ersten Mal ein Eisenpflug benutzt, mit dem sich viel besser pflügen ließ als mit den alten Holzpflügen. Die Chinesen stellten auch als Erste fest, dass sich die Ernte vergrößert, wenn das Korn in Reihen gesät wird, und sie entwickelten das erste Gift, um schädliche Insekten zu töten.
Die Chinesen bohrten nach Öl, nutzten die Wasserkraft, stellten Kunststoffe her und benutzten schon tausend Jahre früher als die übrige Welt Papiergeld. Viele ihrer Erfindungen verwenden wir noch heute, zum Beispiel Landkarten, selbst leuchtende Farbe, Spielkarten, Streichhölzer, Schubkarren, mechanische Uhren, Spagetti, Regenschirme, das Schachspiel, Steigbügel, Bücher, Angelruten mit Kurbeln und das Steuerruder. Manches von dem wurde aber auch zwei- oder mehrmals an unterschiedlichen Orten und unabhängig voneinander erfunden.
In China fehlte zwar eine Einrichtung wie die Akademie in Athen, aber es gab dort dennoch viele tüchtige Forscher. Die Chinesen hatten schon lange vor den Griechen den Sternenhimmel studiert, und sie entdeckten unter anderem die Flecken auf der Sonne. Chinesische Mathematiker waren mindestens so tüchtig wie ihre indischen und arabischen Kollegen und erfanden ein Zahlensystem, das dem indischen ähnlich ist.
Chinesische Ärzte behandelten viele gefährliche Krankheiten und verfügten über verschiedene Impfstoffe (vgl. S 144ff).
Der chinesische Arzt Chang Chi, der um das Jahr 200 v. Chr. lebte, erkannte, dass manche Krankheiten durch falsche Ernährung entstehen. Er erklärte, wie solche Mangelerkrankungen geheilt werden konnten. Erst im 18. Jahrhundert verfügten auch europäische Ärzte über dieses Wissen.
Diese vielen Entdeckungen und Erfindungen trugen dazu bei, dass China zu einem der reichsten und mächtigsten Länder der Welt wurde. Die Araber fürchteten und achteten die Chinesen aus gutem Grund.
Aber seit damals hat sich einiges geändert. Sowohl in China wie auch in Arabien wurde für lange Zeit die Jagd nach der Wahrheit eingestellt. Wie in Europa nach der Römerzeit wurden auch dort irgendwann keine bedeutenden Entdeckungen und Erfindungen mehr gemacht.
Einer der Gründe, warum es in China dazu kommen konnte, kann das chinesische Denken sein. Der größte Philosoph der chinesischen Geschichte hieß K’ung-fu-tzu. Er lebte um das Jahre 500 v. Chr. und stellte Regeln auf, wie die Gesellschaft funktionieren und wie die Menschen miteinander umgehen sollen.
Konfuzius, wie wir ihn heute schreiben, war auf Gesetz und Ordnung erpicht. Die Menschen sollten die Gesetze befolgen und dem Kaiser und anderen mächtigen Personen gehorchen. Ehefrauen mussten ihren Männern gehorchen, die Jugend musste die älteren Leute respektieren. Ein Problem bei diesem Denken ist, dass es nicht mehr leicht ist, Fragen zu stellen.
Am Anfang meines Buches habe ich dazu aufgefordert, zu zweifeln und nicht einfach alles zu glauben. Solche Zweifel sind in gewisser Hinsicht das genaue Gegenteil der Lehre von Konfuzius. Er empfiehlt uns, denen zu glauben, die älter sind und über eine längere Ausbildung verfügen als wir. Dieses Denken bringt uns beim Forschen jedoch nicht weiter. Oft stellen nämlich junge Menschen mit ausgefallenen Ideen die richtigen Fragen, während ältere Forscher oft in ihrem gewohnten Denken verharren.
Im Lauf der Zeit wurde es in China immer schwieriger, Fragen zu stellen und neue Ideen Gehör finden zu lassen. Auf diese Weise ging es damals bergab mit den Chinesen – am Ende vergaßen sie sogar ihre eigenen Erfindungen. Als europäische Priester im 17. Jahrhundert den Chinesen ihre mechanischen Uhren zeigten, waren die Chinesen zutiefst beeindruckt. Sie wussten nicht mehr, dass sie einst selber vergleichbare Zeitmesser erfunden hatten.
Auf ähnliche Weise entwickelte sich die Lage im arabischen Reich. Obwohl arabische Wissenschaftler tüchtig waren, konnten sie nicht so viele Fragen stellen wie die griechischen Philosophen. Ihre Religion behauptete, die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu kennen, weshalb sie sich nicht weiter damit befassen sollten. Deshalb wagten nur wenige Araber, dasselbe zu sagen wie Demokrit: dass Gott für die Natur und das Leben der Menschen keine Bedeutung habe.
Die arabische Gesellschaft hatte teilweise dieselben Probleme wie die griechische. Die Araber verboten ihren Frauen das Forschen, und sie hatten Sklaven, weshalb es nicht nötig war, arbeitssparende Erfindungen zu machen. Im Lauf der Zeit wurde die Religion immer strenger, und immer mehr Fragen wurden verboten. Die Entwicklung war in dieser Hinsicht dieselbe wie in Europa. Die Religion läutete ein Mittelalter ein, in dem als Wahrheit galt, was im Koran stand, dem heiligen Buch.
Die Jagd nach der Wahrheit erinnert an einen Staffellauf. Nicht jeder Läufer hat die ganze Zeit die Stafette in der Hand, aber sie ist immer unterwegs. Und um das Jahr 1300 gaben die Araber die Stafette wieder an die Europäer zurück.
Europa kommt wieder nach vorn
Als in Europa die Neugier auf die Natur wieder erwachte, geschah das zuerst innerhalb der Kirche, die die Verantwortung für alles Wissen und Denken trug. Wer im Mittelalter eine Ausbildung haben wollte, musste Priester, Mönch oder Nonne werden. Mönche und Nonnen lebten in besonderen Gebäuden, die „Kloster“ genannt werden. Dort sollten sie ihre Zeit vor allem mit Beten verbringen. Sie durften nicht heiraten und mussten strenge Regeln einhalten.
In Wirklichkeit war dieses Leben aber nicht immer so streng. Wer „Robin Hood“ gelesen hat, diese Geschichte eines englischen Helden aus dem Mittelalter, der erinnert sich vielleicht noch an Bruder Tuck, den fetten und faulen Mönch, der gern trank und sich prügelte. Sein Beispiel zeigt, dass sehr unterschiedliche Menschen ins Kloster gingen, nicht nur die frommen.
Zum Beispiel die Neugierigen. Vor tausend Jahren gab es in Europa kein Haus der Weisheit und keine Akademie mehr. Im Kloster dagegen war eine Art Ausbildung möglich, und dort gab es auch Bibliotheken. Im 11. Jahrhundert wurden dort neue Bücher in Gebrauch genommen, Bücher, die Aristoteles, Ptolemäus und andere griechische Philosophen geschrieben hatten.
Die Araber hatten die Werke der griechischen Philosophen aufbewahrt, und viele Bücher in den Klostern waren aus dem Arabischen übersetzt worden. Bücher zu übersetzen ist immer schon ein schwieriges Handwerk gewesen, manchmal kann es sogar lebensgefährlich sein. Im Mittelalter führten Araber und Europäer gegeneinander Krieg. Mönche mussten sich als Muslime verkleiden oder sogar die Religion wechseln, um sich die Bücher zu verschaffen. Ein solches Konvertieren wurde manchmal mit dem Tode bestraft.
Wenn die arabischen Bücher in den Klöstern eintrafen, wurden sie nicht ins Englische oder Italienische übersetzt, sondern ins Lateinische, die alte Sprache Roms. Das Latein hatte den Untergang des Römischen Reiches überlebt, weil die Kirche es benutzte. Die Bibel war schon längst ins Lateinische übersetzt worden, und Messen wurden auf Latein gelesen. Die Menschen sprachen Gebete in einer Sprache, die die meisten von ihnen nicht verstanden! Aber die Verwendung des Lateinischen hatte auch ihre Vorteile. Da alle Nonnen und Mönche Latein lesen konnten, hatte ein Mönch in Mainz ebenso großen Nutzen von einem Buch wie eine Nonne in Rom.
Wenn ein Buch fertig übersetzt war, dauerte es aber noch lange, bis alle, die ein Exemplar haben wollten, auch wirklich eins besaßen. Damals mussten alle Bücher mit der Hand Wort für Wort abgeschrieben werden. Das sogenannte Kopieren von Büchern wurde zu einem eigenen Beruf. Es ist klar, dass die Bücher deshalb von Fehlern nur so wimmelten, und wer damals Bücher las, konnte sich nicht darauf verlassen, dass zwei Kopien genau dieselben Wörter enthielten.
Читать дальше