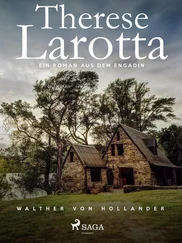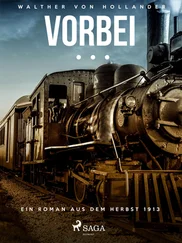Sieh der Liebeswunden Lust.
Marianne von Schellemarr schauerte. Die wärmende Kälte des Schneewaldes, der sonnige Hang, die Stille, das leise Knirschen der Skier, der sanfte Druck des Buches, den sie im Gürtel spürte . . ., das alles verließ sie, und statt dessen war hier die warme Mainacht, war hier ein langer Bretterzaun, der einen wilden Garten abschloß. Flieder. Ein kleiner Bach. Ein winziges Mühlrädchen, von Kindern gebaut, klapperte nun auch schon dreißig Jahre unter den Wassern.
Jetzt kam ein kleiner Platz. Ein hoher Herr stand seinem Amte gemäß auf einem Postament, uniformiert wie die meisten hohen Herren, gestützt auf sein Schwert, das er sicher nie gegen einen Feind gezogen hatte. Es war der »alte« Fürst, so genannt im Gegensatz zum jungen, durch den Krieg abgesetzten Fürsten, den sie gut gekannt hatte. Reinhold von Schellemarr war sein Rechtsberater gewesen und sein Jagdgast. Der junge Fürst hatte eine etwas klagende Stimme, eine melancholisch-witzige Art, zu sprechen. Gar nichts Heldisches oder Gegürtetes. Er war einfach ein müder Mann.
Sie kam ins Hotel. Sie sah noch einmal den alten Fürsten, diesmal in Öldruck mit einer breiten Schärpe und einem sachlichen Fürstenlächeln, und daneben hing der junge Fürst, der auch alt aussah.
Marianne ging schnell in ihr Zimmer. Sie stand am Fenster. Es war, als hätte der Regen nur darauf gewartet, daß sie unter Dach kam. Denn jetzt begann es heftig zu rauschen. Die Bäume standen still und geduckt. Der Staub auf dem Fensterbrett sprenkelte sich, wurde weggewischt, weggespült. Jetzt begannen die Traufen zu singen.
Frau von Schellemarr stand lange. Wenn es wirklich wahr war, daß ihr Wachen einen Sinn hatte, daß ihr zarter Schlaf einen Sinn hatte, daß ihr Leiden einen Sinn hatte, dann war es ja gut. Oder –? Friedrich von M. hatte auch einmal gesagt: »Warum suchen Sie überall einen Sinn? Ist es nicht genug, daß Sie leben?« Und nach einer Weile, natürlich beim Weggehen, in seiner verschmitzten Art, die man nie ganz verstehen, auf die man nur schwer etwas erwidern konnte: »Wenigstens für mich ist es genug.«
Das Fenster des Hotelzimmers ging auf einen Park, nach dem das Hotel Parkhotel hieß. Die Nacht schien herein, mit den dunklen Ästen einer Linde, und wenn sie sich etwas aus dem Bett bog, konnte Frau von Schellemarr einen Baum erkennen, dessen Äste noch ziemlich kahl waren: eine Eiche oder eine Akazie.
Sie lag nun schon zwei Stunden wach. Der Regen war weniger heftig geworden. Aber immerhin, seine Melodie konnte das Wasser in der Rinne weitersingen. Marianne hatte versucht, einmal »das Ganze« zu überdenken. Jetzt, nicht wahr, nachdem sie dieses und jenes wiedergefunden hatte, nachdem sie sogar festgestellt hatte, daß in ihrem kleinen Koffer oben im Deckel das kleine Exemplar des »Westöstlichen Diwans« sich versteckt hatte, jetzt mußte es doch möglich sein, Stein für Stein zu fügen.
Sie war von Natur ein sehr ordentlicher Mensch. Es war ihr wichtig, daß alles in ihrem Leben begründet war oder doch wenigstens der Reihe nach, gut verständlich, vor sich ging. Warum ließ sich ihr Leben nicht so ordnen? Warum ließ sich nicht begreifen, was sie getan und unterlassen hatte?
Sie hatte in diesen zwei Stunden den Schatten Friedrich von M.s beschworen und wieder beschworen, Gestalt zu werden. Aber wie er im Leben seltsam halsstarrig nach eigenen Gesetzen (nach unerforschlichen hatte sie einmal gesagt) sein Leben führte, so schien er es auch noch als Schattengebilde, als Traumbewohner, als Träger der Erinnerung zu halten.
Sie hatte ihn beschworen, er war nicht gekommen. Jetzt hatte sie in einem plötzlichen Einfall ein Gespräch mit ihrer Tochter Clara angemeldet. Berlin meldete sich schnell. Rechtsanwalt Wegener, der Schwiegersohn, war am Apparat. Er lachte sein herzliches juristisches Lachen. Eine großartige Idee von der Mama, um ein Uhr nachts anzurufen. Clara war gerade unten, Gäste fortbringen. Gleich würde sie wieder oben sein. Er rief noch etwas Lustiges vom Balkon hinunter. Frau von Schellemarr sah die kleine Wohnung am Breitenbachplatz vor sich, mit dem viereckigen Balkon, der aus dem Dach herausgebaut war, den winkligen Stuben, den allzu geraden Möbeln, mit dem ganz und gar unkantigen, nüchternen, wirklichkeitsverschmolzenen Doktor Wegener und mit Clara, die ihrem Namen alle Ehre machte, sehr klar war, aber auch ein wenig nüchtern, auf Erfolg aus, sparsam, genau, sogar mit dem Herzen. Sie dosierte sicherlich die Gaben ihrer Liebe wie ein Arzt. Und wußte in jedem Augenblick, was sie für die Dinge bekam, die sie gab. Darum würde sie nie viel bekommen.
Jetzt zwitscherte ihre Stimme im Apparat. Frau von Schellemarr wußte nicht den Grund anzugeben, weshalb sie plötzlich und mitten in der Nacht angerufen hatte. Sehnsucht . . ., das war ein Wort, das Clara nur im Kino gelten ließ. Verlassenheit? Das würde sie, Marianne, nie zugeben. Also sagte sie lieber die Wahrheit: sie wollte Claras Stimme hören. Sie wollte sich erinnern, daß sie Kinder hatte, um die, wie Reinhold von Schellemarr gesagt hatte, es sich für jede Frau und Mutter wohl lohnte zu leben.
Das Gespräch, vom Regen begleitet, von Lachen unterbrochen, dauerte nicht lange. Mutter und Tochter sagten einander einiges Liebe und Gute. Die wirklichen Fragen zwischen ihnen blieben unbeantwortet, die leeren Räume unausgefüllt. Trotzdem hatte der Anruf ein Ergebnis: Marianne wußte plötzlich wieder, warum sie nicht von ihren Kindern die Antwort bekommen konnte, die sie suchte.
Natürlich, als sie kaum eingeschlafen war, spazierte Friedrich von M. in ihren Traum hinein. Eigentlich war es gar kein Traum, sondern mehr eine Erinnerung im Schlaf, ein ganz klein wenig von Traum über die Wirklichkeit hinausgehoben.
Sie ging zum Beispiel nicht mit ihm die vielen Stufen zum Steinbruch hinunter, sondern sie schwebte von Stufe zu Stufe, und er schwebte neben ihr.
Jetzt standen sie unten und sahen die steile Wand hinauf, in die die Steinbrucharbeiter sich ein paar Höhlen als Regenschutz geschlagen hatten. Das war der Akaziengrund, ein Talkessel, von den Steinhauern im Laufe von Jahrhunderten gegraben. Sie traten zusammen an den kleinen Teich. Claus und Clemens standen im Wasser, die Hosen hochgekrempelt, und fingen Feuersalamander.
Plötzlich waren sie weggewischt. Aber sie waren nicht etwa untergetaucht oder gar ertrunken, sondern es war eben ein anderer Tag. Nur die gleiche Sonne schien. Die Salamander sonnten sich auf den Steinen. Marianne saß mit Friedrich von M. am Rande des Tümpels. Er hatte die Arme um die Knie geschlungen. Er sagte: »Sie brauchen davon keine Notiz zu nehmen. Aber es wäre eine verdammte Feigheit, wenn ich’s Ihnen verschwiege.« Marianne fragte, obwohl sie genau wußte, was er meinte: »Was meinen Sie denn?«
Friedrich von M. stand auf, tippte mit einem Finger auf ihren Arm und sagte, als scherze er: »Daß ich Sie liebe, meine Liebe. Daß Sie meine Liebe sind, liebe Marianne. Wahrscheinlich ist es Ihnen nicht lieb. Aber Liebesdinge kann man nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt lenken. Wenn der mal verpaßt ist . . .«
Er sah auf sie hinunter, die den Feuersalamandern zusah. Er sagte: »Antworten Sie doch. Oder haben Sie nichts dazu zu sagen?« Marianne schüttelte den Kopf. Friedrich von M. wiederholte hartnäckig: »Antworten Sie. Sie sollen antworten.« Jetzt sah sie ihn an. Und plötzlich kniete er neben ihr. Er packte sie bei den Schultern. Er flüsterte: »Ich weiß ja auch so, daß Sie mich lieben. Nein . . . Sie sollen es nicht sagen. Sie brauchen es nicht zu sagen. Sie dürfen es ja nicht einmal sagen.«
Marianne antwortete trotzig: »Warum darf ich nicht?« Friedrich von M. erwiderte spöttisch: »Ich bin nicht verheiratet, meine Gnädige. Ich habe auch, soviel ich weiß, keine Kinder. Und wenn ich sie wissentlich hätte, ich könnte und wollte sie nirgends vergessen. Sehen Sie . . ., so ist das. Das nennen die Leute dann ein Problem.«
Читать дальше