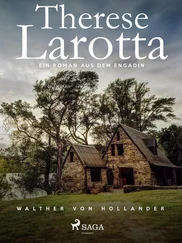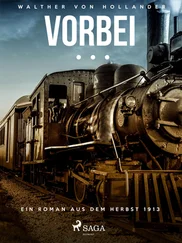Er gestand ihr damals, es sei das zweiundzwanzigste Bild, das er besaß. Lauter Bilder, die sie nicht kannte, lauter Gesichter, von denen nur er wußte. Und sie hatte es nicht gemerkt, daß er sich ihrer bemächtigte, daß er ihr Wesen bestahl. Oder –? Nun, sie hatte es doch manchmal gemerkt und wollte es nur nicht zugeben. Es war ja nicht sehr wichtig. Warum sollte Herr von M., der sehr viel fotografierte, der es von seinen Reisen her gewohnt war, alles mit der Kamera aufzufangen und nach Hause zu tragen, warum sollte er sie nicht fotografieren?
Aber damals, in diesem Augenblick, hatte sie es erkannt: eigentlich sollte sie ihm verbieten, Bild um Bild von ihr zu stehlen, Bild um Bild von ihr aus ihrem Hause, aus ihrer Familie wegzutragen. Hatte er ihr nicht selbst erzählt vom Bildzauber der Primitiven und daß man jemanden zwingen könne, die Bilder und Abbilder mit der lebendigen Gestalt zu erfüllen?
Ja . . . damals zum erstenmal erschrak sie; und dann? Dann vergaß sie den Schrecken, drängte ihn weg, übersah ihn so sehr, daß sie den Schatten nicht gesehen hatte . . ., zwanzig Jahre nicht gesehen, und sah ihn jetzt erst, da der Schattenwerfer schon so lange tot war.
Sie zog den Schleier ganz vor ihr Gesicht. Es war eine Gebärde voll größter Trauer. Dann erhob sie sich und ging schnell aus dem Restaurant.
Die Köpfe der Stammtischrunde bewegten sich, wie von einer Schnur gezogen, ihr nach. Frau Sanitätsrat Rommel sagte: »Hübsche Person. Bloß ein bißchen auffällig.« Und die Sängerin Hippler schrie, so laut es ihre Heiserkeit gestattete: »Sie erinnert mich an eine Schauspielerin . . ., ja, an wen erinnert sie mich bloß?« Frau Oberamtsrichter Holzer ermunterte sie, indem sie ein paar der Schauspielerinnen vorschlug, die in jenen zwei sagenhaften Sangesjahren der Hippler berühmt gewesen waren: »Die Sorma? Die Lehmann?«
Die Hippler winkte jedesmal ärgerlich ab, als müsse sie eine Fliege von ihrem Gesicht verjagen. Dann schrie sie: »Wenn ich mich nicht sehr irre, wenn ich mich nicht ganz furchtbar täusche . . ., nein . . ., sie war es doch nicht.«
Damit erhob sie das Glas und trank Herrn Sanitätsrat Rommel zu. Sie tat es, um auf diese Weise schlau sein Verbot zu umgehen, denn er hatte ihr streng untersagt, mehr als drei Schoppen Rotwein pro Abend zu trinken, teils ihrer Stimme, teils ihrer Nase, teils ihres Herzens, teils ihres schmalen Geldbeutels wegen. »Wenn ich mich nicht sehr irre«, räusperte sie jetzt mehr für sich, »ich habe . . ., ich könnte es beschwören . . ., aber das Gedächtnis ist nicht meine stärkste Seite . . .« Niemand von der Tafelrunde hörte mehr zu.
Frau von Schellemarr hatte gerade den Gartenzaun des Schellemarr-Hauses erreicht und trat ein. Immer noch schnurrte der Drücker der Pforte leise wie eine gestreichelte Katze. Im Hause hinten brannte ein Licht. Das mußte im Speisezimmer sein. Hermine von Schellemarr, die Schwester ihres Schwiegervaters, die jetzt das Haus bewohnte – Marianne wußte es von Claus, ihrem Ältesten, der manchmal hier war –, die alte Hermine von Schellemarr saß jetzt mit Bruni am Radio, mit Brunhilde Sabotta, einer Berliner Portierstochter, sechzig Jahre alt, seit dreißig Jahren Köchin im Schellemarr-Hause. Sicherlich taktierte sie die Musik mit dem gummibewehrten Ende des Stockes und beschimpfte die Dirigenten, die ganz anders als der von ihr vergötterte Nikisch dirigierten. Die beiden Alten legten ihre Wangen dicht an den Apparat. Denn beide waren schwerhörig. Marianne von Schellemarr ging den Außenweg zum Obstgarten. Sie wollte die La France finden. Vielleicht fand sie von da aus weiter, fand sie, was ihr noch fehlte.
Wie konnte es sein, so fragte sie sich, indes sie langsam den Heckenweg zwischen Hainbuchen hinunterging und an dem Götterbaum vorbeikam, der fast so spät wie die Akazien seine Blätter entfaltete, riesige Rispen, aus deren Stengeln die Kinder sich im Herbst Schilde flochten, Wigwamwände, Panzer und anderes Kriegerische . . ., wie konnte es sein, daß sie so lange nicht wußte, wie es um ihr Herz stand? Hätte sie sich nicht rechtzeitig zur Wehr setzen können? Oder sich hineinwerfen in den Fluß, der sie dann sicher davontrug?
Sie war an der Pforte zum Obstgarten angekommen. Der Halbmond schien noch ziemlich grell. Die La France war nicht zu sehen. Sie war wohl eingegangen. Spuren der Wurzel, Spuren eines verfaulten, halbverfallenen Stockes konnte sie noch in der Erde erkennen, als sie sich niederbog und mit den Händen den Boden beiseite scharrte.
Sie hatte sich also nicht getäuscht. Und es erschien ihr nun, als könne die Frage nicht beantwortet werden, die sie hergetrieben hatte, weil die La France nicht mehr dastand.
Plötzlich erschauerte sie. Das gleiche Gefühl, das sie vorhin auf dem Friedhof erfaßte, hatte sie jetzt wieder gepackt: die Wirklichkeit des Vergangenen, halb freudig, halb eisig, erschreckend und wärmend zugleich. Es ist ja nichts vergangen, solange man lebt. Nichts ist vergangen, solange man lebendig ist.
Sie kam aus dem Obstgarten. Sie trug ein hellrotes Kleid, blutrot beinah, so daß die Kinder, die damals klein waren, davor erschraken. (Clemens wollte sie nicht anfassen, wenn sie dieses Kleid trug.)
Sie hatte Erdbeeren gepflückt, zwei Körbe voll, weiße Spankörbe, in denen die roten Früchte auf grünen Blättern leuchteten. Reinhold von Schellemarrs Pfiff tönte vom Hause her. Mariannes Gesicht verschloß sich. Sie wollte nicht wie ein Hund rangepfiffen werden. Und so blieb sie stehen, setzte die Körbe ab und betrachtete die kleinen, fingerhutgroßen Früchte des Klarapfels, die herabgefallen waren. Merkwürdig, wie wenig in jenem Jahr reifte.
Wieder der Pfiff. Marianne bückte sich und zog ein paar Unkrautstauden heraus. Es war das glasstenglige Springkraut, dessen lange Früchte zu schwellen begannen und das seine Samen jetzt über ihre Hände ergoß.
Ganz nah kam jetzt der Pfiff (so nah, daß die jetzige Frau von Schellemarr, die im Mondlicht stehende, sich mit ihrem Handschuh die Ohren zuhielt), und jetzt bog Herr von Schellemarr um die Ecke. Marianne sah ein paar graue Flanellhosen, ein paar gelbe Schuhe mit weißen Einsätzen (das war ihr Mann) und daneben ein paar sehr schmale weiße Tennisschuhe, sehr gut gebügelte Tennishosen und ein Racket. Sie mußte schnell aufstehen. Es war gut, daß man vom Bücken so leicht rot wurde. Denn nun konnte sie nicht röter werden, weil Friedrich von M. vor ihr stand.
Immer war es so: wenn sie an ihn dachte, dann kam er nicht. Wenn sie nicht an ihn dachte (aber vielleicht dachte ihr Herz), dann stand er plötzlich vor ihr. Damals hatte er sie besonders erschreckt. Denn in acht Tagen einer furchtbaren Sehnsucht, die auf den Jahresball des Tennisklubs gefolgt waren, in acht Tagen, in denen sie nichts von ihm hörte und sah, keine Karte kam, kein Dank, keine Blume, kein Buch – in diesen acht Tagen hatte sie ihn »endgültig« aufgegeben. Sie wollte nie wieder an ihn denken. Sie wollte nicht mehr mit ihm sprechen. Sie wollte nichts, gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der schwere Entschluß hatte ihr das Herz erleichtert. Und nun stand er vor ihr.
Er hatte sich nicht dazu gedrängt. Reinhold von Schellemarr hatte ihn gerufen. Er brauchte ihn als Sachverständigen für einen schwierigen Prozeß, in dem es auf vergleichende Schriftkunde ankam, und Friedrich von M. war einer der wenigen wissenschaftlich anerkannten und psychologisch begabten Graphologen.
»Du mußt nett gegen ihn sein«, flüsterte Schellemarr ihr zu, indem er auf sie zutrat. Friedrich von M. aber hatte sich gebückt, die Körbe mit den Erdbeeren aufgenommen und war ihr voran aufs Haus zugegangen. So war er immer. Das war das Verführerische an ihm. Er tat das Selbstverständliche, das, was gerade dran war, und was man nicht erwartete.
Reinhold von Schellemarr ging mit seiner Frau hinter ihm drein. Er sprach von M.s Graphologie und sagte etwas spöttisch: »Warum hast du mir nicht erzählt, was für bedeutende Fähigkeiten deine Bekannten haben? Da muß ich erst von anderer Seite erfahren . . .« Frau von Schellemarr unterbrach abwehrend: »Du kennst Herrn von M. so gut wie ich.« Dabei hatte sie ein schlechtes Gewissen. Tatsächlich hatte sie nie mit ihrem Mann über Friedrich von M. gesprochen. Warum nicht? Es war nichts zwischen ihnen geschehen, das nicht jeder hätte sehen, nichts gesprochen, das nicht jeder hätte hören können. Trotzdem kein Wort über ihn. Auch später nie. Wenigstens nie unter Nennung seines Namens. Warum nur? Aber wenn Schellemarr jetzt neben ihr gestanden und sie nach Friedrich von M. gefragt hätte, sie hätte ihm sagen müssen, was sie ihm einmal sagte: »Es ist meine Sache. Sie geht dich nichts an. Ich kann dir nichts davon abgeben. Nicht mal ein Wort.«
Читать дальше