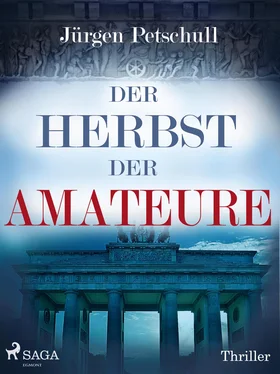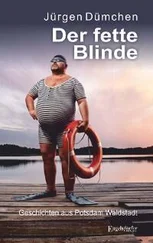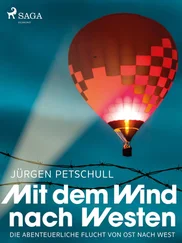An der Ecke Pennsylvania Avenue und Jackson Place rempelte Ingham aus Versehen eine farbige Bettlerin an, die ihre Habseligkeiten in einem blauen Müllsack hinter sich herschleifte. Die Frau schlug nach ihm und fluchte laut. Ingham murmelte eine Entschuldigung und flüchtete schnell durch das schmiedeeiserne, hohe Gittertor zum Old Executive Office Building. Er eilte die Treppen zum Eingang hinauf und warf dabei die Schale der dritten Banane in einen Papierkorb. Einer der Sicherheitsbeamten beobachtete ihn mißtrauisch, trat hinter einer der Doppelsäulen hervor und kam auf ihn zu. Die Kontrolleure wechselten aus Sicherheitsgründen häufig, so daß sich sogar die Altgedienten unter den 1600 Mitarbeitern des Hauses jedesmal ausweisen mußten. Ingham klappte sein rostfarbenes Jackett zurück. Er hatte seinen Office Pass an der Brusttasche seines Hemdes befestigt.
Der uniformierte Türwächter trat nah an ihn heran, um das Paßbild zu betrachten. Auf dem eingeschweißten Farbfoto hatte Ingham eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinem irischen Großvater Murray Ingham aus Ballyshannon: kleingelockte, rötliche Haare, vorn schon ein wenig ausgedünnt, kantige Wangenknochen, schmaler Mund, massive Kinnpartie. Sogar die dick verglaste, rundliche Brille des gelernten Juristen (mit erstklassigem Examen von der Yale University) glich der seines Vorfahren, der sich in einem Stahlwerk in Pittsburgh zu Tode geschuftet hatte.
Nach einer Sekretärin mit dünnen Stöckelschuhen und dicken Hüften wurde Ingham in der Röntgenschranke durchleuchtet, legte Hartgeld und Schlüssel ab und ließ sich mit dem Metalldetektor abtasten. Schließlich durfte der Special Assistent des Sicherheitsberaters des amerikanischen Präsidenten über den roten Marmorflur, in dem es nach einem scharfen Fußboden-Reinigungsmittel roch, in sein winziges, altmodisch möbliertes Büro in den ersten Stock gehen. Er öffnete die durch ein Schloß mit Zahlencode gesicherte Tür. Auf seinem Schreibtisch lagen die liberale Washington Post und die konservative Washington Times. Ingham überflog die Schlagzeilen. Beide Blätter berichteten auf der ersten Seite über die dramatische Entwicklung in Deutschland: 7000 Bürger aus der Deutschen Demokratischen Republik, die in die Prager Botschaft der Bundesrepublik geflüchtet waren, durften gestern nach zähen Verhandlungen des westdeutschen Außenministers Genscher mit Sonderzügen in den Westen ausreisen. Über einem Foto von jubelnden, sich umarmenden Deutschen aus Ost und West auf einem Grenzbahnhof in der Bundesrepublik stand: »Der Zug in die Freiheit ist nicht aufzuhalten.« Ingham schob die Zeitungen zur Seite und nahm die Unterlagen, die er in einer Klarsichthülle auf seinem Schreibtisch bereitgelegt hatte. Oben links prangte ein roter Stempel: Top Secret. Darunter stand: »Peter Rosenblatt, SDI-Wissenschaftler, Lawrence Livermore National Laboratory.«
Donald Ingham hatte sich auf das Gespräch beim Präsidenten sorgfältig vorbereitet, jedenfalls so gut, wie das innerhalb eines halben Tages und einer Nacht möglich gewesen war. Sein Chef Brent Scowcroft, der Berater des Präsidenten für Fragen der nationalen Sicherheit, hatte ihn sehr kurzfristig mit diesem Fall beauftragt und ihn gebeten, die Fakten im Oval Office selbst vorzutragen. Er blickte in den Spiegel über dem kleinen Handwaschbecken in der Ecke seines Zimmers, fand, daß er schlecht aussah, kämmte sich, zog seine Krawatte hoch und tröpfelte ein paar Tropfen in die durch Übermüdung und Zigarettenqualm schon stark geröteten Augen. Die Bananen wirkten. Sein Magenknurren hatte tatsächlich aufgehört. Der Assistent des Sicherheitsberaters spürte nur noch ein leichtes Drücken, aber das konnte auch die Nervosität sein.
Es war 9.45 Uhr.
Es ging über die verwinkelten Treppen und Flure des Verwaltungsgebäudes und über den Asphaltparkplatz, der früher eine Straße zwischen den beiden Gebäuden gewesen war, zum Westflügel des Weißen Hauses. Noch immer ergriff ihn ein heimliches Staunen: er, Donald Ingham, Enkel des Stahlarbeiters Murray Ingham aus Pittsburgh, Sohn des Automechanikers Lou Ingham aus Detroit, betrat wie selbstverständlich das Machtzentrum der westlichen Welt. Wie immer führte ihn einer der Sicherheitsleute über den weichen, weinroten Velourteppich zum Büro des Sicherheitsberaters. Scowcroft, so sagte die Sekretärin, sei bereits im Oval Office. Er werde dort schon erwartet. Sie gingen eilig weiter, am Büro des Vizepräsidenten und am nebenan liegenden Eckzimmer des Stabschefs des Weißen Hauses vorüber, folgten dem Flur links herum, passierten den »Roosevelt-Konferenzraum« und die Bibliothek des Präsidenten und bogen wieder links ab. Nach vierzig Schritten blieb der Sicherheitsbeamte am Eingang zum Vorzimmer des Oval Office stehen. In der Brusttasche seines dunkelblauen Jacketts piepte ein bleistiftdünnes Funkgerät. Darunter trug der Mann seine automatische Dienstwaffe in einem Holster. Als sich die Tür öffnete, nahm er Haltung an, nickte knapp, wünschte Ingham einen guten Tag und ging zurück zum Empfang.
Zwei Minuten vor zehn stand Donald Ingham im Vorzimmer des Präsidenten. Es war ihm unangenehm, daß sein Chef vor ihm da war. Brent Scowcroft unterhielt sich bereits mit John Sununu, dem Stabschef des Weißen Hauses. Es ging offenbar um den bevorstehenden Besuch des saudischen Königs Fahd.
»Hello Don, pünktlich wie immer!« sagte Scowcroft wohlwollend und stellte ihn vor. »John, das ist Donald Ingham, mein Mann für German Affairs .«
»Da haben Sie ja im Moment wohl viel Arbeit«, sagte der Stabschef und klopfte ihm im Vorübergehen jovial auf die Schulter. Die Sekretärin des Präsidenten reichte ihm drucklos ihre Hand und sagte, schon wieder zu Scowcroft gewandt: »Ihr könnt gleich reingehen, Brent.«
Der 64 Jahre alte Brent Scowcroft, früher Generalleutnant der Air Force, war neben dem Stabschef der einzige Mann im Weißen Haus, der jederzeit und ohne Voranmeldung den Präsidenten sprechen konnte. Er galt als der engste Vertraute und Freund des Präsidenten. Scowcroft war einer der erfahrensten Männer in Washington: Bereits Mitte der siebziger Jahre hatte er Präsident Gerald Ford als Sicherheitsberater gedient – zur selben Zeit, als George Bush Chef der CIA war. Seither kannten und schätzten sich die beiden Männer. Unter der Regierung Nixon amtierte Scowcroft als Stellvertreter von Henry Kissinger, des prominentesten Sicherheitsberaters der jüngeren US-Geschichte. Beide gehörten zu den gemäßigteren Konservativen in der Republikanischen Partei, beide galten als konsequente Manager der Macht, nicht als Visionäre. »Er ist ein Freund. Er kennt sich im Weißen Haus aus, und er weiß, wie der Kongreß und wie die Geheimdienste arbeiten«, hatte Bush über Scowcroft gesagt, als er ihn zum Nationalen Sicherheitsberater ernannte.
Für Donald Ingham war der rundliche, stets jovial scheinende, aber im Ernstfall knallharte Scowcroft nicht nur Chef, sondern auch väterlicher Freund. Scowcroft und Ingham kannten sich seit drei Jahren, seit der ehemalige General als führendes Mitglied der sogenannten Tower-Kommission die für die Reagan-Regierung folgenschwere Iran-Contra-Affäre untersucht hatte. Ingham war damals bei der CIA und versorgte Scowcroft in monatelanger, intensiver Zusammenarbeit mit wertvollen internen Informationen und Enthüllungen über Oliver North und dessen dubiose Aktionen am Rande und außerhalb der Gesetze. Und als Scowcroft von George Bush zum Nationalen Sicherheitsberater berufen wurde, erinnerte er sich an den arbeitsamen und loyalen Ingham und machte den Yale-Absolventen zu einem seiner Assistenten. Sein Gehalt bezog Ingham nach wie vor von der CIA. Er war vom Geheimdienst an das Weiße Haus ausgeliehen, so wie zahlreiche Experten des Pentagon und anderer Behörden zum Dienst beim Präsidenten vorübergehend abgestellt werden – sogar die meisten Gemälde im Weißen Haus sind nur Leihgaben und stammen aus der »National Gallery of Art«.
Читать дальше