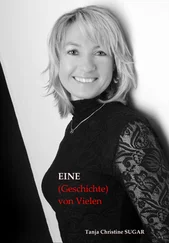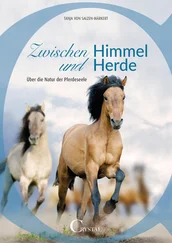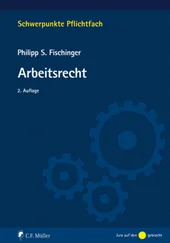Ausnahmen von den oben dargestellten Grundsätzen gelten bei AN über 52 Jahre, anderslautenden tarifvertraglichen Regelungen und bei Unternehmensgründungen.
Tipp:Wird Ihr sachgrundloser Vertrag verlängert, sollten Sie genau prüfen, ob hierin nicht auch geänderte Arbeitsbedingungen festgeschrieben werden. Ist dies der Fall, sollten Sie umgehend Entfristungsklage erheben.
•Änderung von Arbeitsbedingungen, einseitige
•Direktionsrecht
•Schwellenwerte
Fallbeispiel:
Die sechsjährigen Kinder Tim, Kevin und Noah haben von einem schlecht einsehbaren Teil des Kindergartengeländes aus Steine auf außerhalb geparkte Fahrzeuge geworfen und diese dadurch beschädigt. Die Steine hatten sie vorher – ebenfalls unbemerkt – von einem anderen Teil des Geländes zusammengetragen. Das erkennende Gericht geht von einer Aufsichtspflichtverletzung der Gruppenleiterin Marita M. aus und führt dazu aus: Kinder, die sich in einer Gruppe auf dem Außengelände eines Kindergartens aufhalten, dürfen nicht über einen längeren Zeitraum (hier 15 bis 20 Minuten) unbeaufsichtigt bleiben. Kinder müssen zwar nicht auf „Schritt und Tritt“ beaufsichtigt werden – es ist aber gerade bei Kindergruppen mit Gefahrenlagen zu rechnen, die bei einzelnen Kindern nicht zu erwarten sind. Deshalb ist bei Kindergruppen stets eine engmaschige Kontrolle im Abstand von wenigen Minuten geboten.
In einem Kindergarten haftet doch die GUV für alles – oder nicht?
Der Schaden an den parkenden Pkw wird nicht von der GUV übernommen, da diese nur Personenschäden von in der Einrichtung betreuten Kindern und anderen Besuchern der Einrichtung übernimmt. Der Versicherungsschutz bezieht sich nämlich nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 SGB VII auf „Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz begründenden Tätigkeit.“ Bei Steinwürfen auf parkende Pkw handelt es sich aber weder um Unfälle noch gehören die Eigentümer der Pkw zum versicherten Personenkreis.
Für Schadensereignisse, die nicht in den Haftungsbereich der GUV fallen, schließt der Träger einer Einrichtung in aller Regel eine Betriebshaftpflichtversicherung ab, die das Regressrisiko bei allen Schäden abdeckt, die im Zusammenhang mit der Führung der Einrichtung oder der pädagogischen Arbeit Kindern und Dritten schuldhaft zugefügt wird. Für alle Fälle, die nicht hierunter fallen, ist der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ratsam.
Tipp:Ob der Träger eine solche Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat (bei kirchlichen Einrichtungen und einzelnen Trägerverbänden werden häufig sog. Sammelhaftpflichtversicherungen abgeschlossen), sollten Sie vor Arbeitsantritt unbedingt prüfen. Liegt keine solche Betriebshaftpflichtversicherung vor, können und sollten Sie sich über eine Berufshaftpflichtversicherung absichern.
•Entlassung wegen verletzter Aufsichtspflicht
•Haftung des AG
•Haftungsprivileg
17.Beschäftigtendatenschutz
Fallbeispiel:
Marie K. ist die neue Mitarbeiterin in der Einrichtung „Kükennest“ in kommunaler Trägerschaft ihrer Gemeinde. Heute erhält sie per Post ein umfangreiches Formularpaket, das sie ausfüllen und zurücksenden soll. Neben dem Bewerbungsfragebogen muss sie auch den Personalbogen ausfüllen, sämtliche Schul- und Ausbildungszeugnisse beibringen, außerdem ein Führungszeugnis nach § 30a BZRG, ein ärztliches Attest zum Impf- und Immunitätsstatus, ihre Lohnsteuerkarte, ihren Sozialversicherungsausweis und eine Mitgliedsbescheinigung ihrer Krankenkasse. Sie soll Angaben zur Vermögensbildung machen und ihr Gehaltskonto angeben, eine Schweigepflichts- sowie eine Datenschutzerklärung abgeben und sich zur Zusatzversorgungskasse anmelden. All diese Daten wandern in ihre Personalakte.
Wo steht denn eigentlich geschrieben, was mein AG alles über mich wissen darf?
Nach Ansicht des Bundesinnenministeriums waren die bestehenden Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz vielfach nicht ausreichend, jedenfalls aber zersplittert und unübersichtlich. Das BDSG konnte danach aufgrund seiner allgemeinen Natur die vielfältigen Fallgestaltungen der Arbeitswelt insbesondere im Hinblick auf die Anwendung neuer Kommunikationstechnologien und weiterer technischer Entwicklungen nicht im Einzelnen abbilden. Nach langem Hin und Her hat die Bundesregierung jüngst von einer Regelungsbefugnis Gebrauch gemacht, den ihr eine Öffnungsklausel in der DSGVO beschert hatte: Das neue BDSG (BDSG-neu) führt in § 26 zahlreiche Neuregelungen zum Beschäftigtendatenschutz ein. Darin werden beispielsweise die spezifischen datenschutzrechtlichen Vorgänge wie etwa die Erhebung von Daten anlässlich einer Einstellung (wie im Fallbeispiel) gesetzlich festgelegt und dem Einwilligungserfordernis besonders Rechnung getragen.
Tipp:Will Ihr Arbeitgeber ein Mitarbeiterfoto auf seiner Homepage, auf Social-media-Plattformen oder in Imagebroschüren (Konzeption) veröffentlichen, bedarf er dazu Ihrer Einwilligung. Er muss Sie auch – schriftlich – darauf hinweisen, dass sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen können und die Verweigerung der Einwilligung keinerlei negative Folgen für Sie hat.
•Beschäftigungsverbot
•Grundrechte im Arbeitsrecht
•Mitarbeiterüberwachung
Fallbeispiel:
Sabine B. ist Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte „Bienenhaus“. Seit einigen Tagen schon beobachtet sie, dass eine der Gruppenleiterinnen regelmäßig an morgendlicher Übelkeit leidet. Sie führt dies auf eine bestehende Schwangerschaft zurück und fragt sich, ob sie die Mitarbeiterin darauf ansprechen soll und darf.
Wann kommt ein Beschäftigungsverbot in Betracht?
Schwangere und stillende Mütter, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, sind durch das Gesetz über den  Mutterschutz und eine Reihe weiterer nationaler und supranationaler Regelungen vor Gefahren, Überforderung, Gesundheitsschäden und finanziellen Einbußen geschützt. Der AG ist verpflichtet, bei Bekanntwerden der Schwangerschaft eine sofortige
Mutterschutz und eine Reihe weiterer nationaler und supranationaler Regelungen vor Gefahren, Überforderung, Gesundheitsschäden und finanziellen Einbußen geschützt. Der AG ist verpflichtet, bei Bekanntwerden der Schwangerschaft eine sofortige  Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes durchzuführen. Werden hierbei Gesundheitsgefährdungen für Mutter und Kind festgestellt, sind umgehend verschiedene, dem Gefährdungspotential entsprechende abgestufte Maßnahmen bis hin zum Beschäftigungsverbot zu ergreifen.
Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes durchzuführen. Werden hierbei Gesundheitsgefährdungen für Mutter und Kind festgestellt, sind umgehend verschiedene, dem Gefährdungspotential entsprechende abgestufte Maßnahmen bis hin zum Beschäftigungsverbot zu ergreifen.
Das Mutterschutzgesetz normiert in § 3 MuSchG ein sog. individuelles Beschäftigungsverbot. Danach dürfen Schwangere an ihrem Arbeitsplatz nicht weiter beschäftigt werden, wenn dadurch das Leben oder die Gesundheit von Mutter oder Kind gefährdet ist. Die Schwangere soll sofort aufhören zu arbeiten, wenn, wie das OVG Koblenz in seiner Entscheidung vom 11. 9. 2003 – Az. 12 A 10856/03 –, NZA-RR 2004 S. 93, ausführt:
„auch nur das kleinste Risiko für sie oder das Kind besteht. Hinsichtlich des Ausmaßes der anzunehmenden Gefährdung muss dabei beachtet werden, dass die Beschäftigungsverbote des Mutterschutzgesetzes Instrumente der Gefahrenabwehr darstellen. Für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts folgt hieraus nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechts der Gefahrenabwehr, dass diese umso größer sein muss, je geringer der möglicherweise eintretende Schaden ist, und dass sie umgekehrt umso kleiner sein darf, je schwerer der etwaige Schaden wiegt (vgl. BVerwGE 62, 36 [39]; BVerwGE 88, 348 [351] = NVwZ-RR 1992, 516). Sofern ein besonders großer Schaden für besonders gewichtige Schutzgüter im Raum steht, reicht für die Bejahung einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit bereits die entfernt liegende Möglichkeit eines Schadenseintritts. Die zuletzt genannte Situation ist bei den mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverboten gegeben, da hier die Schutzgüter des Lebens und der Gesundheit von Mutter und Kind und damit Rechtsgüter von sehr hohem Rang im Raum stehen (ebenso BVerwG [27. 5. 1993], NJW 1994, 401).“
Читать дальше
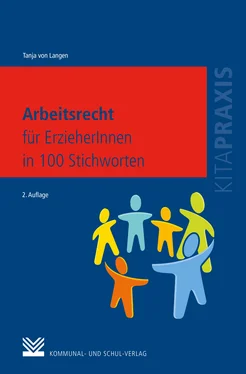
 Mutterschutz und eine Reihe weiterer nationaler und supranationaler Regelungen vor Gefahren, Überforderung, Gesundheitsschäden und finanziellen Einbußen geschützt. Der AG ist verpflichtet, bei Bekanntwerden der Schwangerschaft eine sofortige
Mutterschutz und eine Reihe weiterer nationaler und supranationaler Regelungen vor Gefahren, Überforderung, Gesundheitsschäden und finanziellen Einbußen geschützt. Der AG ist verpflichtet, bei Bekanntwerden der Schwangerschaft eine sofortige