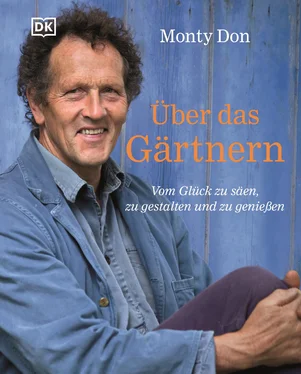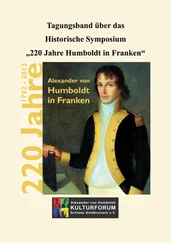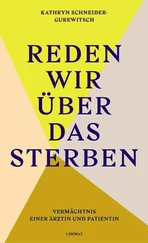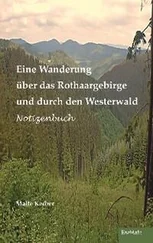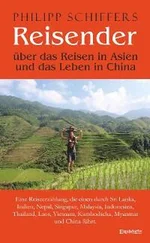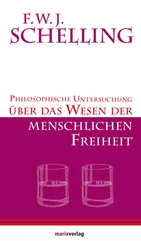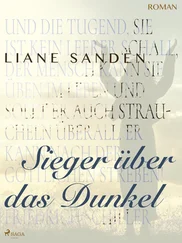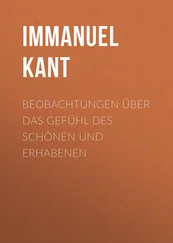Die Amerikaner nennen den Herbst fall . Dieses Wort bringt, wie ich finde, die Jahreszeit mit ihren fallenden Blättern gut zum Ausdruck. Das Ausmaß der Farbenpracht hängt vom spätsommerlichen Wetter ab. Heiße Tage und kalte Nächte regen die Bäume zur Bildung von kohlenhydratähnlichen Substanzen an, die für die rote Pigmentierung zuständig sind. Die Blätter verwandeln Stärke in Zucker, mit dem der Baum versorgt wird. Aber kalte Nächte verhindern, dass er vom Blatt zu den Wurzeln zurücktransportiert wird. Die Konzentration von Zucker färbt Laub rot. Zersetzt sich das grüne Chlorophyll, kommt dieses Rot zum Vorschein. Je größer der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur, je heißer also die Tage Ende Juli und Anfang August, desto stärker leuchtet das Laub.
Anders verhält es sich bei gelbem Laub. Seine Farbe ist im Wesentlichen auf den Abbau von Chlorophyll zurückzuführen. Dadurch kommt das Gelb zum Vorschein, das schon immer da war. Bäume mit gelbem Sommerlaub wachsen immer langsamer als solche mit grünen Blättern, denn sie bekommen weniger Zucker und Stärke, die mithilfe des grünen Chlorophylls produziert werden.

Jedes abgefallene Blatt wird aufgesammelt und kommt in einen Drahtkäfig, wo es sich zu Humus zersetzt.
Das Laub fällt vom Baum, wenn sich die Zellen zwischen Blattstiel und Zweig zersetzen. Es bildet sich ein Schorf auf der Wunde, der den Baum vor Infektionen schützt. Manche Bäume können dieses Narbengewebe nicht bilden und werfen ihr Laub daher erst ab, wenn es von den neuen Blättern im Frühjahr beiseite geschoben wird. Deshalb behalten Rot- und Hainbuche ihre braunen Blätter den Winter über. Pappeln, Birken und Weiden werfen sie früh ab, Eichen wiederum erst im Dezember.
Laubhumus kann man nie zu viel haben. Er enthält wenig Nährstoffe, ist jedoch ein ausgezeichneter Bodenverbesserer vor allem für schwere Böden, eine wertvolle Ingredienz in Komposthaufen und ein guter Mulch für Waldpflanzen.
Seltsamerweise ist noch niemand auf die Idee gekommen, ihn gewerbsmäßig herzustellen, obwohl nichts dagegen spricht. Schließlich ist es wesentlich einfacher, abgefallene Blätter aufzusammeln, als seltene Torfmoore zu zerstören und abgepackt zu verkaufen.
Guter Kompost muss aus einer Mischung verschiedenster Substanzen bestehen und regelmäßig gewendet werden. Laubhumus anzusetzen dagegen ist ein Kinderspiel. Gartenkompost entsteht durch ein Zusammenwirken von Bakterien, Pilzen, Wirbellosen und Insekten unter dem Einfluss von Wärme und Sauerstoff, weshalb man ihn wenden muss. Bei Laubhumus sind größtenteils Pilze am Werk; außerdem läuft die Zersetzung »kalt« ab, weil die Pilze keine Wärme brauchen, um sich ins Zeug zu legen. Man sammelt einfach Laub von sommergrünen Gehölzen auf, sorgt dafür, dass es ordentlich feucht ist, deponiert es, und schon nimmt die Verrottung ihren Lauf.
Wenn der Boden trocken genug ist, kann man die Blätter auch durch Mähen aufsammeln. Das ist sogar eine glänzende Idee, denn dabei werden sie schon zerkleinert, brauchen weniger Platz und zersetzen sich zugleich rascher. Ich bereite inzwischen fast unser ganzes Herbstlaub so auf. Dazu streue ich es auf einen langen Backsteinweg im Garten, stelle den Mäher auf höchste Stufe und »mähe« den Weg, sodass die Blätter im Fangkorb landen.
Dann werfe ich es in einen großen, mit Maschendraht umzäunten Käfig, wo es eine möglichst große, exponierte Oberfläche hat. In den meisten Jahren regnet es genug, sodass es immer feucht bleibt, aber wenn es einmal zu trocken ist, sprenge ich es monatlich mit dem Gartenschlauch. Bis zum Oktober des folgenden Jahres wird auf jeden Fall perfekter Laubhumus daraus. Ich fülle den Inhalt in Säcke und nutze ihn als Mulch oder Bestandteil unserer selbstgemischten Topferde. Nun ist der Drahtkäfig wieder leer und bereit für die nächste Füllung im Herbst.
Natürlich sind die meisten Gärten nicht groß genug für einen solchen Drahtkäfig. In diesem Fall stopft man die Blätter einfach in einen großen schwarzen Plastiksack und dreht ihn zu, ohne ihn zuzubinden. Die Blätter müssen beim Einfüllen richtig feucht sein; stechen Sie ein paar Löcher in den Boden des Sacks, damit Wasser ablaufen kann. Dann verstauen Sie die Säcke hinter einem Schuppen oder in einer anderen Ecke. Binnen eines Jahres verwandelt sich der Inhalt in weiches, krümeliges Material, das ein bisschen wie ein Waldboden an einem sonnigen Herbstnachmittag duftet.
Den meisten Menschen mag ein milder Winter lieber sein, unsere Gärten indes sind wesentlich gesünder, wenn sie ein paar Monate eisige Kälte abbekommen. Frost bricht Erdklumpen auf und verwandelt sie in feine Krümel. Vor allem aber setzen lange anhaltende Minusgrade den vielen Dutzend Pilzsporenarten, die unseren Garten bei feuchtwarmer Witterung heimsuchen, ordentlich zu. Sogar Blattläuse und Schnecken werden dadurch dezimiert. Ein Monat anhaltende Kälte im Garten vernichtet mehr Schädlinge und Krankheiten als eine Wagenladung Chemikalien.
Dem Gärtner erleichtert gefrorener Boden das Leben. Denn Frost macht Schlamm zu einer festen Masse. Man kommt trockenen Fußes über matschige Erde und kann ganze Schubkarrenladungen voll Mist und Unkraut bequem darüberschieben.
Natürlich hat Frost seinen Preis. Die relativ empfindlichen Pflanzen wie Salbei, Bartfaden ( Penstemon ), Honigstrauch ( Melianthus ), Jasmin, Kamelien und Lorbeer, die viele von uns in den Rabatten haben, überstehen Temperaturen unter -5 °C nicht. Andere dagegen – dazu gehört Knoblauch ebenso wie Primeln – brauchen sogar eine Kälteperiode, damit sie im Frühjahr austreiben oder keimen.
Dicker Schnee isoliert ausgezeichnet und schützt Pflanzen unter seiner Decke.
Die meisten Gartenpflanzen unserer Breiten haben wirkungsvolle Strategien gegen die Kälte entwickelt. Sommergrüne Bäume und Sträucher werfen ihr Laub ab und stellen mit Ausnahme der Faserwurzeln ihr Wachstum ein. Stauden überleben gefrorenen Boden, weil sie in eine Art Winterschlaf treten. Einjährige sterben zwar, hinterlassen jedoch Unmengen von Samen, die die Kälte überstehen und im Frühjahr austreiben. Auch Zweijährige machen sich winterfest, um im kommenden Frühjahr so richtig loszulegen.
Dicker Schnee isoliert ausgezeichnet und schützt Pflanzen unter seiner Decke. Zudem ist er ein wichtiger Wasserlieferant, denn wenn er taut, versickert er langsam im Boden. Er kann aber auch viel Schaden anrichten. Vor allem Formschnittgehölze können durch sein Gewicht Schaden nehmen. Man muss sie deshalb von der Last befreien – jedoch nicht, ohne sie vorher mit ihrer bezaubernden weißen Haube in einem Foto zu verewigen.
Extreme Kälte an sich ist aber nicht das größte Problem im Winter, sondern Kälte in Kombination mit Wind und Nässe. Dieses Trio kann sogar an sich winterharten Gewächsen in Gärten zusetzen. Schon ein Wind mit 30 km/h – offiziell als »frischer Wind« bezeichnet – macht aus Temperaturen um den Gefrierpunkt -7 °C und aus -5 °C knackige -13 °C, was einige Gartenpflanzen bereits in den roten Bereich bringt. Ein gutes Bollwerk dagegen sind Hecken, Sträucher oder sogar vorübergehend aufgestellte Netze, die den Wind filtern. Das Mikroklima in einem Garten kann beträchtlich variieren, sodass manchmal selbst nicht winterharte Arten Temperaturen überleben, die sie eigentlich ins Jenseits befördern müssten, wenn sie – und das ist der springende Punkt – geschützt stehen.
Besonders windgefährdet sind immergrüne Pflanzen, denn sie verlieren ständig Wasser. Bei kaltem, trockenem Wind wird dieses Wasser nicht ersetzt. Deshalb ist es gar nicht einmal so selten, dass eigentlich als winterhart geltende Gewächse wie Buchsbaum oder manche Stechpalmen braune Blätter bekommen oder sogar ganz vertrocknen, vor allem auf Dachgärten. Das kann ganz schnell gehen, wenn der Boden, in dem sie wachsen, gefroren ist, da die Wurzeln dann kein Wasser aufnehmen können. Der beste Winterschutz für sie ist das Besprühen mit Wasser: Es gefriert und bildet dadurch eine Art Schutzschicht um die Blätter.
Читать дальше