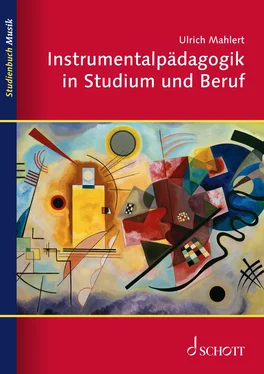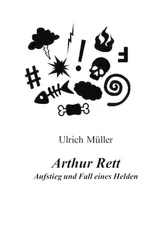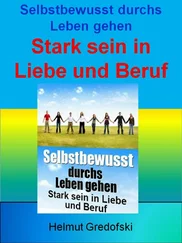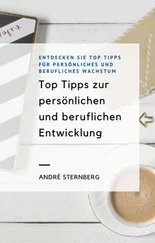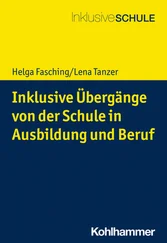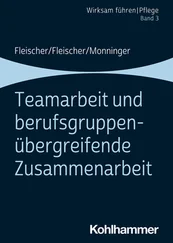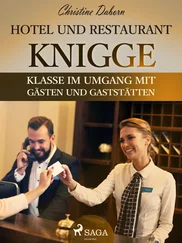Kammermusik mit meinem älteren Bruder und diversen Freunden erweiterten den Radius meines Musizierens und führten zu neuen Freundschaften, sodass ich am Klavier nicht einsam blieb. Das riesige, unerhört reichhaltige Repertoire der Klavier- und Kammermusikliteratur erzeugte fortwährend Lust, Neues zu erschließen, und ließ mich doch einsehen, wie begrenzt meine Auswahl und meine Kenntnisse bleiben würden.
Im Studium, besonders in musikwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen, lernte ich mir bis dahin weitgehend unbekannte Musik kennen: verschiedene Richtungen Neuer Musik vor allem, auch Musik des Mittelalters und der Renaissance. Besuche in Donaueschingen, »Musica viva«-Konzerte in Freiburg, Mitwirkung bei Hochschulkonzerten mit Neuer Musik brachten neue Erfahrungen. Sehr anregend waren Gruppenimprovisationen mit Kommilitonen. Es faszinierte mich, eingebunden zu sein in ein adhoc entstehendes musikalisches Geschehen, Mitspieler spüren zu lassen, dass ich ihre Impulse wahrnehme, gleichermaßen musikalisch und sozial zu kommunizieren.
An Intensität und persönlicher Bedeutung aber blieben diese Aktivitäten doch hinter den immer neuen Erkundungen und Eroberungen des »klassischen« Repertoires zurück, das im Mittelpunkt des Klavierstudiums stand. Klavierüben, Proben und Spielen von Kammermusik in verschiedenen Besetzungen, nicht zuletzt Liedbegleitung nahmen breiten Raum ein und sind mir bis heute unverzichtbare Bedürfnisse. In dieser Musikpraxis bin ich musikalisch zu Hause. Andere Praxisfelder sind letztlich weiter abliegende Regionen geblieben. Hauptsächlich habe ich mich mit ihnen beschäftigt, um auf dem Laufenden zu bleiben, nicht zuletzt auch, um zumindest ein wenig von dem zu kennen, was Studierenden neben dem klassischen Repertoire wichtig ist, was sie auch betreiben wollen, ihnen aber oft im Studium vorenthalten bleibt. Ein paar Stunden Klavierimprovisation bei meinem ehemaligen Kollegen und Freund Herbert Wiedemann machten mir klar, dass dies nicht wirklich mein »Metier« ist und meine Anstrengungen nicht weit führen würden. Auch habe ich bestimmte musikpraktische Techniken geübt, weil sie zum musikpädagogischen Handwerk gehören (z. B. Bodypercussion und Solmisation). Begeisterung haben solche Bemühungen allerdings kaum je geweckt. In späteren Jahren habe ich Horn gelernt, um auch im Musizieren etwas über das Klavier hinauszukommen. Durch mehrere China-Aufenthalte entstand Interesse an traditioneller und aktueller chinesischer Musik.
Eine erhebliche Erweiterung meiner Repertoirekenntnisse ergab sich, als ich nach meiner Promotion in Musikwissenschaft ein Jahr als Redakteur im Bereich »Sinfonie und Oper« beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden arbeitete und danach weitere sieben Jahre als freier Mitarbeiter dieses Senders regelmäßig Sendungen mit Besprechungen neuer Schallplatten moderierte. Der Wortanteil der Sendungen war beträchtlich, sodass ich relativ differenziert auf die einzelnen Aufnahmen eingehen konnte. Ich beschäftigte mich gründlich mit den von mir zusammengestellten Stücken, und bei der Kritik war mir wichtig, den Hörern interpretatorische Qualitäten oder Defizite nicht geschmäcklerisch, sondern mit den Ansprüchen der jeweiligen Musik zu begründen. Durch diese Arbeit lernte ich Fähigkeiten im Gebiet, das später »Musikvermittlung« genannt wurde. Allerdings führten mich auch diese Erweiterungen von Kenntnissen und Fähigkeiten letztlich nicht über den Horizont der abendländischen Kunstmusik hinaus. Musik aus anderen Kulturen, die Vielfalt des Jazz, der mich oft fasziniert, blieben Randbereiche.
Die Begrenztheit meiner Potenziale zur Identifizierung mit diversen Musiken habe ich in der Lehre immer wieder als Hypothek empfunden. Mit ihr konnte ich mein Ideal, viele Fenster zu vielen Musiken hin zu öffnen, nur partiell authentisch verwirklichen. Weitgehend blieb meine musikpädagogische Beschäftigung mit Musikstücken bzw. deren Einbeziehung in musikpädagogische Zusammenhänge auf mir näherstehende Musikrichtungen beschränkt (freilich mit Einbeziehung des Repertoires verschiedener Instrumente, die die Studierenden spielten) sowie auf Improvisationsübungen in Gruppen. Ich lernte, mich zu meinen Grenzen zu bekennen, und vor allem das zu tun, was ich gut konnte. Mir schien, dass Studierende von dieser Authentizität mehr profitieren als von angestrengten, möglicherweise bemüht wirkenden Grenzüberschreitungen.
Begeisterung ist ein hoher Wert, sie zieht andere mit. Wenn Studierende mir unvertraute Musik in den Unterricht einbrachten, wechselte ich meine Rolle, verzichtete auf Instruktion und verlegte mich darauf, mitzulernen, Fragen zu stellen und von meiner Warte aus mögliche Anregungen zu geben. Ich ehrte die Kompetenz, die die Studierenden mir voraushatten. Vielleicht kam durch dieses Verhalten, mich in einer nicht geläufigen Musikpraxis vor allem als Fragender zu bewegen, doch das eine oder andere in Gang – auch bei Studierenden, die in dieser Praxis zu Hause waren. Nur so kann ich mir erklären, dass manche Jazz-Studierende mir Jahre später sagten, wie sehr ihnen diese und jene Lehrveranstaltung, in die sie »ihre« Musik eingebracht hatten, gefallen hätte und dass sie dort viel gelernt hätten.
Genauigkeit, Gründlichkeit
Genauigkeit und Gründlichkeit in wissenschaftlicher Arbeit habe ich wohl vor allem durch Hans Heinrich Eggebrecht gelernt. »Ich lese nicht viel, aber was ich lese, lese ich gründlich.« – »Ich schreibe sehr langsam. Ich schreibe immer wieder um, bis der gemeinte Gedanke herauskommt und ich zufrieden bin.« Solche Aussagen von ihm haben mich als Student beeindruckt. In Vorlesungen und Seminaren konnte Eggebrecht einzelne Sätze aus musikwissenschaftlicher Literatur so genau und aufschlussreich reflektieren, dass die Studierenden Lehrstücke in der Kunst erhielten, Gedankenführung, Denkmuster, Beweggründe, inhärente Urteile und Vorurteile sowie ideologische Implikationen von Texten sorgfältig freizulegen. Wir merkten, was wir beim eigenen Lesen alles nicht gemerkt hatten. Oft hatten wir nur die Oberfläche von Aussagen wahrgenommen und uns damit zufriedengegeben. Eggebrecht bohrte in den Sätzen, bis ihre gedankliche Substanz deutlich wurde. In Vorlesungen – oft über Themen, über die er selbst gerade schrieb – ließ er uns an seiner Beschäftigung mit dem jeweiligen Gebiet und an den Fragen, die sich ihm dabei stellten, teilnehmen. Immer regte er zum Diskutieren über das Vorgetragene an. Mehr noch als Zustimmung wollte er »Contra« bekommen und dabei sehen, ob er im Schreiben die bei den Studierenden auftauchenden Einwände, Bedenken und Fragen mitbedacht hatte.
Texte von Dissertationen, die bei ihm geschrieben wurden, las Eggebrecht sehr genau. Er verlangte immer Teile im Umfang von jeweils 20 Seiten – nicht mehr, weil er eine so begrenzte Textmenge in der Regel in einer Arbeitssitzung schaffte. Seine vielen Korrekturen, aber auch offenen Erwägungen notierte er mit Bleistift am Rand. Er verstand sie, wie er mir zu meiner ersten »Lieferung« schrieb, als Gedanken eines Begleiters, der die Materie nicht so gut kannte wie ich selbst (ich schrieb bei ihm über Liedästhetik um 1848 und späte Schumann-Lieder), dem aber – vielleicht gerade deswegen – beim Lesen mancherlei möglicherweise für mich nützliche Fragen kamen. Durch dieses intensive Lesen und seine differenzierten Rückmeldungen habe ich sehr viel gelernt.
In meiner späteren Arbeit im Fach Musikpädagogik / Allgemeine Instrumentaldidaktik wirkte sich dieser Lerngewinn nicht immer nur angenehm aus. Aufgrund meiner internalisierten Ansprüche litt ich doppelt unter dem oft schwachen, bisweilen miserablen Niveau von Seminar- und teilweise auch von Abschlussarbeiten. Viele Jahre konnte ich nicht anders, als alle Fehler und Schwächen nach dem Vorbild Eggebrechts zu korrigieren und Vorschläge zur Verbesserung von verfehlten Formulierungen zu notieren. Irgendwann merkte ich, dass mich diese Arbeit über Gebühr belastete. Die Kraft und die Zeit, die ich aufwendete, standen nach meinem Eindruck in keinem angemessenen Verhältnis zur erreichbaren Wirkung. Zwar waren die Studierenden dankbar für meine Korrekturen, aber folgende Seminararbeiten zeigten durchaus nicht immer ein von mir nun erwartetes höheres Niveau. Ich beschloss und lernte mich damit abzufinden, dass die Qualitätsansprüche in einem musikwissenschaftlichen Promotionsstudium sich für das »Beifach« Musikpädagogik / Allgemeine Instrumentaldidaktik nicht einfordern lassen. Anders bei Promovenden im Fachgebiet Musikpädagogik: Mit ihnen konnte und kann ich sowohl in den Colloquien wie auch bei der Lektüre von Dissertationstexten intensive Textarbeit im Lesen und Schreiben praktizieren.
Читать дальше