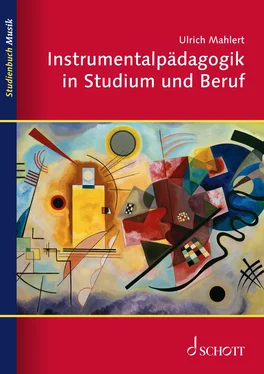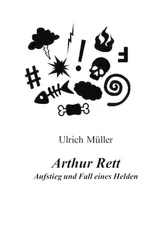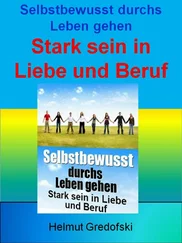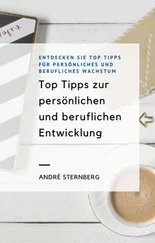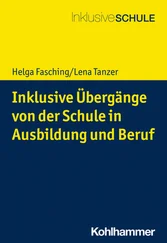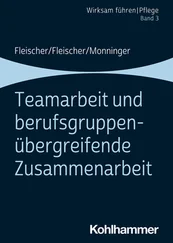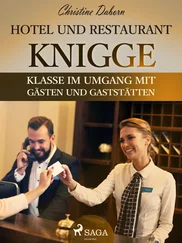Nun also einige Punkte meiner persönlichen beruflichen Selbstdiagnose mit Gedanken zu ihrer Vermitteltheit. Nur wenige besonders prägende Personen möchte ich ansprechen – Lehrer vor allem. Ich verzichte darauf, näher ins Familiäre zu gehen, obwohl sicher mancherlei beruflich relevante Motive durch meine Eltern, Brüder und das »Klima« in der Familie beeinflusst wurden.
Mitte der 1950er Jahre, vor meiner Schulzeit und bevor ich selbst mit dem Musizieren begann, hörte ich zu Hause am Schallplattenapparat (befindlich in einer gediegenen »Musiktruhe«) viel Musik – hauptsächlich klassische, daneben auch etwas Unterhaltungsmusik, die dem damaligen Geschmack meiner Eltern entsprach. Es gab zu Hause ein Musiklexikon mit Bildern vieler Komponisten. Ich sah sie mir oft an und ließ mir die Namen vorlesen. Bald kannte ich sie alle und konnte die Komponisten den gehörten Musikstücken zuordnen. Der Einstieg ins Klavierspiel, mit dem ich im Alter von neun Jahren auf Wunsch meiner Eltern begann, fiel mir schwer. Ich empfand ein Missverhältnis zwischen meinem bereits erworbenen Wissen über Musik und den dürftigen und mühsamen Exerzitien. Im Kopf, beim Hören von Musik, war ich ästhetisch weiter als beim Spiel der mir aufgenötigten simplen Übungen und Stücke.
Erst als ich Originalwerke mir bekannter »großer« Komponisten spielen konnte, gewann das Klavierspiel für mich an Bedeutung. Stücke von Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Debussy, Bartók u. a. zu üben, bedeutete für mich mehr als ein Können zu erwerben; eher war es ein aktives »Einbilden« der Musik (ein Bildungsvorgang also), ein durch Identifizierung mit ihr gelingendes Integrieren ihrer Botschaften und Energien in die eigene, nach Orientierungen und Stärkungen suchende Persönlichkeit, eine geistige und leibliche Aneignung, die mir neue Empfindungen, Gedanken, Bewegungen, Gesten, Mienenspiele, Haltungen etc. vermittelte. Im Spielen konnte ich mich emotional und körperlich ausweiten, konnte in der Vorstellung ein anderer werden (nämlich der Komponist bzw. ein imaginäres, in der Musik sich ausdrückendes Ich) und gleichzeitig genau dadurch noch mehr »Ich« werden. Und selbst wenn das Spiel zu Ende war, empfand ich einen Zuwachs an Erfahrungen und Selbstwertgefühl, ja an persönlicher Würde. Damit gewann die Musik für mich als Kind und pubertierenden Jugendlichen eine enorme Bildungskraft.
Diese frühen musikalischen Erfahrungen sind bis heute wirksam geblieben. Sie haben den Wunsch geweckt, Musizieren als einen intensiven Bildungsvorgang zu begreifen, es in diesem Sinne selbst zu praktizieren, zu vermitteln und zu nobilitieren.
Ein Motiv für dieses Musizieren war wohl auch das Bedürfnis, mich von meinen Eltern abzusetzen, mich ihnen gegenüber in meinem Selbstwertgefühl zu stärken und aufzuwerten. Während meiner Schulzeit und auch noch danach bedrückte es mich, dass meine Eltern zwar mein Musikmachen unterstützten, die Musik ihnen aufgrund ihres begrenzten musikalischen Horizonts aber letztlich eher als schönes Beiwerk des Lebens galt. Die intensiven Erlebnisse, die sich im Musizieren ereignen können, waren ihnen weitgehend verschlossen. Bei allem Respekt, den sie meinen musikalischen Leistungen entgegenbrachten, fühlte ich mich doch nur bedingt verstanden und gewürdigt. Auch dieses Defizit spielt wohl als Impuls in mein fortwährendes Anliegen hinein, Musizieren als intensiven Bildungsvorgang zu begreifen und einsichtig zu machen.
Ein weiteres Motiv ist die Erweiterung der Bildung des Musizierenden. Zwar bilden sich Musiker wie beschrieben in ihrem Tun auch dann, wenn sie sich nicht oder nur wenig für die Hintergründe der von ihnen gespielten Musik, für Musik- und Kulturgeschichte, Analyse, verbale Interpretation, Rezeption etc. interessieren. Ich hatte (und habe) allerdings ein anderes Ideal: das des gebildeten Musikers, der sich die gespielte Musik auch intellektuell erschließen und das eigene Verhältnis zu ihr reflektieren möchte. In diesem Sinne ist Musik kein Spielmaterial, sondern eine geistige Äußerungsform neben Sprachen, Literatur, bildender Kunst, Philosophie und anderen Wissenschaften. Ich wollte wissen, was ich spiele und wie ich es tue. Das Interesse für Musikwissenschaft ergänzte und vertiefte das Bedürfnis, Musik darzustellen.
Nicht zuletzt wurden meine Idealvorstellungen von gebildeten und gebildet Musizierenden durch meine Lehrerin im Klavierstudium an der Freiburger Musikhochschule angeregt: Edith Picht-Axenfeld. Als exzellente Pianistin und Cembalistin spielte sie ein immenses Repertoire für Tasteninstrumente: von den englischen Virginalisten bis hin zu Boulez, Nono und Holliger. Auch Barmusik konnte sie improvisieren. Zudem beschäftigte sie sich intensiv mit Philosophie, Literatur und anderen Künsten. All das floss in ihren Unterricht ein, nicht dozierend, sondern mehr in behutsamen Bemerkungen, beiläufigen Anregungen, Hinweisen. Ihr Unterricht hatte ein geistiges Klima, in dem Musik in Verbindung mit diversen anderen Disziplinen stand, mit Bildungsphilosophie, Ethik, Ökologie u. a. Musikalisches und Außermusikalisches wirkten unforciert ineinander. Zusammen mit einer hervorragenden pianistischen Ausbildung erhielten ihre Schüler immer auch Impulse, gegenwärtige Lebensverhältnisse und gesellschaftliche Zukunftsperspektiven wahrzunehmen und zu reflektieren. Es ging darum, die durch Musik geweckten und sensibilisierten Sinne als Grundlage des Denkens zu begreifen. »Die Sinne entdecken, was der bloßen Reflexion unerreicht bleibt. Die Sinne denken.« (Picht 1986, S. 336) Diese für die Erfahrung von Kunst und für Pädagogik höchst bedeutungsvollen Sätze formulierte der Philosoph Georg Picht, der Mann von Edith Picht-Axenfeld. Er war langjähriger Leiter des Internats Birklehof in Hinterzarten, wo die große Familie Picht in einem alten Bauernhof wohnte. Später lehrte er Religionsphilosophie in Heidelberg. Ich erlebte ihn bei Besuchen in Hinterzarten, war beeindruckt von der ruhigen Intensität seines Denkens und Sprechens, las Schriften von ihm, z. B. den Band Die Verantwortung des Geistes (1965), darin besonders den mich nachhaltig beeindruckenden Aufsatz »Die Stellung der Musik im Aufbau unserer Bildung« (ebd. S. 151–172). Im Rückgriff auf Plato und in aktualisierender Ausrichtung führt Picht hier aus, die Musik diene »jener mittleren Sphäre zwischen Körper und Denken, in der sich die Lebenshaltung des Menschen formt und die deshalb die eigentlich ethische Sphäre ist.« (Ebd. S. 155)
Als ich meiner Lehrerin sagte, dass ich bald die Künstlerische Reifeprüfung im Fach Klavier absolvieren wolle, stimmte sie zu und überlegte: »Dann wollen Sie jetzt eine Weile leben wie ein Pianist – täglich eine Stunde Technikübungen, eine Stunde Chopin-Etüden, Üben neuer Werke, Wiederholen früher gelernter Literatur … Aber man kann ja nicht den ganzen Tag Klavier spielen. Sie sollten sich noch etwas anderes, Großes vornehmen. Vielleicht lesen Sie die Ästhetik von Hegel. Das wäre lohnend.« Keine perfektionsorientierte fachliche Begrenzung, sondern zusammen mit intensivem Musikstudium ein gründliches Nachdenken über Kunst und eine breit orientierte Bildung – dazu wollte sie mich auch in der bevorstehenden Phase des harten Trainings am Klavier anregen und ermutigen.
Zusammenhang von Kunst und Pädagogik
Musikpädagogik ist im Hochschulstudium ein wissenschaftliches Fach. Seine Inhalte sind – kurz gesagt – Musik, Musizieren und die mit ihnen verbundene Pädagogik. Wer allerdings in diesem Fach lehrt, praktiziert in seiner Lehre nicht das, worüber er lehrt. Er arbeitet auf einer Metaebene: Er lehrt über Musizieren und das Unterrichten des Musizierens. Diese Gegebenheit war für mich als Musikpädagogik-Lehrender immer ein Problem und eine »Baustelle« in der Gestaltung meiner Lehrveranstaltungen. In meiner Lern- und Lehrbiografie habe ich das Zusammenwirken von Kunst und Pädagogik so intensiv erlebt, dass ich den Zusammenhang zwischen ihnen als unauflöslich empfinde. Diese Erfahrungen stammen nicht aus der Lehre im Fach Musikpädagogik, sondern aus dem künstlerischen Unterricht. Das wenige, das ich als Studierender (im Rahmen der Ausbildung für die damalige Staatliche Musiklehrerprüfung) im Fach Musikpädagogik gelernt habe, hatte nichts mit dem Zusammenhang von Kunst und Pädagogik zu tun. Als Professor für Musikpädagogik / Allgemeine Instrumentaldidaktik hätte es nahegelegen, kraft Einsicht in den Wissenschaftscharakter des Fachs Musikpädagogik beim Lehren in diesem Fach auf das Ideal einer Verbindung von Kunst und Pädagogik zu verzichten. Das widerstrebte mir jedoch ganz und gar. Der Wunsch, Studierende zu künstlerisch wirkenden Pädagogen und pädagogisch wirkenden Künstlern heranzubilden, schloss für mich eine Beschränkung auf wissenschaftliche Lehre aus.
Читать дальше