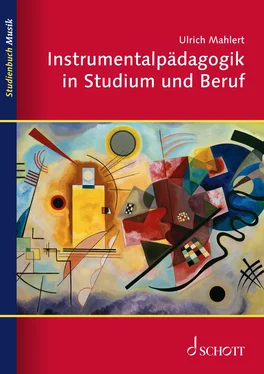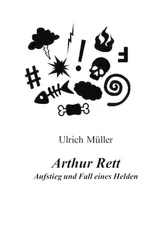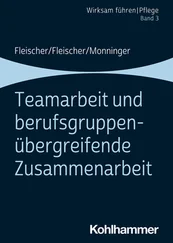Ich möchte diesen Gedanken ein wenig vertiefen. Dazu eignet sich eine seltsame Bemerkung von Goethe, die er beiläufig in einem Brief an einen Freund formuliert hat. Goethe schreibt da, man müsse »Geschehenes […] immer als eine Gottheit verehren […]; so möge das daraus Erfolgende heilsam werden!« (Brief an Sulpiz Boisserée, Tennstedt 7. August 1816, Goethe 1965, S. 362) »Geschehenes […] als eine Gottheit verehren« klingt gewaltig und befremdlich zugleich. Was meint Goethe? Geschehenes soll nicht als »Schnee von gestern« beiseitegeräumt, sondern als etwas Bedeutsames mental gehegt und gepflegt, ja wie etwas Heiliges verehrt werden. Das Geschehene ist wertvoll. Wir »verehren« es, indem wir es uns vergegenwärtigen und es meditieren. Dadurch kann »das daraus Erfolgende heilsam werden«. Im »Verehren« von Geschehenem öffnet sich unser Sinn für den Wert, der in ihm steckt und den es für unser zukünftiges Leben haben kann. Es ist ein kostbares Geschenk, dessen Wert sich im Laufe der Zeit entfaltet.
Je nachdem, wie das »Geschehene« betrachtet wird, beeinflusst es die Zukunft. Wenden wir den Gedanken auf das zurückliegende Studium und all das darin »Geschehene« an. Wenn mein Rückblicken vordergründig bleibt, kommt mir vielleicht neben vielem, was mich weitergebracht hat, manches andere als wenig nützlich oder gar überflüssig vor, als etwas, mit dem ich meine Zeit vertan habe. Vielleicht habe ich überhaupt das Gefühl, viel Zeit verplempert zu haben. Je sorgfältiger ich aber das scheinbar Belanglose, Beiläufige betrachte und bedenke, desto produktiver wird es. Dann zeigt sich: Nichts davon ist wertlos – selbst die verbummelte Zeit nicht. Vermeintliche Leerlaufzeiten waren notwendige Latenzphasen, in denen sich unterschwellig Wichtiges entwickelt hat. Mancher »Groschen« wäre ohne sie »nicht gefallen«, manche Einsicht und manche Entscheidung nicht gereift. Auch in dem vielleicht zufällig und belanglos Erscheinenden schlummern Potenziale, die im weiteren Verlauf des Lebens wichtig werden können. In sorgfältiger Rückschau merken wir oft, dass Zufälle und Nebensächlichkeiten glückliche Fügungen waren. Begegnungen mit bestimmten Menschen in bestimmten Situationen, ungeplante und unvorhersehbare Ereignisse, der Zeitpunkt ihres Eintretens zeigen sich im Nachhinein als wichtige Weichenstellungen, manchmal mit Wirkungen für das ganze Leben.
Wir können »Geschehenes« als kostbare Möglichkeit der Selbsterfahrung und -erkenntnis nutzen. Bestimmt haben Sie im Studium Stärken und Schwächen an sich entdeckt, die Sie vorher noch nicht so genau kannten. Vielleicht waren Sie überrascht, dass Ihnen manches schwer, anderes leicht fiel. Neue Interessensgebiete, ungeahnte Fähigkeiten sind hervorgetreten. Schwerpunkte haben sich verschoben, neue Optionen gebildet. Einstellungen zum Musikmachen, zum Unterrichten und zu anderen beruflichen Möglichkeiten sind im Laufe des Studiums in Bewegung geraten. Beim Vergleichen »vorher – nachher« merken Sie, was sich alles verändert hat. Diese Veränderungsfähigkeit ist eine ermutigende, mit Goethes Wort: »heilsame« Perspektive für die Zukunft. Das Geschehene ist nicht abgeschlossen, sondern offen. Es ist keine statische Verfügungsmasse, sondern ein dynamisches Potenzial. Es wartet darauf, sich zu entfalten und entfaltet zu werden.
Womöglich war auch gerade das Krumme, nicht so Tolle im Studienalltag wichtig – möglicherweise ergiebiger als ein glatt und perfekt durchlaufendes Studium. Vielleicht haben Sie dabei gelernt, sich »durchzulavieren«, Spielräume geschickt zu nutzen, für eigene Anliegen zu kämpfen, sich von Unzuträglichem zu distanzieren. All das sind wichtige Lebenskünste. Selbst wenn Sie neben Ihren vielen hervorragenden Lehrern vielleicht mit dem einen oder anderen etwas Pech gehabt haben sollten, gilt immerhin der alte Sponti-Satz: »Wir hatten schlechte Lehrer – das war eine gute Schule.« Das mag zynisch klingen. Aber auch darin liegt letztlich eine mögliche Bedeutung von Goethes Postulat, man solle »Geschehenes […] immer als eine Gottheit verehren«. Auch und vielleicht sogar gerade aus Misslichem und Misslungenem lässt sich Wichtiges lernen. Und Lernen geschieht ja letztlich sowieso immer autodidaktisch – durch die Art, wie man mit Erfahrenem umgeht.
Für mich bleibt es eine offene Frage, was eigentlich Ausbildungsziele eines Hochschulstudiums sind. Beim Diskutieren und Schreiben von Studien- und Prüfungsordnungen, zu denen wir ja immer wieder nicht zuletzt durch unsere Kultusbürokratie genötigt werden, fällt einem auf, wie sehr man notgedrungen zum Dichter wird. Um die Ziele, Inhalte und die angestrebten »Kompetenzen« in den Jargon solcher Ordnungen zu bringen, drechseln wir mühselig ungereimte Pseudo-Poesie, blumige Formulierungen, wohlklingende, aber bei Lichte besehen ziemlich hohle Versatzstücke aus dem Wörterbuch der amtlichen Bildungslyrik. Was ist beispielsweise von folgendem Satz zu halten: »Allgemeine Aufgabe der Instrumental- und Gesangspädagogik ist die Vermittlung von Musik im Sinne einer Äußerung menschlicher Kultur sowie als Möglichkeit und Zeugnis aktiver Lebensgestaltung.« Fast jedes Wort eine hohle Nuss, ein faules Ei … Zwar wurde der Satz an einer anderen Hochschule kreiert, aber auch bei uns sieht es nicht viel besser aus. Immer wieder ist auch in unseren Ordnungen die Rede von »grundlegenden künstlerischen Kompetenzen«, »umfassenden« oder »vertieften Kenntnissen und Fähigkeiten«, »historisch und systematisch fundierten Kompetenzen«, »eigenverantwortlichem Umgang mit erarbeiteten Methoden«, »Fähigkeiten zur stilistischen Einordnung und Differenzierung«. Das klingt nicht besser als die uferlose Flut von unerquicklichen, hochtrabenden, verstiegenen, bramarbasierenden, pseudointellektuellen, Orgien leerer Abstraktion feiernden Hohlformeln, die man in Zielbestimmungen von schulischen Lehrplänen findet. Ich denke an Formulierungen wie »Verständnis für grundlegende wissenschaftstheoretische und philosophische Fragestellungen«, »Gleichgewicht im Menschen zwischen Verstehen und gefühlsmäßigem Erleben«, »problem- und prozessbezogenes Denken in Zusammenhängen«, »Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft«, »Konzentrationsfähigkeit«, »Offenheit für andere Sichtweisen«, »kognitive Aktivierung«, »Wissen flexibel einsetzen können«, »Methoden-, Orientierungs- und Bewertungskompetenzen«, »methodischtheoretisches Grundlagen- und Vermittlungswissen«, »Vermittlung einer allgemeinen Studierfähigkeit«. All dies sind aufgeblasene Abstraktionen ohne Inhalt, die eher verdunkeln als klären. Solche schlotternden Formeln wollen alles erfassen und sagen in Wirklichkeit nichts.
Lässt sich denn überhaupt bestimmen, was an »Kompetenzen« am Ende eines Studiums stehen muss? Und lassen sich solche »Kompetenzen« wirklich erfassen und bewerten? Ich bin skeptisch. Prüfungsergebnisse sagen nichts über den späteren beruflichen Erfolg aus. Ich will niemandem die Freude an einer guten Examensnote kleinreden, an der Genugtuung und dem Stolz, durch viel Fleiß Erfolg gehabt zu haben. Es ist großartig, wenn Ihre Zeugnisse sehr gut sind! Aber auch: Nicht schlimm, wenn Sie in einigen Fächern nicht so gut abgeschnitten haben. Trotzdem können Ihre Karrieren sehr erfolgreich verlaufen.
Ob man produktiv gelernt hat und was man gelernt hat, zeigt sich nur zum kleinen Teil in Prüfungen. So richtig zum Tragen kommt Gelerntes erst in der Zukunft, im Berufsleben, in der Arbeit, die jetzt vor Ihnen liegt – ob als Lehrer an allgemeinbildenden Schulen oder Musikschulen, als Musiker im Orchester, Ensemble oder auch mal allein auf der Bühne, beim Komponieren und Arrangieren, beim Kooperieren mit Kollegen, beim Schreiben von Texten, beim »Vermitteln« von Musik, nicht zuletzt auch: beim umsichtigen Planen und Steuern, beim Management der eigenen Karriere. Fast beängstigend, was einem alles an erforderlichen und wünschenswerten Fähigkeiten in den Sinn kommen kann – beängstigend nicht nur für Sie, die das Studium nun hinter sich haben (Frage: »Kann ich das alles?«), sondern auch für die Lehrenden an dieser Hochschule (Frage: »Habe ich / haben wir das alles beim Unterrichten mitbedacht?«). Sehr tröstlich und entlastend finde ich, was mir aus einem Gespräch mit einem klugen Bildungspolitiker in Erinnerung ist. Er warnte davor, das Studium in guter Absicht, aber schlechter Wirkung immer weiter zu überfrachten mit immer noch mehr (angeblich) berufsbezogenen Inhalten. »Für fünf Pfennig in sechs Tüten« nannte er das in Anspielung auf die Art, wie er als Kind für sich und seine Freunde Bonbons gekauft hatte. Er wusste: Über 50 Prozent dessen, was in den meisten Berufen gefordert ist, lernt man nachweislich nicht im Studium. Und er fügte hinzu: »Das ist auch gut so.« Er war der Ansicht, dass ein Studium etwas anderes sein solle als der (vergebliche) Versuch, passgenau auf die Anforderungen eines Berufs vorzubereiten. Ein Studium solle den Horizont der Studierenden weiten und nicht verengen.
Читать дальше