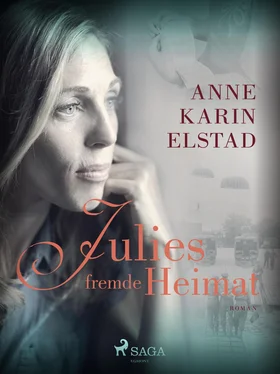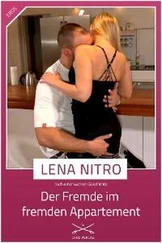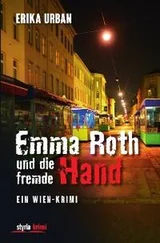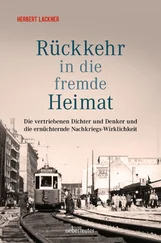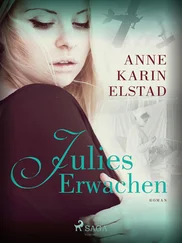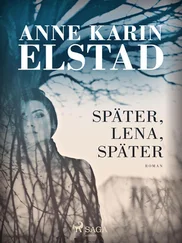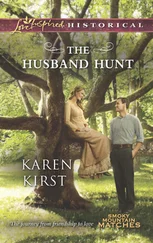Was Industrialisierung und Arbeitsplätze angeht, war dieses Dorf nach der Jahrhundertwende die Gemeinde in Nordmøre, die am meisten expandierte. Anfang der neunziger Jahre im vorigen Jahrhundert wurde in Øra das Sägewerk errichtet und in Betrieb genommen. In seinen besten Zeiten fanden siebzig Arbeiter in dem Betrieb Lohn und Brot. Die meisten davon waren Zugezogene, aber auch mancher aus dem Dorf fand dort Beschäftigung. Jugendliche, die früher gezwungen gewesen wären fortzugehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wurden im Heimatort ansässig. Darüber hinaus gab der Betrieb auch den Bauern, die Wald besaßen, zusätzliche Arbeit, ihre Fuhrwerke wurden für den Transport und für andere anfallende Arbeiten benötigt. In der Saison, wenn sie Faßdauben schnitten, kamen auch Frauen und Kinder der Arbeiterfamilien in dem Betrieb unter, ein willkommener Extraverdienst für alle.
Mit dem Bau der Holzschleiferei wurde 1912 begonnen, und im Winter 1913 nahm sie den Betrieb auf.
Vom Staudamm am Ende des Almsees, aus dem man auch die Wasserkraft für das Sägewerk gewinnt, wurde durch das steil abschüssige Tal eine Druckrohrleitung verlegt, um die Wasserkraft für die Schleiferei zu nutzen, aber gleichzeitig um die Familien in Øra mit elektrischem Licht zu versorgen. Auf diese Weise hatten die Leute dort viel früher Strom als der einfache Mann in Kristiansund, während der Rest des Dorfs nur davon träumen konnte.
In der ersten Zeit, nachdem die Holzschleiferei ihren Betrieb aufgenommen hatte, war es schwer, genügend Hilfskräfte zu finden. Die Arbeit wurde als gesundheitsschädigend angesehen, doch die gute Bezahlung lockte. Das führte zu einer neuen Welle von Zuwanderungen in die Gemeinde. In Øra und im Umkreis wurde Bauland freigegeben, und nach und nach entstand ein dichtes Siedlungsgebiet mit einem Milieu, das eher an eine Stadt als an eine Landgemeinde erinnerte. Sägewerk und Schleiferei verschafften auch vielen Menschen von den Bauernhöfen zusätzliche Arbeit. Sie wurden hinzugezogen, wenn der Holzschliff auf Schiffe verladen wurde. In dieser Zeit gab es genügend Arbeit für alle.
Dieser Aufschwung hielt bis in die ersten Nachkriegsjahre an. Dann ging es mit dem Sägewerk bergab, und 1921 wurde dieser Teil des Unternehmens geschlossen. Das war ein Schlag für die Kommune, die sich auf einmal mit Arbeitslosigkeit als einem neuen und großen Problem konfrontiert sah. Daß es junge Leute traf, war schon schlimm genug, aber viel schlimmer war es für die Familienväter, für alle Haushalte, deren Verhältnisse plötzlich Kopf standen.
In Øra weiß jeder, daß es unmöglich ist, in der Schleiferei unterzukommen. Dieser Betrieb beschäftigt sechzig Mann, die in drei Schichten arbeiten, die Arbeitsplätze in der Schmiede und in den Werkstätten mitgerechnet.
Nun wird jedesmal gemurrt, wenn Bauern zusätzlich für Verladearbeiten am Kai eingestellt werden. Die Arbeiterpartei, die sich im Dorf explosionsartig entwickelt hat, setzt sich eisern in der Gemeindeverwaltung für ein Verbot ein, daß Bauern solche Arbeiten übernehmen dürfen, statt dessen sollen Arbeitslose genommen werden. Das ist eine der Angelegenheiten, die den Streit zwischen Bauern und Sozialisten auf die Spitze getrieben hat. Øra gilt als der röteste Fleck in ganz Nordmøre, und die Bewohner der angrenzenden Siedlungen fürchten nun, daß die Arbeiterpartei demnächst auch die Mehrheit in der Gemeindeverwaltung haben wird.
Nach der Stillegung des Sägewerkes hat sich Mißmut breitgemacht. Es werden verschiedene Notstandsprogramme gestartet, aber das ist nicht besonders hilfreich. Die jungen Leute gehen wieder fort. Seit 1923 sind schon viele aus dem Dorf nach Amerika ausgewandert, aber in letzter Zeit hat das wegen der schlechten Verhältnisse, die auch da drüben eingekehrt sind, nachgelassen.
Auf Storvik wie auf den anderen Höfen hat man feste Milchkunden aus Øra, der Ortschaft, die im Umfeld des Sägewerkes und der Fabriken am Fjord liegt. Abends kommen sie mit ihren Milchkannen. In der Regel schickt man die Kinder vor, vor allem, wenn es an Bargeld fehlt und die Milch angeschrieben werden soll.
Hier zeigt sich Synnøve von einer ganz anderen Seite, von einer Generosität und Wärme, für die Julie sie schon von Anfang an, seit sie hier ist, respektierte. Wenn Synnøve weiß, daß es einer der Milchkunden ganz besonders schwer hat, nimmt sie es nicht so genau und mißt reichlich ab, und wenn sie anschreiben soll, schreibt sie weniger an, als verkauft wurde. Nicht selten kommt es vor, daß sie den Kindern einen Butterklumpen zusteckt, ein Stück Speck oder Nikkjefett, wie sie die gesalzenen und getrockneten Rollen des Bauchfettes vom Schaf nennen, die in kleinen Mengen zu Herings- und zu Kartoffelbällen gegessen werden.
»Das braucht niemand zu wissen«, sagt sie, wenn sie dem Kind die Dinge gibt, die sie in Zeitungspapier eingewickelt hat. Sie weiß, daß man es dort, wo es hinkommt, gut gebrauchen kann.
Im Dorf wird von Synnøve Storvik gesagt, daß sie warmherzig und gütig sei, streng, aber gerecht, sie ist ein Mensch, dem man Respekt zollt. Anders, der Knecht, wird als lebendiger Beweis dafür angesehen. Er hatte das harte Schicksal, ein uneheliches Kind zu sein. Seine Mutter stammte von einem kleinen Gehöft im Dorf. Dort besorgte sie ihrem Vater, der Witwer war, den Haushalt, während sie ein paar Kronen dazuverdiente, indem sie auf Bauernhöfen Schwerstarbeit verrichtete. Solange Anders klein war, nahm sie ihn mit. Als er zwölf, dreizehn war, starb sie an Lungenentzündung, und der Junge wurde zu Verwandten ins Nachbardorf gebracht. Synnøve kam zu Ohren, wie schlecht es ihm ging, daß er wie ein Erwachsener arbeiten mußte, zerlumpt herumlief und fast nie zur Schule ging. Da gab sie nicht eher Ruhe, bis sie ihn zu sich auf den Hof geholt hatte. Sie kleidete ihn ordentlich, schickte ihn in die Schule, richtete seine Konfirmation aus. Seitdem ist er auf dem Hof. Hier hat er ein Dach über dem Kopf, Essen und Kleidung, und ein paar Kronen als Lohn bekommt er auch. Er ist jetzt fast vierzig, eine Frau hat er nicht. Es heißt, er sei vom Verstand her etwas minderbemittelt, doch Synnøve sagt, so wie er in der Schule und sonst überall geschunden worden sei, habe ihn die Kindheit zugrunde gerichtet. Die beiden haben eine seltsame Zuneigung füreinander. Versucht jemand, Anders hochzunehmen, lernt er eine Synnøve kennen, mit der nicht gut Kirschen essen ist, und niemand darf etwas Schlechtes über Synnøve sagen, wenn Anders das hört. Julie hat er auch gern, und er versteht es unglaublich gut, mit den Kindern umzugehen.
»Du mußt dich nicht daran stören, was Synnøve sagt. Sie meint es nicht böse. Sie ist halt so«, sagt er zu Julie und beweist wahrlich genügend Sinn und Verstand.
Oft denkt Julie, wenn Synnøve nicht ihre Schwiegermutter wäre, wenn sie nicht gezwungen wären, die ganze Zeit auf engstem Raum miteinander auszukommen, würde sie sie besser leiden können als manch anderen, den sie kennt. Wenn sie in sich geht, stellt sie fest, daß es der unglückselige Kampf um die Macht ist, der ihr Verhältnis zerstört. Dann weiß sie, daß sich der Teil ihrer Persönlichkeit, der aus Trotz, Reserviertheit und der Fähigkeit besteht, andere auf Abstand zu halten, noch verstärkt hat, seit sie hierher kam. Wenn sie unglücklich ist, läßt sie niemanden an sich heran, zeigt niemals, wie schlecht es ihr geht. Und das wiederum hat zur Folge, daß Synnøve scharfe und oft auch verletzende Bemerkungen fallen läßt, die sie selbst, wenn sie ihr zu weit gehen, dazu veranlassen, mit derselben Münze zurückzuzahlen, meistens in Form einer knappen, eiskalten Antwort. Deswegen ist sie so darauf aus, mit Jørgen den Hof zu übernehmen. Wenn sie und Synnøve nicht mehr die Küche und die Verantwortung teilen müßten, wäre es besser für sie beide. Nach dem Gespräch mit Astrid hat sie viel darüber nachgedacht, und sie versucht, die Sache mit Synnøves Augen zu sehen. Wenn sie nur einmal darüber miteinander reden könnten. Aber wie sich die Dinge jetzt zwischen ihnen entwickelt haben, glaubt sie, daß es sinnlos ist.
Читать дальше