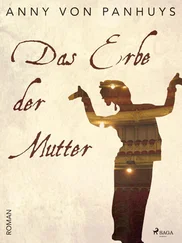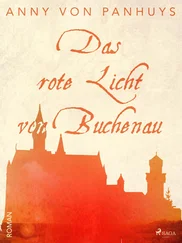Ewald Förster war die Kehle rauh. Es war doch ein verteufeltes Handwerk, so einem armen Weib das Letzte und Beste wegzunehmen, ihr Kind; aber wie er gehandelt, war es seine Pflicht gewesen. Er war der Vormund Marlenes und mußte an ihre Zukunft denken. Daß er zugleich daran gedacht, die Schwägerin mit der Zuchthausvergangenheit ein für allemal abzuschütteln, nahm ihm wohl niemand übel, der wußte, wie sehr er darauf hielt, von jedermann geachtet zu werden.
In seiner Familie und in seinem Leben gab es nicht den kleinsten dunklen Punkt. Die Körper der Familie Förster hätten seit Urvätertagen aus Glas sein können, durchsichtig durch und durch; und nun mußte er gerade das Pech haben, so ein schwarzes Schaf in die Familie zu bekommen.
Seine Frau hatte sich angestellt und geweint, als wollte man sie zerstückeln, als er ihr zuerst davon gesprochen, wie man sich von Susannes Familienzusammengehörigkeit befreien könnte; aber allmählich hatte sie eingesehen, so wie er es sich zurechtgelegt, war es am besten für Marlene und für sie alle. Auch sie glaubte nicht an die Unschuld der Schwester.
„Iß doch nun aber endlich eine Kleinigkeit, Susanne“, forderte er die Schwägerin auf, „vor allem trinke ein Gläschen Wein, es wird dir gut tun!“
Susanne schüttelte sich. „Im Zuchthaus habe ich keinen Wein getrunken, man zieht dort Wasser vor, und ich fürchte, wenn ich Wein trinke, könnte mein armer, jetzt so bescheiden geduckter Verstand rebellisch werden und alles, was ich eben zugesagt habe, wieder umstoßen. Und Hunger habe ich nicht, gar keinen. Ich schlage vor, du bringst mich mit dem Auto bis zur nächsten Station, von dort fahre ich nach Berlin. Morgen depeschiere ich dir, wo ich dort wohne, und du überweist mir dann mein Geld. Es müssen noch fünfzehntausend Mark sein.“
Er nickte. „Und was soll aus deinen Möbeln werden? Sie stehen hier bei uns in einem Schuppen unter.“
Sie machte eine nachlässige Gebärde. „Verkaufe sie oder hebe sie für Marlene auf! Mach damit, was du willst! Auch mit meinen Kleidern. Ich kaufe mir das Nötigste in Berlin zusammen.“
Er erwiderte: „Es ist gut. Schreibe mir ein paar Zeilen für deine hiesige Bank, daß ich berechtigt bin, dein Geld abzulösen.“
Sie neigte nur den Kopf, und er schob ihr ein Tischchen mit Papier und Tinte vor ihren Stuhl.
Sie schrieb hastig, und ihre Züge lagen wie in Schattenrücher eingehüllt. Als sie den Federhalter fortlegte, sagte sie: „Nun will ich Marlene sehen, wenn auch nur von weitem. Ich verspreche euch, sie nicht zu wecken. Aber einmal muß ich mein Kind noch sehen.“
Ewald Förster hatte ein Nein auf den Lippen; aber er antwortete doch: „Ja, du sollst sie sehen!“
Er schloß sich den beiden Frauen an, die durch eine Reihe von Zimmern vor der Schlafstube der beiden Kinder haltmachten. In einer Ecke des mit weißen Möbeln ausgestatteten Raumes verbreitete ein Wandleuchter gedämpftes Licht.
Susanne sah die Tochter der Schwester zum erstenmal. Schon zwei Jahre hatte sie hinter Zuchthausmauern verbracht, als Elinor zur Welt gekommen. Sie bemerkte Wandas stolzes Mutterlächeln, und es gab ihr einen Stich durch das Herz.
Sie schlich auf den Zehenspitzen hinüber an das andere Bett, das auf der rechten Seite des Zimmers stand. Die Knie drohten ihr zu versagen. Das also war ihre Marlene, das war aus dem schmalen, dünnen Püppchen geworden, das sie vor sechs Jahren hatte verlassen müssen.
Ein kräftig, hübsches Mädel lag vor ihr in den weißen Kissen mit leicht geöffneten roten Lippen, durch die das blendende Weiß zwei ebenmäßiger Zahnreihen blitzte. Die Schlafende hatte die eine Hand unter den Kopf geschoben, um den das kupferfarbene Haar wie eine lose Welle von dunklem Gold spielte. Bildhübsch und gesund sah Marlene aus, sorglos war der Ausdruck des reinen Gesichtchens.
Susanne war zumute, als müsse sie den straffen, kleinen Körper, dessen Konturen sich deutlich unter der Decke abzeichneten, aus dem Bett reißen und ihn an sich drücken. Schon erhob sie sich von ihrem Stuhl, schon streckten sich ihre Arme aus, als ihr plötzlich einfiel, was ihr Ewald Förster vorhin klargemacht. Nein, sie durfte das Kind nicht berühren, sie durfte es nicht mütterlich zärtlich an sich pressen, den kleinen, roten Mund voll Innigkeit küssen. Sie war ja eine Verfemte, sie war in den Augen der Mitmenschen eine Mörderin, und würde an ihrer Seite das Kind in Qual und Sorge reißen. Das durfte sie aber nicht, das wollte sie auch nicht. Sie mußte für immer aus Marlenes Dasein gehen, wie sie es vorhin Ewald Förster versprochen.
Es blieb ihr keine Wahl.
Sie neigte sich über das Bett und betrachtete die kleine Schläferin mit einer Rührung, die aus grenzenlosem Schmerz geboren war. Sie wollte nicht weinen, aber sie vermochte es doch nicht zu hindern, daß ein paar heiße Tränen niederfielen auf das Gesichtchen, auf das sie niederblickte.
Das Kind fühlte die Tränen im Schlaf, instinktiv hob es die Hand und fuhr sich über die Wangen, als jage es eine Fliege fort.
Schon hatte sich Susanne gewandt. Sie floh förmlich aus dem Zimmer und befand sich schon im nächsten Raum, als ihr die beiden anderen erst nachkamen.
Nur noch ein knappes Viertelstündchen blieb man in Ewald Försters Stube zusammen, dann verließ Susanne das Haus auf demselben Wege, auf dem sie es betreten.
Sie hatte der Schwester keine Hand mehr gereicht und die Weinende von sich geschoben.
„Ich müßte es euch danken, weil ihr euch meines Kindes erbarmt, aber ich kann es nicht“, hatte sie gesagt, „eure Wohlanständigikeit, die so weit von mir fortrückt, frißt mir das Herz entzwei. Ich bin keine Schuldige sondern nur eine Unglückliche.“
Sie war in das Auto gestiegen und von Ewald Förster bis zur nächsten Station gebracht worden.
Nach Berlin hatte er ihr ein paar Tage später ihr kleines Vermögen überweisen lassen, und dann war die blasse, schlanke Frau abgereist. Niemand wußte, wohin, niemand hatte Interesse, danach zu fragen.
Susanne von Bergener hatte nichts weiter von ihrem einzigen Kinde mit hinausgenommen in die weite Welt als die Erinnerung an ein hübsches, schlafendes Mädchen mit dunkelgoldener Haarwelle über der reinen, fest gezeichneten Stirn und blitzenden Zähnen unter leicht geöffneten Lippen. Dazu ein Bildchen, das Marlene im dritten Jahr zeigte. Das Bild hatte sie auch im Zuchthause immer bei sich getragen.
Die Jahre vergingen. In der ersten Zeit sprach Wanda Förster manchmal zu ihrem Manne: „Wo mag Susanne gelandet sein? Mich drückt unsere Härte oft wie eine große, große Schuld.“
Er schüttelte den Kopf.
„Weiß der Himmel! Wäre sie wirklich unschuldig, dann wäre etwas daran an der großen Schuld, so aber taten wir nur, was unsere Pflicht gegen Marlene von uns forderte. Und du siehst, sie erwähnt die Mutter wenig. Sie hat sich an den Gedanken gewöhnt, daß sie weithin verreist ist. Sieh du in ihr eine Verschollene!“
Frau Wanda war eine willensschwache Frau, gemessen an der Energie ihres Mannes. Sie fügte sich ihm und sah in der Schwester eine Verschollene.
Die zehn Jahre des Verschollenseins gingen vorüber, und da sich auf keinen Anruf Ewald Försters Susanne von Bergener gemeldet, spielte sich alles glatt ab, so wie es vorgesehen war; Susanne Maria Leonore von Bergener, geborene Kirchner, die Witwe des Bildhauers Urban von Bergener, wurde für tot erklärt.
Es war ein herrlicher Frühherbsttag. Marlene von Bergener stand am Fenster ihres Zimmers, das sie allein bewohnte, und blickte hinaus. Marlene war vor kurzem einundzwanzig Jahre alt geworden.
Eben schlug es sieben Uhr. In einer halben Stunde wurde gefrühstückt. Sie wollte Elinor wecken, die schlief immer gern lange, und der Onkel ärgerte sich darüber. Sie öffnete leise die Tür zum Nebenzimmer und betrat auf den Zehenspitzen das hübsche Nest aus Hellblau und Weiß, das Elinor ihr Zimmer nannte. Im Bett lag das entzückendste Mädel der Welt und blinzelte verschlafen, als ihr Marlene über das dunkellockige Haar strich.
Читать дальше