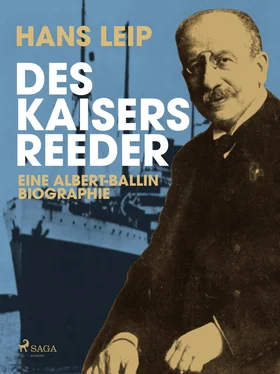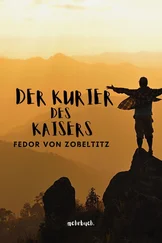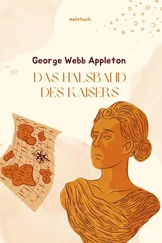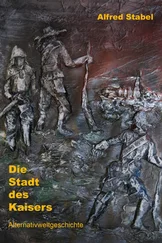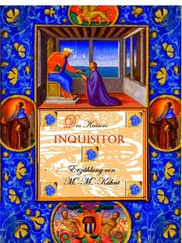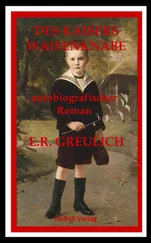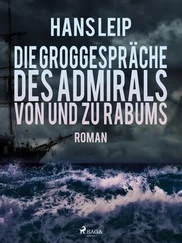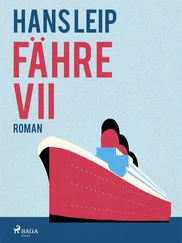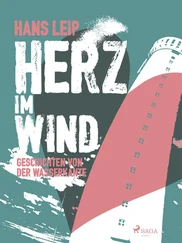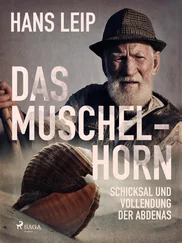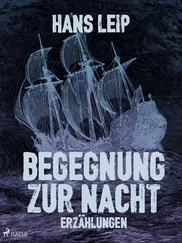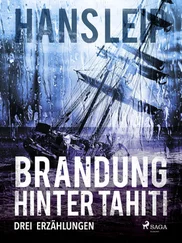„Tiefer gebaggert!“ sagt Kirsten.
„Dafür sind unsere Schiffe handlicher, und bis vor kurzem noch waren sie auch immer voll“, wirft Herr Tietgens ein.
Woermann antwortet: „Es wird die saure Aufgabe des neuen Vorstandes und Aufsichtsrates sein, sie wieder vollzumachen.“ Er setzt sich. „Das nennt man Vollmacht!“ kalauert Laeisz und blickt John Meyer an.
Der wacht plötzlich auf. Er hat wahrhaftig ein „büschen genickt“ bei dem Gerede, das er bis zum Überfluß kennt. So voll wie wirklich voll, so viel gibt es gar nicht, lächelt er sich zu.
Nun beugt sich Johann Witt vor. Seine Porterwangen sind prall von dem Wort, das ihm seit einer Viertelstunde auf der Zunge schwillt. Jetzt platzt es hervor, dicht an Meyers Ohr: „Und der Zollanschluß?“
Das Wort knallt wie ein Geschoß in die Sitzung.
„Prost, Mahlzeit!“ ist alles, was Meyer erwidern kann.
Da erhebt sich Oskar Ruperti, sonorer Fünfziger, Teilhaber des Bank- und Handelshauses Merck & Co., versippt und verschwägert mit allen trefflichen hansischen Namen. Die Rupertis sind gleichfalls aus dem Binnenland in den Sog des elbischen Welthafens geraten. Wie beim Stuhle Petri die Kette des Geistes nie abreißt, so hier an der Elbe die des Blutes, seitdem etwa der Heereslieferant Karls des Großen – im Tauschgeschäft norwegischen Stockfisch gegen welschen Wein liefernd – einen zu St. Gallen geborenen Leinenhändler als Teilhaber aufnahm und ihm die Hand der Tochter überließ.
Rupertis Figur vereint die Schlankheit des Vaters mit der robusten Zähigkeit seiner Merckschen Mutter. Sein männlich schönes backenbärtiges Gesicht hat seit der harten Lehrzeit in den Südstaaten der USA den Ausdruck einer straffen Beherrschtheit angenommen. Dort hat er noch Sklaven kommandiert. In seiner Stimme schwingt noch etwas von der Schmiegsamkeit frisch gepflückter Baumwolle mit, obschon die Firma sich längst auf das einträglichere Geschäft mit Chilesalpeter, ausländischen Fisch- und Fleischmehlen, heimischen Phosphaten und dem Mist überseeischer Meeresvögel, dem Guano, umgestellt hat. „Meine Herren“, sagt er verbindlich und zieht die Mundwinkel ein wenig nach unten, „lassen Sie uns dem Gedanken des Zolles so wenig Bedeutung beimessen, wie dem des Anschlusses. Es sei denn, wir freuten uns, auf der Elbchaussee und wo sonst immer wir ins Preußische fahren, endlich unser Bett- und Silberzeug unverzollt bewegen zu können. Freihandel ist immer das, was man staatlichen Maßnahmen zum Trotz zuwege bringt. Ich hatte mit Woermann und Münchmeyer bis heute einige Jahre lang den sogenannten Verwaltungsrat der Packetfahrt zu vertreten. Wir sind darin, wie die Herren von der Aufsicht, selbständige Leute und haben die Hapag wie ein Ziehkind übernommen, das unsere Väter gemeinsam gezeugt haben. Allmählich dürfte es mündig sein. Und es hat unter der Dreitürme-Flagge genau wie unsere Erbfirmen der Welt gezeigt, was Hamburg bedeutet. So ist es auch unter der Flagge des Reiches geblieben, wie unsere Stadt: Frei und hanseatisch. Das Reich ist für uns Hinterland wie der übrige Kontinent. Wir haben es im Rücken. Daß es uns denselben stärke und nicht bloß unter unseren Achseln hindurch in unsere weltweiten Beziehungen hineinfingert, dafür werden wir denn ja wohl noch sorgen können!“
Ein ungeteiltes Bravo knarrt über die rindslederne Tischplatte. Sie ist braun und glatt wie die Haut der Mädchen auf den Atollen junger Handlungsgehilfenjahre. Aber hier ist sie der Inbegriff der Hapag, kalter Atlantik vor einer Planke aus Wolkenkratzern, nur mit einem kaum noch zu ahnenden Schimmer westindischer Buntheit.
Bleibt eigentlich nur noch Bremen; Nachbarn und Verwandte sind wie üblich immer die Unangenehmsten, wenn es darauf ankommt“, sagt langsam Tietgens und lehnt sich wuchtig zurück. Ruperti läßt die salpeterfarbenen Augen zum Fenster hinaus spielen, als läse er an den schiefen Speichergiebeln der anderen Fleetseite eine unlösbare Aufgabe.
Dämmerung sickert herein und legt sich in den einschläfernden Überseedunst der Importen. Rotspongesichter schwimmen hinter den tropischen Verbrennungsschleiern wie Seetonnen in einem unsicheren Fahrwasser.
„Kramke soll Licht machen!“ sagt Meyer schläfrig und greift zur Messingglocke, die vor ihm lauert. Es bimmelt dünn wie Signale, die im Nebel übers Wasser kommen.
Eine von satter Ruhe erfüllte Grabesstimme sagt: „Am besten ist abwarten.“ Sie paßt zu Robert Mestern. Er meint, auch endlich etwas äußern zu sollen. Aber man hat ihn zum Vorsitzenden des neuen Aufsichtsrates nur deswegen gewählt, weil er das unwiderstehliche Vertrauen derer ausstrahlt, die sich nicht aufregen sollen. Sein Arzt hat die Angehörigen gebeten, den Weinkellerschlüssel zu übernehmen. Der Kreislauf des Hausherrn ist gefährdet. Wie der der Hapag.
Bürodiener Kramke erscheint, verschwindet und kommt wieder. Er stülpt mit gewandter Zehe die Stiefeletten von den Socken, schiebt zwischen Witt und Münchmeyer mit einem leidgeprüften „Gestatten die Herren!“ eine zerlesene „Börsenhalle“ auf den Tisch, dann ein Knie, dann das andere, und schwupp erhebt er und reckt sich wie die Statue St. Ansgars auf der Trostbrücke. Der empfindliche Konsul Münchmeyer hätte wohl gern, daß die Füße Kramkes auch aus Sandstein wären, obwohl er dann nicht imstande sein würde, ein Reißsticken an der rauhen Hausmeisterschürze und danach den Gaskandelaber zu entzünden. Paff! sagt es dreimal. Gelbe Helligkeit blendet jede Miene und läßt sie wie aus verzerrtem Blech glänzen. Herr Robertson beschattet die Augen. Das zarte Leuchten echten Schildpatts und Perlmutts, das sein Kontor neben Kobra aus der Südsee einführt, ist ihm angenehmer als dieses Kohlengasglühlicht. Die fünf Kuppeln unter der meerschaumfarbigen Decke schwimmen im Zigarrenhecht wie pralle Fischblasen, gefüllt mit dem Fett der Ferne.
Lähmend genießt das Schweigen sich selber. Dann sagt Witt: „Petroleum war doch gemütlicher“, und Laeisz erwidert: „Jawohl, bleibt alle man immer hübsch hinter der Zeit zurück. Und Bremen baut Schnelldampfer.“
„Dann geht’s auch schneller auf die Pleite zu“, beschwichtigt Herr Tietgen; er ist aus Liebhaberei Sportsegler. Ihn reizen Dampfer nur nebenbei als das kleinere Übel, der Geschäfte wegen. Aber was hilft es? Der mahnende Finger des Fortschritts pocht in die hergebrachte Gemütlichkeit. Durch die Fenster dringen die Geräusche des Verkehrs von Fahrzeugen und Pferdehufen. Sie schwellen an, lauter und schneller, immer lauter. Aber unentwegt fädelt sich ein fast lautloses Flüstern hindurch. Perzente, Perzente! lispelt es.
Die Wände frösteln wie der Reichstag um Mitternacht. Aus bräunlicher Patina blicken die Gründer dessen herab, was Hapag heißt. Lächeln sie? Woermann nickt dem Kollegen Münchmeyer zu. Dieser schließt daraufhin feierlich und wie erlöst: „Ich erachte es für hinreichend, die Übernahme der gehabten Rechte und Pflichten durch Herrn Mestern bekräftigt zu sehen.“
Mestern stemmt sich gewichtig hoch. Kaffee, Tee, Rohrzucker, Kakao gegen bar, reiner Import. Die Firma Tesdorpf & Co. unter seiner Leitung darf reinen Gewissens sein; sie hat nicht dazu beigetragen, stillere Kontinente mit europäischer Zivilisation zu verseuchen. Füllig ruht seine Hand auf dem Bündel der neuen Statuten, die doch nicht viel Neues enthalten, außer daß nun endlich die Besoldungsfrage für den gelöst ist, der die Arbeit zu tun hat. Bislang ist es ja mehr ehrenamtlich auf Spesen geschehen.
„John Meyer!“ sagt er schweratmend. „Hiermit ist, wie Sie wissen, Ihrer bewährten, von der Pike auf diesem Unternehmen angehörenden Kraft die volle Verantwortung der Geschäftsführung auferlegt. Wir ernennen Sie hiermit zum Direktor.“
Inzwischen hat sich auch Meyer erhoben. Hoheitsvoll, mit stummer Verbeugung, dankt er, und mit einer Arabeske der Linken unterstreicht er den souveränen Satz: „Ich nehme an und eröffne.“
Читать дальше