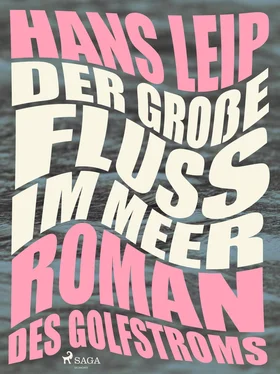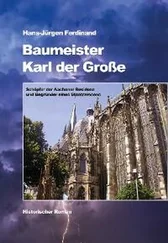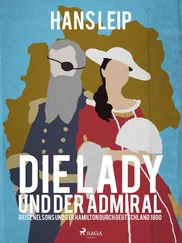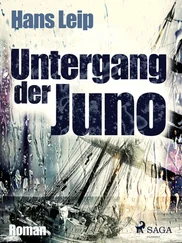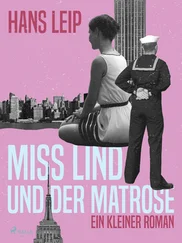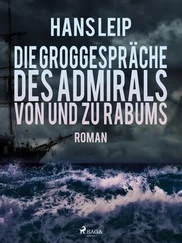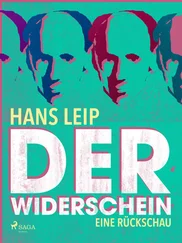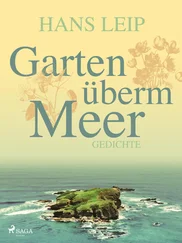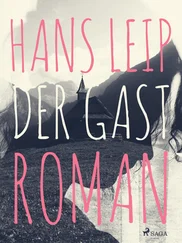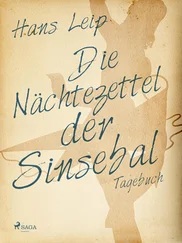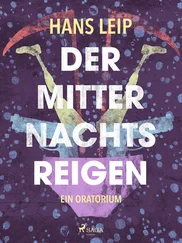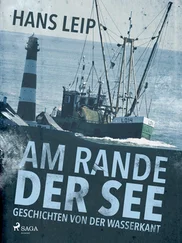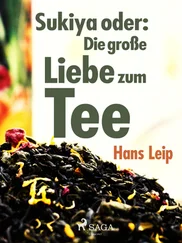Wir kennen nicht Gesicht und Gestalt des João Vaz, der schon 1465 auf Dorschfang nach Neufundland segelte. Seine Söhne haben davon erzählt, als es Mode wurde, über solche Gemeinplätze Worte zu verlieren. Es waren die beiden Corte Reals, die im Jahre 1500 von Labrador berichteten, daß sie dort an Land gegangen seien, etwas nördlicher, als ihr Vater je für nötig befunden. Sie verschollen später in der Davisstraße, ohne uns ihre Gesichter zu hinterlassen.
Das Gesicht von Cristoforo Colombo ist das erste aller Seefahrer, das wir kennen.
Aber kennen wir nicht auch das von Heinrich dem Seefahrer? Doch die Miniatur vom Ende des 15. Jahrhunderts, die anscheinend durch Brautwerbung nach dem Norden verschlagen wurde, zeigt einen merkwürdig modernen Typ. Er wirkt aber nicht wie ein Seefahrer, und in der Tat ist er nur die vom Land aus treibende Kraft zur Überwindung der Schwierigkeiten gewesen, die den Afrikaumsegler in den Strömungen der Äquatorregion erwarteten. Er selber ist nie zur See gefahren. Seinen Titel trägt er, wie es bis heute vorkommt, ehrenhalber für die Taten seiner Angestellten. Und den Sprung über den Ozean hat er nicht wagen lassen. Er sieht so aus, wie hervorragende Sammler auszusehen pflegen, mit Augen, die aus der Überschattung der Brauenbögen hervorstechen. Der Blick ist zehrend und sinnend. Die kräftige Nase schnuppert, die Lippen schwellen saugend; die Wangen sind eingezogen. Solche Leute begehren energisch, die leeren Plätze ihrer Galerien und Kabinette zu füllen, sie sind geeignet, Agenten zu beauftragen und eine zähe Korrespondenz zu führen. Sie schlafen schlecht, träumen heftig von Errungenschaften und Okkasionen. Aber persönlich setzen sie sich höchstens in jungen Jahren auf die Fährte.
Heinrich, Infant ohne eigentlichen Posten, sammelte Seekarten, Seewege und Afrikanachrichten. Afrika war sein Spezialgebiet, seit er 1415 bei der Eroberung des maurischen Ceuta geholfen und gestaunt hatte, was in diesem Welthafen an Schätzen zusammengetragen war und was dort an Industrie und Akademien bestand. Er sah damals die erste Papierfabrik und die erste Baumwollplantage, und wäre er ein Typ etwa wie Jakob Fugger gewesen, ein Handelsmann vom reinsten Erwerbstyp – man halte beider Bilder nebeneinander –, so hätte er sein bei der Beuteteilung eingestrichenes Kapital vermehrt, anstatt es mit der Ausbildung von Kapitänen, der Anschaffung von nautischen Instrumenten und der Ausrüstung von Expeditionsflotten zu verbrauchen. Ehe er aber seine Leute zu der lange in der Luft geisternden Fahrt quer über den Ozean beauftragen konnte, starb er.
Es war das Jahr 1460, um die Zeit, da Johann Müller, genannt Regiomontanus (er stammte aus Königsberg in Franken), die ersten brauchbaren astronomischen Tabellen berechnete, wie sie zur Bestimmung der geographischen Orte nötig sind. (Kolumbus hat sie als einer der ersten benutzt.) Es war die Zeit, da es zur Bildung gehörte, die Erde als Kugel anzusehen, so, wie es die Alten gelehrt, bevor die Christenheit es vergessen hatte. Es war die Zeit einer erwachenden geistigen Unruhe, wie sie noch nie Europa heimgesucht, einer erhitzten Regsamkeit, eines fingernden Suchens nach Neuland, das in Ermangelung neuer Richtlinien auf alte Quellen und Wegweiser zurückgriff. Es ist die Welle des Humanismus, die strudelnde Flut eines geistigen Fiebers, die alles in sich hineinreißt, was an Bildung, Überlieferung und Spekulation das Abendland halb versunken untermauert oder abgeschirmt umgibt. Sie wirft die vergrabene Antike ans Licht, verschlingt die Kultur der Araber, bemächtigt sich der hebräischen Geheimwissenschaft, durchstöbert alles, bezweifelt alles, begehrt alles und schießt, alles umrankend, in die Weltöffentlichkeit.
Es ist ein Aufbruch des Geistes, der etwas Übermäßiges hatte, eine jähe Vegetation, die weit über die Grenzen der Ordnung wucherte und seitdem nicht aufgehört hat, die Welt zu beunruhigen.
Man hat viele Erklärungen für diesen „Abschied vom Mittelalter“ versucht. Man hat das Versagen der Kirche dafür verantwortlich gemacht oder die Türken, die den Gewürz-, Weihrauch- und Seidenweg nach Asien sperrten.
Wir, Tlaloca, wissen eine andere Ursache.
Es ist jene Zeit, da die Fahrten der Skandinavier nach Grönland und nach Nordamerika aufhören. Was hat das mit dem Humanismus zu tun? O ja, es hat vielleicht. Das große Vielleicht steht hinter jeder Antwort seit jener Zeit. Um jene Zeit nämlich wurden die Grönlandfahrten unbequem und die Siedlungen dort ungastlich, die sich doch einer langen Blüte erfreut hatten. Irgend etwas war in der kosmischen Harmonie geändert worden. Die Erdachse hatte sich langsam, langsam um ein paar Meter verschoben, oder die Sonne hatte einen zufälligen winzigen Ruck getan, oder irgendwo in den Abgründen der See hatten weitwirkende Einbrüche stattgefunden.
Jedenfalls ist um jene Jahrhundertwende die Packeisgrenze im Nordwesten vorgerückt. Die grönländischen Häfen sind von Eis blockiert, und der Weg mit den Strömungen gen Winland und Markland ist wegen Treibeis, Eisbergen und Nebel nicht mehr benutzbar. Und es schneit in Grönland, unaufhörlich. Die Siedler verkümmern. Sie und die alten Segelwege geraten in Vergessenheit. Sie wurden von der Midgardschlange verlassen.
Denn der Golfstrom, der warmblütige Schlangenstrom, hatte eine kleine Wendung nach Osten vollzogen.
Nun fließt er ein wenig näher heran an die zerfranste Tatze Europa. Und sieh, wie die unterm Cantus firmus Dahindämmernde sich zu regen beginnt! Sieh, wie die Winter milder werden und die Frühlinge und Herbste stürmischer und die Sommer feuchter, alles ein wenig nur, und sogar mit Rückschlägen – wenn in der Davisstraße die Gletscher das Kälberkriegen vergessen und der Golfstrom zurückschwingt, sie zu mahnen. Es sind nur ein, zwei Grade zuviel, verglichen mit dem, was der europäischen Lage natürlich wäre, aber hier und da sind es zwanzig Grade zuviel. Und der feuchte Warmhauch, der von der pulsenden Schlange aufdampft und den die Westwinde herübertragen bis an die Alpen und über die Alpen hin, er läßt Pfirsiche, Reben und Erdbeeren im Freien reifen, wo naturgemäß nichts als Kranichsbeeren wachsen sollten, soweit der Schnee überhaupt auftauen würde. Und er heizt die unbewußten Gemüter, die empfindsameren sowohl als die Holzköpfe, und indes die einen unruhig zwischen Himmel und Hölle fiebern, knallen die andern aufeinander und wissen nicht, warum, und suchen ihre Gründe in allerlei Vorwänden der Politik, des Ruhmes, der Ehre, des Himmels, der Macht und des Vorteils.
Es beginnt die Zeit der Umwälzungen , der konfessionellen Auseinandersetzungen, der Kriege, der Massenmorde, der Entdeckungen, der Deportationen, der Auswanderungen, der Erfindungen. Das golfstromerregte Abendland wirft sich auf sich selbst und über die Welt. Es ist verurteilt, über seine Maße hinauszusprießen, Unerhörtes darzustellen, sich über die ganze Erde zu verbreiten und – übersteigert und übernommen – sich selber zu verzehren.
Um 1400 wird der atlantische Mensch sichtbar. Er ist gezeugt vom Golfstrom. Immer schon war er vorhanden, dieser Golfstromtyp Europas, dieser unruhige, zuinnerst Fiebernde, dieser Getriebene. Aber lange blieb er auf die Mittelmeerländer beschränkt. Es würde eine dankbare Aufgabe sein, nachzuweisen, daß der Golfstrom einige hundert Jahre lang bis zum Beginn unserer Zeitrechnung eine weitreichendere Ader ins Mittelmeer geschickt habe. Soll doch Aristoteles gestorben sein in Verzweiflung über die vergebliche Erforschung der Meeresströmung, die in der Straße von Negroponte herrschte und wahrscheinlich die heutigen Strömungen weit übertraf.
Sein Schüler Tyrtamos, von ihm Theophrastos genannt, erkannte um 310 v. Chr. an der Drift von Seetang und versiegelten Flaschen, daß das Mittelmeer sein Wasser hauptsächlich vom Atlantik beziehe.
Читать дальше