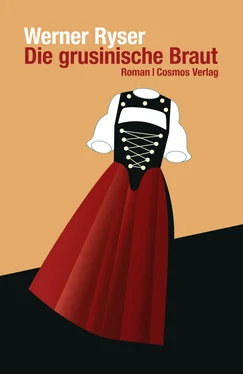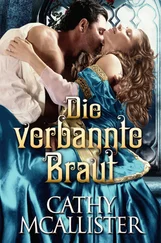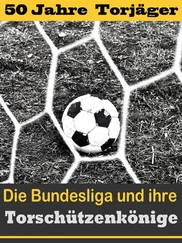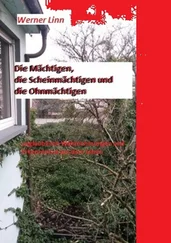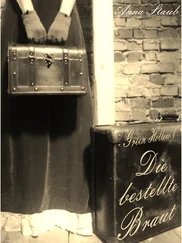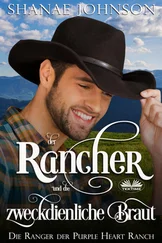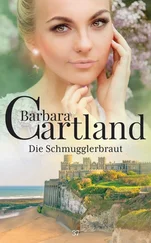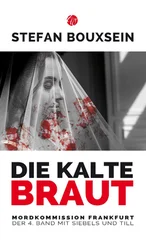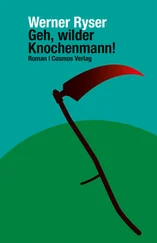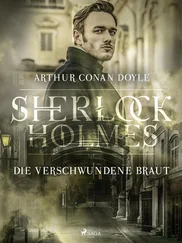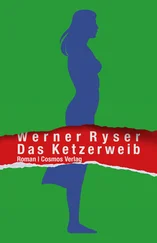Johannes Grathwohl hatte seine Erzählung zu Ende gebracht. Er schaute den Leutnant an. In seinen Augen schwammen Tränen. «Was haben wir getan, dass es dem Herrn gefallen hat, uns derart hart zu bestrafen?» Er schien keine Antwort auf seine Frage zu erwarten.
Als Vitus von Fenzlau von seinem Ausritt zurückkehrte, sass Hanna Engist wieder am Holztisch unter der Silberlinde. Vor ihr stand eine grosse Schüssel mit grünen Bohnen, die sie bereits gewaschen hatte. Sie legte jeweils fünf oder sechs von ihnen nebeneinander auf ein Küchenbrett, richtete sie aus wie Soldaten, die in einem Glied stehen, und kappte dann mit einem Messer an beiden Enden die Spitzen. Sie lud ihn ein, sich neben sie zu setzen.
Johannes Grathwohl habe ihm die Geschichte des Schreckenstags von Katharinenfeld erzählt, berichtete der Leutnant, nachdem er Platz genommen hatte.
«Er hat Euch seine Geschichte von jenem Tag erzählt», sagte die Frau des Pastors, ohne von ihrer Arbeit hochzublicken.
«Gibt es denn mehrere?»
«Gewiss, eine ganze Dorfgemeinschaft wurde überfallen – mehr als vierhundert Menschen, und so gibt es auch mehr als vierhundert Geschichten. Solche, die erzählt, und solche, die verschwiegen werden. Es gibt die Geschichten von wehrlosen Opfern, von Heldinnen und Helden, von Feiglingen und von Verschonten. Jede dieser Geschichten ist wie ein Faden, der erst im Lauf der Jahre mit anderen zu einer Art Bilderteppich verwoben wird, der ein Ereignis darstellt, das, obwohl es die Wirklichkeit auch nicht wiederzugeben vermag, von unseren Kindern und Kindeskindern für wahr gehalten werden wird.»
Vitus dachte nach. «Was ist denn die Wahrheit?», fragte er.
«Katharinenfeld wurde überfallen. Fünfzehn Menschen wurden erschlagen, hundertvierundneunzig wurden versklavt, zweihunderteinundzwanzig blieben zurück. Aber das Leid, die Schmerzen, die Angst, die Verzweiflung und die Trauer – es gibt keine Worte, die all das angemessen zum Ausdruck bringen könnten. Doch glaubt mir: Es vergeht kein Tag, an dem jene, die damals dabei waren, nicht an diesen 14. August denken. Und jeden quälen andere Bilder.» Noch immer rüstete Hanna Engist ihre Bohnen. Konzentriert zwickte sie die Spitzen ab, als gebe es nichts Wichtigeres auf der Welt.
«Johannes Grathwohl meint, es habe dem Herrn gefallen, das Dorf zu bestrafen.»
«Johannes Grathwohl versündigt sich, wenn er das glaubt.» Jetzt endlich unterbrach die Frau ihre Arbeit. Sie sah den Leutnant an. «Wenn im Verlauf eines Krieges friedliche Bauern erschlagen und ihre Lieben versklavt werden, so ist das Menschenwerk.» Ihre Stimme klang zornig. «Wahr sind nicht nur die Gräuel, die wir einander antun», fuhr sie nach einer Weile leiser fort. «Wahr ist auch, dass es Mitgefühl gibt und Grosszügigkeit. Ohne die Hilfe unserer Glaubensbrüder aus den anderen Schwabendörfern hier im Kaukasus, die uns einen Teil ihrer Wintervorräte schenkten und uns mit Pferden und Vieh aushalfen, und ohne die finanzielle Unterstützung durch den Generalgouverneur in Tiflis hätten wir die Siedlung wohl nicht wiederaufbauen können.» Sie unterbrach ihre Arbeit erneut. «Inzwischen sind neue Auswanderer zu uns gestossen. Wir haben ihnen die leeren Häuser gegeben. Das Leben geht weiter. Eine neue Generation wird heranwachsen. Hoffentlich darf sie hier in Frieden und Gerechtigkeit leben.»
Am 18. August 1828 traf ein Kurier in Katharinenfeld ein und übergab Oberst Dreyling einen Brief. Vitus, der mit seinem Onkel ein Glas Cognac getrunken hatte, schaute zu, wie der Kommandant das Siegel studierte. «Aha, Iwan Fjodorowitsch, Graf von Jerewan, gibt sich die Ehre», knurrte er und riss den Umschlag auf. Dann vertiefte er sich in das Schreiben von General Paskewitsch, den der Zar nach seinem Sieg über die Perser in den Grafenstand erhoben hatte.
«Es geht gegen die Türken.» Dreyling liess das Blatt sinken und schaute seinen Neffen an. «Er will Alchaziche stürmen. Unser Regiment soll spätestens am 25. dort sein.» Er stand auf und studierte, die Hände auf dem Rücken, die Karte Transkaukasiens, die an der Wand hing. Er kniff die Augen zusammen, rechnete. Dann gab er sich einen Ruck. «Ihr trommelt die Bataillonskommandanten zusammen, Herr Leutnant!», befahl er. «In einer halben Stunde ist Befehlsausgabe. Morgen werden wir marschieren.»
Herr Leutnant. Vitus begriff. Die schönen Tage von Katharinenfeld waren vorbei. Er war wieder Adjutant. Man würde in einen neuen Krieg ziehen. Diesmal gegen die Türken. Natürlich. Als orthodox-christlicher Schutzherr unterstützte der Zar die aufständischen Griechen in ihrem Unabhängigkeitskampf gegen den Sultan. Im Juni hatten die Russen im Balkan die Donau überschritten und die Walachai erobert. Jetzt belagerten sie osmanische Festungen in Bulgarien. Offenbar hatte man höheren Orts beschlossen, in Transkaukasien eine zweite Front zu eröffnen.
Begleitet von den scheppernden Tönen der Regimentsmusik brachen sie am nächsten Tag in aller Frühe Richtung türkische Grenze auf: vier Infanteriebataillone, zweieinhalbtausend Soldaten in Viererkolonnen, das Gewehr mit dem aufgepflanzten Bajonett geschultert, auf dem Rücken den schweren Tornister. Neben ihnen, hoch zu Ross, die Offiziere. Am Schluss der Kolonne, gedeckt von vier Eskadronen Kosaken, der Tross: schwere Wagen, vor die man je sechs kräftige Gäule gespannt hatte. Sie waren beladen mit Proviant, Zelten, Waffen, Munition, Ersatzuniformen und dem Gepäck der Offiziere. Ferner einige Marketenderinnen, die auf ihren Karren jene kleinen Dinge mit sich führten, von denen ein Soldat glaubt, nicht ohne sie leben zu können: Schnaps, Tabak, Süssigkeiten und vieles mehr. Eine Gruppe Huren war auch dabei. Sie zogen den Männern den spärlichen Sold aus den Taschen und spendeten ihnen dafür die Illusion von Freude oder Trost. Je nachdem.
Unter der glühenden Augustsonne marschierte das Regiment durch die Graslandschaft am Fuss der Ausläufer des Kleinen Kaukasus. Jetzt im Hochsommer war die Zeit der zweiten Heuernte. In langen Reihen schritten die Mäher mit entblösstem Oberkörper durch die Wiesen. Unter ihren Sensen, mit denen sie im Gleichtakt weit ausholten, fiel das Gras, das von Mägden mit langen Rechen zum Trocknen gezettet wurde. Der Anblick der Landleute erinnerte Vitus an den Gutshof seines Vaters. Er lag an einem von Birken umstandenen Moorsee, unweit von Segewold, einem kleinen Städtchen, inmitten einer weiten, bewaldeten Hügellandschaft, durch die sich die livländische Aa ihren Weg zum Rigaer Meerbusen suchte.
Vitus’ Mutter, Amalie von Fenzlau, hatte dort mit ihren Söhnen jeweils die Sommerfrische verbracht. Wenn der Hauslehrer ihn und Gregor am frühen Nachmittag aus dem Unterricht entlassen hatte, pflegte sich Vitus auf dem väterlichen Hof herumzutreiben. Er half mit, wenn die Bauern, die Baron von Fenzlau Frondienst schuldeten, das Gras für die Winterfütterung des Viehs einbrachten. Er sah ihren Frauen und Töchtern zu, die morgens und abends die hundert Kühe melkten, und er stand neben Karl Schüpbach, wenn dieser die erwärmte und geronnene Milch mit der Käseharfe im grossen Kessel, der am Turner hing, verrührte.
Schüpbach, ein untersetzter kräftiger Mensch mit einem stets geröteten Nacken, war für die von Fenzlaus der Schweizer, wie die Balten den Beruf des Senns bezeichneten. Er war zuständig für die Überwachung der Herde, und er verarbeitete die Milch zu Butter und Käse, goldgelbe, kreisrunde Emmentaler, die vom Baron mit gutem Gewinn nach Sankt Petersburg verkauft wurden, wo man sie, wie es hiess, am Zarenhof schätzte. Das mochte wahr sein oder nicht. Schüpbach jedenfalls platzte fast vor Stolz, als er Vitus einmal verriet: «Dr Cheiser frisst myn Chäs.» Vitus, der sich häufig im Stall und im Käsekeller herumtrieb, verstand inzwischen, zumindest teilweise, den Dialekt des Senns, von dem die Baronin behauptete, er sei eine unmelodische Abfolge von Krachlauten.
Читать дальше