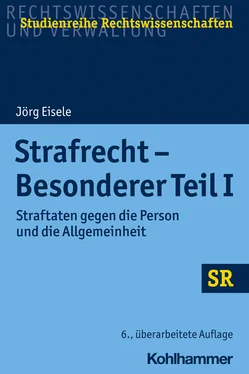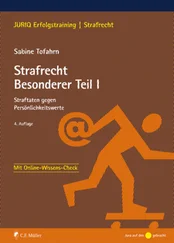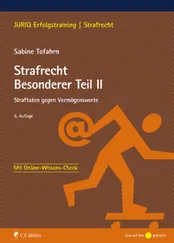102Ungereimt erscheint zunächst, dass der BGH in den sog. Haustyrannenfällen 302, in denen das Opfer den Angriff ebenfalls veranlasst, auf die tatsächliche Arglosigkeit abstellt und Korrekturen lediglich über die Rechtsfolgenlösung vornimmt. Für diese Unterscheidung könnte vielleicht noch angeführt werden, dass es bei Haustyrannenfällen regelmäßig an einem konkreten Angriff des Opfers fehlt, so dass der Getötete im Zeitpunkt der Tötungshandlung selbst bei normativer Betrachtung arglos war 303. Dennoch überzeugt es nicht, wenn der BGH auf das Kriterium der tatsächlichen Arglosigkeit des Opfers verzichtet und es genügen lässt, dass dieses mit einem Angriff rechnen muss. Denn auch ansonsten darf sich nach Ansicht des BGH die Arglosigkeit nicht „an Kriterien ausrichten, die auf die Feststellung eines fahrlässig verschuldeten Mangels an Abwehrbereitschaft hinauslaufen“. Die Arglosigkeit wird daher gerade nicht dadurch ausgeschlossen, „dass das Opfer nach den Umständen mit einem tätlichen Angriff hätte rechnen müssen“ 304. Erst recht sollte die Arglosigkeit daher bejaht werden, wenn zum Zeitpunkt der Tötungshandlung (ebenso wie in Haustyrannenfällen) kein gegenwärtiger Angriff des Erpressers i. S. d. § 32 vorliegt, sondern lediglich eine zuvor begonnene Erpressung als sog. Dauergefahr i. S. d. § 34 anhält 305.
Bsp.:O fordert von T telefonisch binnen einer Woche Zahlung einer Geldsumme, andernfalls werde er den T töten. – Begibt sich T daraufhin zu O und erschießt diesen hinterrücks, so wäre trotz der Erpressung eine heimtückische Tötung anzunehmen, da es zum Zeitpunkt der Tatbegehung an einer konkreten gegen die körperliche Integrität oder das Leben gerichteten Angriffshandlung des O fehlt. Jedoch wird man aufgrund der Dauergefahr – nicht anders als bei Haustyrannenfällen – die Rechtsfolgenlösung zu diskutieren haben 306.
103 (c)Und drittens folgt aus dem eben Gesagten, dass für die Beurteilung der Arglosigkeit grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Tathandlung, d. h. bei Tatbeginn, abzustellen ist 307. Eine Ausnahme wird jedoch für Fälle zugelassen, in denen der Täter das Opfer mit Tötungsvorsatz in einen Hinterhalt lockt oder ihm eine Falle stellt. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Frage, ob das Opfer arglos ist, soll hier nicht der Beginn der Tötungshandlung, sondern bereits das im Vorbereitungsstadium liegende hinterhältige Vorgehen sein. Demnach soll es ausreichend sein, dass das Opfer vom Täter mit Tötungsvorsatz unter Ausnutzung der Arglosigkeit im Vorbereitungsstadium in eine wehrlose Lage gebracht wird und diese geschaffene Wehrlosigkeit bis zur Tatausführung ununterbrochen fortbesteht, selbst wenn das Opfer inzwischen argwönisch ist 308. Begründet wird diese – dogmatisch jedoch nicht ganz zweifelsfreie – Ansicht damit, dass das Heimtückische in den Maßnahmen liegt, die der Täter ergreift, um eine günstige Gelegenheit zur Tötung zu schaffen, soweit diese bei der Ausführung der Tat noch fortwirken. Für die Annahme von Heimtücke lässt sich ferner anführen, dass dem Opfer durch die raffinierte Vorgehensweise des Täters bei der Vorbereitung bereits in diesem Stadium die Verteidigungsmöglichkeiten genommen werden 309.
Bsp.:T lockt den O unter einem Vorwand an einen abgelegenen Ort, um ihn zu töten. Dort angelangt, wird auch dem nunmehr wehrlosen O klar, was T geplant hat. – Tötet T den O, so verwirklicht er das Mordmerkmal der Heimtücke, weil die hinterhältige Vorgehensweise bis zur Tötung fortgewirkt hat.
104 (2) Auf Grund der Arglosigkeitmuss das Opfer wehrlossein, d. h. es muss gerade wegen seiner Arglosigkeit nicht zur Verteidigung im Stande sein 310. Kann sich das Opfer trotz Arglosigkeit noch aktiv wehren oder die Flucht ergreifen, so ist es nicht wehrlos. 311Beruht die Wehrlosigkeit auf anderen Gründen als der Arglosigkeit, etwa der körperlichen Unterlegenheit des Opfers, so scheidet Heimtücke aus, da es an der erforderlichen kausalen Verknüpfung fehlt.
Bsp.: 312O lässt sich von T beim Liebesspiel fesseln. T beschließt erst dann, diese Situation auszunutzen und die O zu töten. – Die Wehrlosigkeit der O beruht nicht auf deren Arglosigkeit, sondern auf der vorangegangenen Fesselung, bei der T noch keinen Tatentschluss besaß.
105 (3)Der Täter muss ferner die Arg- und Wehrlosigkeit in tückisch verschlagener Weisezur Tötung bewusst ausnutzen 313. Hierfür genügt es, dass der Täter sich bewusst ist, einen durch seine Sorglosigkeit gegenüber einem Angriff schutzlosen Menschen zu überraschen 314. Dies kann im Einzelfall zu verneinen sein, wenn der Täter spontan in hoher Erregung handelt oder ein psychischer Ausnahmezustand vorliegt, zwingend ausgeschlossen ist das Ausnutzungsbewusstsein hierdurch aber nicht 315. Nicht erforderlich ist, dass der Täter die überraschende Angriffsmöglichkeit gezielt herbeiführt 316oder ein konkretes Opfer sinnlich wahrnimmt. Daher kann die Arg- und Wehrlosigkeit auch ausnutzen, wer bei einem illegalen Autorennen den Tod eines anderen Verkehrsteilnehmers, den er nicht wahrnimmt, billigend in Kauf nimmt 317.
106 (4)Das Merkmal in feindseliger Willensrichtungwirkt tatbestandseinschränkend. Damit sollten bislang Fälle vom Mord ausgenommen werden, in denen der Täter „zum (vermeintlich) Besten“ des Opfers handelt 318.
Bsp.:Der Ehemann E mischt heimlich Gift in den Tee seiner todkranken Frau, um ihr weitere Leiden zu ersparen. – Obwohl E die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Ehefrau ausnutzt, sah der BGH darin bislang keine heimtückische Tötung, da E nicht in feindseliger Willensrichtung handelt. Entsprechendes sollte gelten, wenn der Täter im Rahmen eines Suizidversuchs Familienangehörige tötet, um diese nicht mit ihrem Schicksal allein zurückzulassen 319.
106aNunmehr hat der BGH seine Rechtsprechung korrigiert und möchte nur noch in Ausnahmefällen den Tatbestand verneinen 320. Im Übrigen müsse ein Schuldspruch wegen Mordes erfolgen. Außergewöhnliche Motive bzw. Umstände könnten grundsätzlich nur noch im Rahmen der sog. Rechtsfolgenlösung 321Berücksichtigung finden.
Bsp.: 322T ist hoch verschuldet und ihm droht eine Kündigung sowie eine Strafanzeige. Er möchte seine Ehefrau O von der existenzbedrohenden Situation verschonen, da ihre Gehfähigkeit eingeschränkt ist und sie aufgrund psychischer Niedergedrücktheit Psychopharmaka nimmt. Daher erschlägt er O im Schlaf.
Entscheidend ist für den BGH, dass das Mordmerkmal der Heimtücke nur die Begehungsweise der Tat – nicht aber die Motivation des Täters – betrifft und nur so die Bestimmtheit des Tatbestandes gewahrt bleibe; auch spreche der absolute Lebensschutz dafür, weil sich kein Dritter anmaßen dürfe, über das Leben des Opfers zu bestimmen, ohne dieses gefragt zu haben 323. Für das Bsp. argumentiert er, dass allein die O über ihr Leben, mag dieses auch mit Leiden behaftet sein, zu entscheiden hat. Für die Verneinung einer feindseligen Willensrichtung sollen lediglich Fälle verbleiben, in denen, wie etwa beim sog. erweiterten Suizid, beide Beteiligte in Willensübereinstimmung aus dem Leben scheiden möchten 324oder Kinder 325bzw. Todkranke 326nicht in der Lage sind, eine entsprechende Entscheidung zu treffen 327. Freilich verkennt der BGH insoweit, dass auch ansonsten der Tatbestand der Mordmerkmale restriktiv ausgelegt wird und bei einer Einwilligung des Opfers ohnehin regelmäßig die Arglosigkeit entfällt und darüber hinaus sogar die Privilegierung des § 216 vorliegen kann 328.
107 (5)Um Unbilligkeiten im Hinblick auf eine schuldangemessene Bestrafung zu vermeiden, werden im Schrifttum darüber hinaus weitere Einschränkungen vertreten. Wie bereits dargestellt, wird bisweilen eine negative oder positive Typenkorrekturverlangt 329, um so im Einzelfall den Tatbestand des § 211im Wege einer Gesamtwürdigung zu verneinen bzw. zu begründen. Nach anderer Ansicht soll das Merkmal der Heimtücke zusätzlich einen verwerflichen Vertrauensbruchvoraussetzen 330. Dagegen spricht, dass der Begriff des Vertrauens zu konturenlos ist und im Übrigen auch hinterhältige Attentate nicht erfasst werden könnten.
Читать дальше