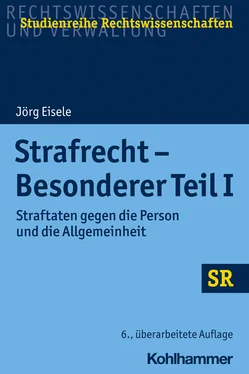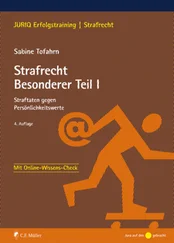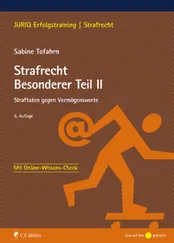94 (1) Arglosist dabei, wer sich zum Zeitpunkt der mit Tötungsvorsatz vorgenommenen Tathandlung keines Angriffs versieht 276.
95 (a)Das Opfer kann erstens überhaupt nur arglos sein, wenn es die Fähigkeit zum Argwohnbesitzt. Diese fehlt etwa bei Besinnungslosen, weil diese dem Angriff nicht entgegentreten können 277. Ferner wird diese auch bei sehr kleinen Kindern verneint, sofern deren Wahrnehmungsfähigkeit noch nicht ausgebildet ist und diese deshalb nicht fähig sind, anderen Vertrauen entgegen zu bringen 278. Das bloße Überlisten natürlicher Abwehrinstinkte von Kleinstkindern genügt dabei nicht 279.
Bsp.: 280T süßt den Brei des Kleinkindes K, damit dieses das tödliche Gift nicht bemerkt. – T macht sich nach § 212, nicht aber nach § 211 strafbar, da K noch nicht zum Argwohn fähig war.
96Ggf. kann bei Kleinstkindern und Bewusstlosen aber auf die Arglosigkeit schutzbereiter Dritter(z. B. Eltern, Aufsichtspersonal oder Ärzte) abgestellt werden 281. Schutzbereit ist dabei derjenige, der den Schutz vor Leibes- und Lebensgefahren dauernd oder vorübergehend übernommen hat und ihn im Augenblick der Tat entweder tatsächlich ausübt oder dies unterlässt, weil er dem Täter vertraut 282. Voraussetzung ist, dass der Dritte den Schutz wirksam erbringen kann, wofür eine gewisse räumliche Nähe 283und ein überschaubare Anzahl anvertrauter Personen erforderlich sind 284.
Bsp.: 285Vater T tötet seinen einjährigen Sohn O im Schlaf; im Nebenzimmer ist der 7 Jahre alte Bruder anwesend. – Heimtücke ist zu verneinen, wenn der ältere Bruder keine Schutzfunktion übernommen hat; O selbst fehlt die Fähigkeit zum Argwohn.
Der Täter muss den schutzbereiten Dritten aber nicht gezielt ausschalten, vielmehr genügt es, wenn der Täter die von ihm erkannte Arglosigkeit des Dritten bewusst zur Tatbegehung ausnutzt 286. Bedeutung hat dies in jüngster Zeit vor allem bei der Tötung bewusstloser Patienten erlangt.
Bsp.: 287Krankenschwester T spritzt in Anwesenheit von nahen Angehörigen oder Ärzten eigenmächtig ein Mittel, um den bewusstlosen und schwerkranken Patienten O, der zuvor nicht in die Tötung eingewilligt hat, zu töten; zudem schaltet sie an den Geräten eine Vorrichtung ab, die bei einer Verschlechterung des Zustandes Alarm auslöst. – T macht sich nach §§ 212, 211 strafbar, da sie heimtückisch handelte. O selbst war zwar zum Argwohn nicht fähig, jedoch nutzte T die Arg- und daher Wehrlosigkeit der schutzbereiten Dritten aus. Hätten die Anwesenden den Angriff bemerkt, wären sie eingeschritten; dies unterblieb aber, weil sie T als behandelnde Krankenschwester vertrauten und auch der Alarm unterdrückt war. Zu prüfen bleibt, ob T auch in feindseliger Willensrichtung handelte; das kann in engen Grenzen zu verneinen sein, wenn sie dem Patienten individuell weiteres Leid ersparen möchte 288.
97Im Gegensatz zu Kleinstkindern und Bewusstlosen soll hingegen ein Schlafendernach h. M. arglos sein können, da dieser seine Arglosigkeit „mit in den Schlaf nimmt“, indem er sich bewusst dem Schlaf im Vertrauen darauf hingibt, dass ihm nichts geschehen werde 289.
98 (b)Besitzt das Opfer die Fähigkeit zum Argwohn, so muss es zweitens zum Zeitpunkt der Tathandlunggrundsätzlich auch tatsächlich arglossein. Ein bloß generelles Misstrauen oder eine latente Angstvor Angriffen – wie etwa bei Soldaten im Auslandseinsatz 290– steht der Annahme der Arglosigkeit nicht entgegen 291. Selbst eine auf früheren Streitigkeiten und einer feindseligen Beziehung beruhende Angst des Opfers beseitigt dessen Arglosigkeit nicht.
Bsp.:Die ängstliche O befürchtet stets auf dem abendlichen Nachhauseweg von ihrem Ex-Freund T aus Rache angegriffen zu werden. Eines Tages wird sie von T hinterrücks erschossen. – T macht sich nach §§ 211, 212 strafbar, da sich O zum Zeitpunkt der Tat keines konkreten Angriffs versah. Das bloße generelle Misstrauen bzw. die latent vorhandene Angst beseitigt die Arglosigkeit der O nicht.
Es kommt vielmehr allein darauf an, ob das Opfer im Tatzeitpunkt mit Feindseligkeiten des Täters rechnet. Ist dies der Fall, so entfällt die Arglosigkeit selbst dann, wenn das Opfer einen schwächeren Angriff erwartet 292. Die Arglosigkeit kann daher ferner zu verneinen sein, wenn der Täter ein zweites Opfer tötet, nachdem dieses bereits den Angriff auf das Leben des ersten Opfers wahrgenommen hat 293.
99Arglos kann das Opfer auch bei einem offenen, aber überraschenden Angriffsein, wenn die Zeitspanne zwischen dem Erkennen der Gefahr und dem unmittelbaren Angriff so kurz ist, dass keine Möglichkeit bleibt, dem Angriff zu begegnen 294.
Das Opfer muss also keineswegs „hinterrücks“ angegriffen werden. Die Arglosigkeit kann im Einzelfall selbst dann vorliegen, wenn der Täter zunächst nur mit Körperverletzungsvorsatz angreift, dann aber ohne Abwehrmöglichkeit des Opfers zur Tötungshandlung übergeht 295oder zwar ein Angriff des Täters vorausgegangen ist, dieser aber bereits wieder beendet war 296. Entscheidend ist demnach, ob das Opfer im konkreten Fall mit einem Angriff auf sein Lebentatsächlich gerechnet hat 297. Ein der Tötungshandlung unmittelbar vorausgegangener, allein verbal geführter Angriff oder eine feindselige Atmosphäre schließen die Heimtücke nicht aus 298; Entsprechendes gilt, wenn im Rahmen einer einverständlichen Schlägerei völlig überraschend mit dem Messer ein Angriff auf das Leben geführt wird 299.
Bsp.:Zwischen T und O kommt es zu einem offenen Streit mit gegenseitigen Schlägen. T und O kommen dann aber überein, das Problem bei nächster Gelegenheit „in aller Ruhe“ zu besprechen. Als O gehen will, zieht T überraschend ein Messer und sticht O in die Brust. O ist sofort tot. – Dass zuvor eine Auseinandersetzung vorlag, steht der Arglosigkeit des O nicht entgegen, da zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der Beendigung des Streits der Angriff überraschend war. Auch dass der Angriff offen erfolgte, ändert daran nichts, da T das Überraschungsmoment nutzte und O daher in seiner Verteidigungsbereitschaft eingeschränkt war.
100Umstritten ist, ob vom Erfordernis der tatsächlichen Arglosigkeit des Opfers im Rahmen einer wertenden Betrachtung Ausnahmen zuzulassen sind. Um Ergebnisse zu vermeiden, die im Hinblick auf die lebenslange Freiheitsstrafe Bedenken begegnen, vertritt der BGH in Fällen, in denen der Täter vom Opfer erpresst wurde, eine restriktive Auslegung des Mordmerkmals und damit eine Tatbestandslösung. Da das Opfer mit seiner Erpressung den Gegenangriff selbst provoziert habe, sei dieses bei normativer Betrachtungnicht arglos.
Bsp: 300T vertreibt illegal Raubkopien von CD’s. O, der Kenntnis davon besitzt, erpresst den T mehrfach und droht, ihn bei der Polizei anzuzeigen. Eines Abends sucht O den T in dessen Wohnung auf, bedroht diesen und verlangt die Zahlung eines Geldbetrages. T holt das Geld und übergibt es dem O. Völlig überraschend tritt T nun plötzlich hinter O und tötet ihn. – T hat zunächst den Grundtatbestand des § 212 verwirklicht. Eine Rechtfertigung gem. § 32 scheidet aus 301. Zwar liegt (je nach Ausgestaltung des Sachverhalts) ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff des O auf das Vermögen des T vor, jedoch stellt die Tötung des O nicht das mildeste Verteidigungsmittel dar, so dass die Notwehrhandlung nicht erforderlich ist. Zu diskutieren bleibt, wie es sich auf das Mordmerkmal der Heimtücke auswirkt, dass der Tat des T die Erpressung des O vorausging.
101Der BGH ist in der eben genannten Entscheidung der Auffassung, dass es regelmäßig der Angreifer sei, der durch sein Verhalten einen Gegenangriff herausfordere. Er müsse daher mit der Ausübung des Notwehrrechts grundsätzlich rechnen. Bei wertender Betrachtung sei es nicht systemgerecht, dem sich wehrenden Opfer das Risiko aufzulasten, bei Überschreitung der rechtlichen Grenzen der Rechtfertigung sogleich das Mordmerkmal der Heimtücke zu verwirklichen. Folglich müsse die Arglosigkeit des Erpressers und damit auch die Heimtücke verneint werden.
Читать дальше