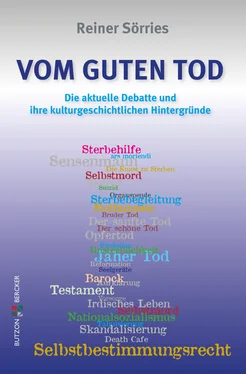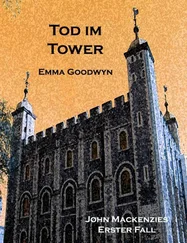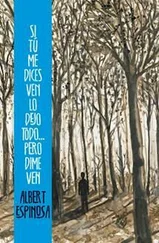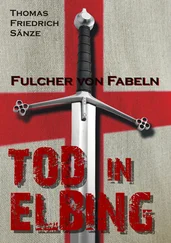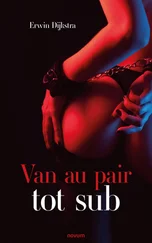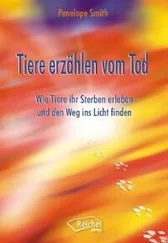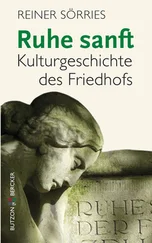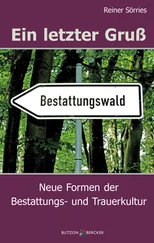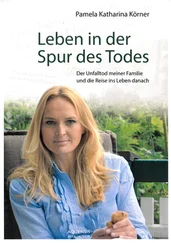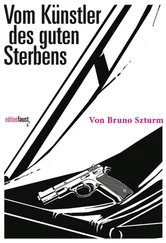Reiner Sörries - Vom guten Tod
Здесь есть возможность читать онлайн «Reiner Sörries - Vom guten Tod» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Vom guten Tod
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Vom guten Tod: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Vom guten Tod»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die aktuelle Debatte um ein Recht auf Selbstbestimmung auch im Sterben bekommt durch diesen kundigen Blick in die Geschichte eine ganz neue Orientierung.
Vom guten Tod — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Vom guten Tod», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Diese schlichte Betrachtungsweise stieß jedoch nicht nur auf den Widerstand der kirchlichen Lehrmeinung, sondern sie ging auch am Wollen und Sehnen der Menschen, ob gläubig oder nicht, vorbei, die ihren individuellen Tod nicht nur eingebettet sehen wollten in das Große und Ganze, sondern doch von ihren Fragen nach dem Sinn des Lebens – und des Todes – nicht ablassen wollen. Unter dieser Voraussetzung kann die evolutionäre Sinngebung des Todes, der an sich weder gut noch schlecht, sondern einfach nur notwendig ist, nicht weiterhelfen. Die allermeisten Menschen suchen eine Antwort auf die Frage, warum sie leben und warum sie sterben, und viel mehr noch wie sie sterben, wodurch und wann und wofür.
III. „Es hat Gott gefallen …“
Braucht also der Tod eine Erklärung? Und ist er nicht erst sinnvoll, wenn nicht nur sein Faktum, sondern auch das Wie, Wo und Wann von einer höheren Macht bestimmt werden? Stand es nicht lange in unseren Agenden zur kirchlichen Bestattung: „Nachdem es dem allmächtigen Gott gefallen hat, unseren Bruder / Schwester N. N. aus diesem Leben abzurufen …“? Es mag eine unzeitgemäße Formulierung sein, dass Gott am Tod eines Menschen seinen Gefallen hat, aber als Christ darf man durchaus glauben, dass Anfang und Ende des Lebens in seinem großen Ratschluss ge- und verborgen sind. Im Alten Testament ist zu lesen, dass Gott das Lebensalter begrenzt: „Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist; daher soll seine Lebenszeit hundertzwanzig Jahre betragen.“ (Genesis 6,3) Somit ist biblisch ausgeschlossen, dass der Mensch ewig lebt. Aber auch die individuelle Lebensspanne wird von Gott bestimmt. Im Alten Testament bekennt der fromme Beter: „Meine Zeit steht in deinen Händen“ (Psalm 31,16), und im Neuen Testament wird folgender Satz von Jesus überliefert: „Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?“ (Matthäus 6,27)
Biblisch wurzelt die Bestimmung des Menschen zum Tode im Sündenfall, und sie dürfte zunächst auch nicht hinterfragt werden, wenngleich man ihr statt der religiösen Begründung auch eine biologische zugrunde legen kann. Allerdings müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt auf das posthumane Menschenbild des Trans- oder Posthumanismus zu sprechen kommen. Unterschiedlich kann jedoch beurteilt werden, ob Gottes Wille auch den Zeitpunkt des Ablebens bestimmt und dieser gewissermaßen vorbestimmt ist. Bemühen wir das Alte Testament, so kann man dieser Auffassung durchaus zustimmen, wenn es etwa heißt: „Der Herr macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf.“ (1 Samuel 2,6) Im Prinzip teilen die christlichen Kirchen die Auffassung, dass allein Gott Herr über Leben und Tod ist, wenngleich theologisch kontrovers diskutiert wird, wie konkret man sich die Bestimmung des Todeszeitpunktes durch Gott vorstellen soll. Gott will das Leben, weshalb etwa die Selbsttötung einerseits, die Todesstrafe andererseits von vielen Theologen und Gläubigen abgelehnt werden. Immerhin kollidiert die göttliche Vorsehung mit dem postulierten freien Willen des Menschen, der sich selbst oder andere töten kann, und man sträubt sich gegen den Gedanken, dass Suizid oder Mord von Gott bestimmt ist.
Eindeutiger ist die Auffassung im Islam, für den Allah das Schicksal der Welt und des Individuums in allen Bereichen lenkt: „Wenn Allah die Menschen für alle ihre Sünden strafen würde, würde Er nichts, was sich regt, auf Erden belassen. Jedoch Er gewährt ihnen bis zu einem bestimmten Termin Aufschub. Doch wenn ihr Termin gekommen ist, können sie ihn weder um eine Stunde verschieben noch beschleunigen.“ (Sure 16,61) Daraus kann eine gewisse Tröstung resultieren, wenn der Tod eines Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich Gottes Wille ist. Warum sollte man sich dann gegen das Ende wehren, wodurch auch immer es hervorgerufen wird?
Andererseits ist Gott ein Gott, der unbedingt das Leben will. So glauben wir Christen es. Wie rasch verbirgt sich dann der als vorzeitig oder unzeitig empfundene Tod hinter unendlich vielen Fragen! Hat es Gott gefallen, Katastrophen, Unglücksfälle oder Kriege, eine schwere, tödliche Erkrankung mitten im Leben oder gar über ein Kind hereinbrechen zu lassen? Es war erst in unserer Zeit, als der Schweizer Theologe, Schriftsteller und Lyriker Kurt Marti es wagte, Gottes Gefallen am Tod eines Menschen ins Gegenteil zu verkehren. In seinen berühmten, 1969 verfassten Leichenreden dichtete Marti:
dem herrn unserem gott hat es ganz und gar nicht gefallen dass gustav e. lips durch einen verkehrsunfall starb
Einer zeitgemäßen Theologie will es nicht mehr gelingen, dem Tod eines Menschen einen Sinn abzugewinnen, zumindest keinen, der über das Grundmotiv der allgemeinen Sterblichkeit hinausginge. Es kann Gott nicht gefallen haben, dieses Leben so oder so enden zu lassen, zugleich darf es sich aber auch nicht gegen Gottes Willen ereignet haben. Aber selbst wenn man hinter jedem Sterben, so sehr es uns auch irritieren und verunsichern kann, die Allmacht Gottes postuliert, lässt sich daraus kaum mehr ableiten, was denn als guter Tod zu verstehen sein soll.
Im Tod des Ungerechten mag man rasch eine gerechte Strafe vermuten; dann würde der Tod wieder Sinn machen. Doch woraus resultiert der Tod eines (scheinbar) rechtschaffenen Menschen? Immerhin könnte man hinzufügen, dass niemand ohne Schuld ist, und sei es, dass er die Schuldenlast des ersten Menschenpaares in Gestalt der Erbsünde in sich trägt. Das mag sogar akzeptabel sein, wenn ein Mensch nach einem langen und erfüllten Leben heimkehren darf zu seinem himmlischen Vater. „Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand; der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland“, dichtete Paul Gerhardt 1666. Ist das Leben eine Pilgerreise durch fremde Gestade, dann beginnt an der Schwelle des Todes die Heimkehr zur wahren Bestimmung des Menschen. Kein Tod ist dann vergebens, denn er bringt zurück, was in der Fremde verloren war.
Es soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden, wie tragfähig dieses Grundmuster christlichen Glaubens einst war und heute ist, auch weil dies eine sehr persönliche Frage ist. Aber die Vorstellung vom Tod als Pforte zur wahren Heimat darf nicht dazu führen, den Tod herbeisehnen oder gar herbeiführen zu wollen. Darin sind sich Judentum, Christentum und Islam einig, dass das Leben ein Gottesgeschenk ist, das man nicht leichtfertig oder vorsätzlich wegwerfen darf. Diese Religionen stimmen deshalb darin überein, dass Suizid und bewusste Lebensverkürzung unzulässig sind. Mit einer derartigen Grundhaltung ist die Haltung der Religionen gegenüber den gegenwärtig diskutierten Sterbeszenarien durchaus vorbestimmt. Außer dem von Gott gewollten, bestimmten und natürlichen Sterben kann es einen guten Tod nicht geben.
Dass der Tod für den Menschen unverfügbar ist, belegt auch der stets wiederkehrende Topos von der Ungewissheit der Todesstunde: Mors certa, hora incerta – Der Tod ist gewiss, ungewiss ist die Stunde. Niemand weiß, wie nahe ihm sein Ende, ist und wann es eintritt, denn der Tod kommt wie der Dieb in der Nacht. Zumindest aus dieser Betrachtungsweise ist dem Menschen ein wie auch immer gearteter Eingriff in das Todesgeschehen nicht gestattet, denn er würde die Allmacht Gottes verletzen. Spätmittelalterliche Predigten belegen, dass diese Botschaft ein wichtiger Bestandteil kirchlicher Unterweisung gewesen ist: „Das drit ist das der mensch nit weis / wann er stirbt ob es nachts ist oder tages ob er in dem sumer stirbt oder in dem winter / es ist nichts gewisers wann der tod . Aber nichts ungewiser wann die zeit des todes“, heißt es in einer deutschen Predigthandschrift aus dem Klarissenkloster in Brixen. 10
Doch trotz eindeutigem Bekenntnis zum Leben kennen alle drei Religionen das Martyrium, in dem Menschen unter bestimmten Voraussetzungen ihr Leben freiwillig preisgeben. Märtyrerinnen und Märtyrer genießen dabei nicht nur Verständnis, sondern sogar Bewunderung und Verehrung. In der Beurteilung dieses Sachverhaltes tun wir uns leichter, wenn sich die Martyrien unter irgendeinem römischen Kaiser in ferner Vergangenheit ereignet haben. Knochen und Gebeine frühchristlicher Märtyrer ruhen in goldenen Schreinen und fordern zur Andacht heraus. Aber auch noch in den KZs der Nationalsozialisten fanden sich Männer und Frauen, die in altruistischer Weise ihr Leben für andere dahingaben und die unseren Respekt genießen. Schwer tun wir uns mit jenen Märtyrern, die aus Glaubensüberzeugung sich selbst töten und andere mit in den Tod reißen. Entscheidend ist immer der kulturelle oder religiöse Blickwinkel. In keinem Fall können wir mit Sicherheit sagen, dass es Gott gefallen hat. Doch für die, die daran glauben, ist es ein guter Tod.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Vom guten Tod»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Vom guten Tod» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Vom guten Tod» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.