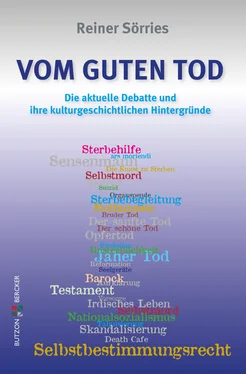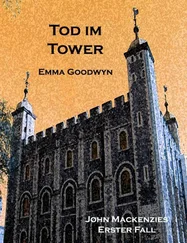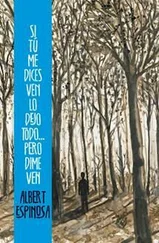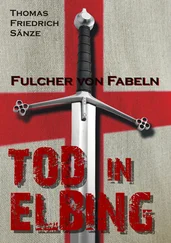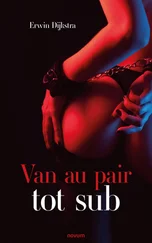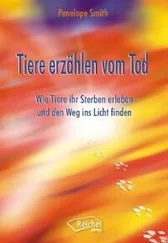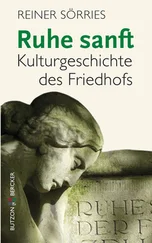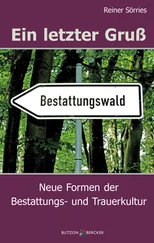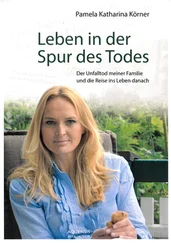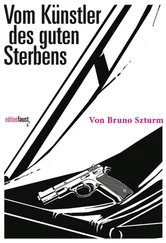Als ich im Februar 2014 mit dem Schreiben dieses Buches begann, hatte das belgische Parlament am 13. Februar dem Gesetz zugestimmt, dem zufolge es auch Minderjährigen ohne Altersbeschränkung erlaubt sei, nach aktiver Sterbehilfe zu verlangen – wohl unter strengen Voraussetzungen, aber damit war ein weiterer Schritt getan, um auf dem Weg zur Selbstbestimmung voranzuschreiten. Wie rasch andere europäische Länder ihre Gesetze verändern oder gar der europäische Gerichtshof aufgrund von Klagen eigene Vorgaben macht, muss abgewartet werden, aber die Tendenz ist offenkundig. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der das, was ein guter Tod ist, anders formuliert sein wird als gestern oder heute. Aus unserer kulturgeschichtlichen Annäherung an das Thema werden sich kaum Kriterien für den guten Tod der Zukunft ableiten lassen, vielmehr wird sie zeigen, dass das, was man dafür hält, abhängig ist von einem wie auch immer definierten Wertesystem. Hatten die Gesellschaften bisher das Glück, dieses aus einer zumindest weitgehend einheitlichen Weltanschauung zu entwickeln, so haben wir dieses Privileg in einer pluralistischen Gedankenwelt verloren. Die Gedanken sind frei.
Allerdings wird aus historischer Perspektive auch deutlich, dass der Kanon der Werte im Laufe der Geschichte nicht nur Änderungen erfuhr, sondern Grauen erregenden Irrungen unterworfen sein konnte. Selbst die einzigartige Einsicht von der Einmaligkeit und Unverfügbarkeit des Lebens, die in Gesetzestafeln gemeißelt lautet: Du sollst nicht töten , hat nicht verhindert, dass sich die Eliten immer wieder das Recht anmaßten, Ausnahmen davon zu formulieren. Allein die Geschichte der Todesstrafe belegt dies eindrücklich. Übeltäter, Ungläubige, Ketzer oder andere missliebige Menschen hatten schnell ihr Recht auf Leben verwirkt. Kriege verführten zu dem Gedanken, den Tod des Feindes wie den eigenen für einen guten Tod zu halten. Oder es dienten allein die Unterscheidungen in Herr und Knecht dazu, dem einen das Recht über das Leben des anderen einzuräumen. Religionen, Philosophien und Weltanschauungen lieferten dazu den gedanklichen Überbau. Und dies wird heute und morgen nicht anders sein. Immer wieder werden Begründungen dafür gefunden, warum der Tod dem Leben vorzuziehen ist – ganz im Gegensatz zur Weisheit der Bremer Stadtmusikanten.
II. Der Tod als Baustein der Evolution – Alte und neue Gedanken
Das Bewusstsein des Menschen ist an allem schuld, zumindest wenn es um die Sinnsuche geht, die in der Frage nach dem Sinn des Todes gipfelt. Betrachtet man den Menschen als die Krone der Schöpfung, so wird gern auf dieses Wissen um die eigene Endlichkeit verwiesen, das ihn vom Tier unterscheide. Oder was ist es sonst? Alle anderen Unterschiede wie etwa die Fähigkeiten kreativen Denkens und ein freier Wille, sein Sprachvermögen, die Wahlfreiheit usw. sind eher gradueller Art infolge einer höheren Entwicklungsstufe. Aber schon der Versuch, das Menschsein am Bewusstsein festzumachen, erweist sich als höchst problematisch. Embryonen, Säuglinge, geistig schwer Behinderte oder Komapatienten verfügen möglicherweise über ein derartiges Bewusstsein nicht und sind dennoch Menschen im Vollsinn. Muss man also deshalb nicht doch die Religion zu Rate ziehen, die in unterschiedlichen Ausprägungen dem Menschen eine immaterielle Seite zuweist, die wir etwa im Christentum Seele nennen? Wer jedoch diese immaterielle Wesenheit nicht akzeptiert, kann möglicherweise Schwierigkeiten haben, einen Mensch-Tier-Unterschied festzumachen, wird dies aber vielleicht auch nicht als problematisch empfinden. Warum soll man sich nicht auf die Regeln der Evolution verlassen, in der der Tod ein notwendiger und deshalb sinnvoller Baustein des Lebens ist?
Der Sinn des Todes in der Evolution
Die Natur favorisiert vor allem die Fähigkeit, mit den Herausforderungen des Lebens, speziell den sich wandelnden Umwelteinflüssen, fertig zu werden. Dies geschieht, so verdeutliche ich mir das laienmäßig, indem eine Generation ihr Wissen an die nächste weitergibt. Dies kann durch die Vermittlung bestimmter Sachverhalte geschehen, aber auch durch die Weitergabe genetischen Materials. Wenn sich die Gene von Mann und Frau vereinigen, so entsteht eine neue Variante des Erbgutes und damit die Möglichkeit, dass sich das Leben besser an die Bedingungen der Umwelt anpasst. Über die Natur sagte Johann Wolfgang von Goethe, das Leben sei ihre schönste Erfindung und der Tod ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben. 1Evolutionäres Ziel ist demnach kein ewiges, ja nicht einmal ein besonders langes Leben, sondern eine möglichst effektive und fortschrittliche Reproduktion. Dazu ist es dann nicht notwendig, dass die Elterngeneration ein hohes Alter erreicht, vielmehr hat sie ihre Aufgabe mit der Schaffung neuen Lebens und der erfolgreichen Aufzucht der Nachkommenschaft erfüllt.
Sterblichkeit und zweigeschlechtliche Sexualität hängen evolutionär gesehen eng miteinander zusammen, weil sie beide demselben Zweck dienen. Es geht um die bestmögliche Selbsterhaltung und Weiterentwicklung der jeweiligen Spezies, und darin unterscheiden sich die höheren Organismen nicht voneinander. Die Evolution sorgt sich nicht so sehr um die Bedürfnisse des Einzelnen als vielmehr um das große Ganze.
Im Folgenden wird es zunächst darum gehen, nach Gesellschaftsmodellen zu suchen, in denen diese evolutionäre Sichtweise ein tragendes Element der Sinnsuche sein kann.
Deine Nachkommenschaft wird zahlreich sein wie die Sterne am Firmament
Mit dieser Verheißung an Abraham (Genesis 15,5) vollendet sich seine Lebensgeschichte, die bis in sein hohes Alter von Kinderlosigkeit bedroht war, und darin spiegelt sich ein Verständnis von Leben, das einer evolutionären Betrachtungsweise sehr nahe kommt. Denn ob ein Dasein sinnerfüllt ist, zeigt sich in der Weitergabe des Lebens an Kinder und Kindeskinder. Eine individuelle Erwartung eines Lebens nach dem Tod ist dem Alten Testament wie dem ganzen Orient fremd, weshalb sich die Frage nach einem guten Tod relativiert. Der Tod ist eine biologische Notwendigkeit. Wer stirbt, wird nicht wieder lebendig, heißt es bei Ijob (14,14), und gegen den Tod lässt sich keine Beschwerde führen (Jesus Sirach 41,3–4): Alle Menschen müssen sterben. Als guten Tod kann man einen ansehen, der nach einem langen und erfüllten Leben eintritt, und so sterben Abraham, Isaak oder Ijob alt und lebenssatt. Dann werden die Menschen zu den Vätern versammelt, wo sie in einem düsteren Totenreich ein trostloses Schattendasein führen.
Im Gegensatz zu diesem Tod, der eintritt, wenn der Mensch satt an Tagen ist, was einer Spanne von siebzig oder achtzig Jahren (Psalm 90,10) entspricht, fürchtet man den unzeitigen Tod eines Kindes oder durch Krankheit, Gewalt, Krieg und Hungersnot, der das Leben unerfüllt abschneidet. Eine etwa daraus resultierende Kinderlosigkeit gehört zu den Schrecknissen eines vorzeitigen Todes. Von der Vorstellung eines guten Todes wird man im Alten Testament wohl absehen müssen; eher kann man von einem erfüllten Leben sprechen, wenn es in der Heimat und im Kreis der Familie geschieht, die dann auch für eine angemessene Bestattung sorgt. Der Tod an sich bleibt ein endgültiges und unwiderrufliches Geschehen. Man kann deshalb sagen, dass sich das Alte Testament in großer Nähe zu einer Interpretation gemäß der Evolution befindet. Wichtig ist der Fortbestand der Familie, der Sippe und des Volkes, weshalb die Zusage einer reichen Nachkommenschaft an Abraham mehrfach wiederholt wird (Genesis 22,17; 26,4).
Erst in nachexilischer Zeit und vor allem in der jüdischen Apokalyptik entwickelt sich die Vorstellung von einer Gottesgemeinschaft des Frommen auch jenseits der physischen Todesgrenze, auf die hier aber noch nicht eingegangen werden muss. Wichtig ist jedoch, dass die Anfänge einer Auferstehungshoffnung das Volk als Ganzes betreffen, wenn Gott das Volk heilt und neu belebt gleich dem Geschehen in der Natur: „… denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet.“ (Hosea 6,3) Ebenso bietet die berühmte Erzählung von der Erweckung der Totengebeine (Ezechiel 37,12) ein Bild für die Wiederherstellung des Volkes Israel und für den neuen Exodus aus dem babylonischen Exil: „Siehe, ich öffne eure Gräber und ich führe euch herauf aus euren Gräbern und ich bringe euch ins Land Israel.“ Das Individuum spielt noch keine Rolle, und eine eigentliche Auferstehungsvorstellung findet sich erst in der apokalyptischen Literatur der hellenistischen Zeit.
Читать дальше