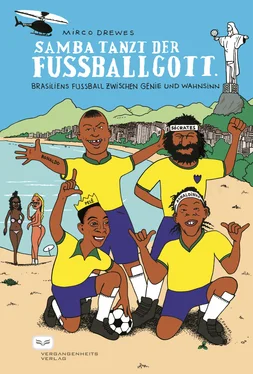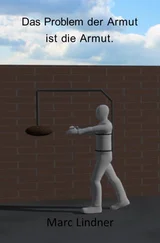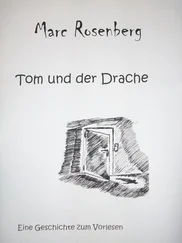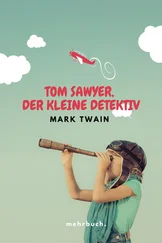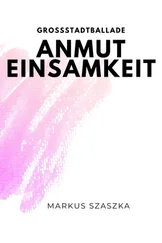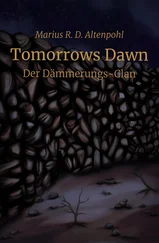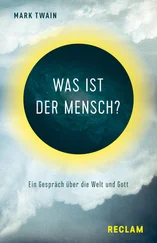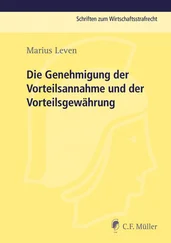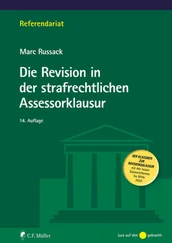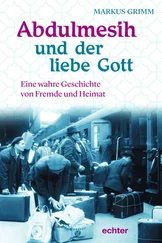In dem Moment, in welchem der Schlusspfiff den Sieg Brasiliens besiegelte, war auch die „unverhofft Erschienene“ als Nationalheilige in Sachen Fußball etabliert.
Genau wie in Deutschland gelten auch in Brasilien die Torhüter als die Abergläubischsten aller Spieler. Im Unterschied zu den Gepflogenheiten hierzulande – Deutschland ist für seine grundsolide ausgebildeten Torwächter berühmt – erwartet man in Brasilien vom Torhüter nicht, dass er einen grundsoliden und sachlichen Job macht und keine Patzer begeht. Brasilianische Torhüter stehen vor der Alternative als Aussätzige oder Heilige angesehen und behandelt zu werden. Barbosa, der unglückliche Torhüter des verlorenen Finales 1950, wurde zeitlebens als Totengräber Brasiliens diskriminiert; hingegen wurde Claudio Taffarel, der Weltmeistertorhüter von 1994, nach dem gehaltenen Endspiel-Elfmeter des Italieners Daniele Massaro in mehreren Songs als „Schutzengel Sankt Taffarel mit den wundersamen Händen“ besungen und geehrt. Vor dieser zugespitzten Erwartungskonstellation mag es kaum Wunder nehmen, wenn brasilianische Torhüter einen ausgeprägten Wunderglauben entwickeln und einen besonders guten Draht zum Fußballgott aufzubauen trachten. Exemplarisch für diese besonders prekär lebende Fußballspezies Brasiliens stand der Tormann Darci, der stets einige Minuten vor Spielbeginn sein persönliches Ritual aufführen musste, um sich sicher zu fühlen: Er dribbelte mit dem Ball im Mittelkreis einmal rund um den Schiedsrichter, kniete anschließend zum Gebet nieder, drosch danach einige Bälle ins leere gegnerische Tor, um schließlich, zwischen die eigenen Pfosten zurückgekehrt, seine Torlinie mit dem Fuß nachzuzeichnen und das eigene Tor auratisch zu versiegeln. Danach durfte es losgehen.
Botafogo und der magische Hund
Es war für Darci gewiss wichtig, seinem Beruf in einem Umfeld nachgehen zu können, in dem derartige Marotten auf Verständnis stießen. Die Grenzen dessen, was selbst für einen abergläubischen Menschen noch nachvollziehbar ist, lotete in den 1940er- bis 1950er-Jahren Carlito Rocha aus. Jener Rocha war Präsident des Klubs Botafogo aus Rio de Janeiro, was bedeutete, dass sein persönlicher Glaube an Rituale qua Amtsautorität den gesamten Klub in Atem hielt.
Als der Fahrer des Mannschaftsbusses einst in falscher Richtung in eine Einbahnstraße einbog und umkehren wollte, untersagte dies der Präsident persönlich umgehend: „Botafogo geht niemals rückwärts. Das bringt Unglück.“ Für die Spieler bedeutete dies, dass sie den Weg zum Stadion zu Fuß fortsetzen mussten. Sollten die Kicker beabsichtigt haben, auf dem Fußmarsch zum Stadion ihre Fußballschuhe einzulaufen, so hätten sie in ihren Tretern Zettel mit den Namen ihrer jeweiligen Gegenspieler vorgefunden. Der Präsident präparierte die Schuhe seiner Angestellten am Tag des Spiels dergestalt, dass das Herumtrampeln auf den kleinen, die Gegner verkörpernden, Voodoo-Zetteln deren Aura negativ beeinflussen sollte. Unterstützend wurden die Vorhänge im Botafogo-Klubhaus vor jedem Spiel zusammengeknotet, eine symbolische Fesselung des Gegners.
Bei Auswärtsspielen verstreute der Präsident ein Kilo Zucker auf der Stadionmauer des Gegners. Die magische Wirkung des Zuckers lässt sich womöglich auf die frühere Sklavenarbeit der Afrobrasilianer in den Zuckerrohrplantagen zurückführen, die seit dem 17. Jahrhundert den Voodoo nach Brasilien gebracht hatten. Neben diesem Schadenszauber, den Präsident Rocha dem Gegner angedeihen ließ, führte er eine im Laufe der Zeit wachsende Zahl an Talismanen mit sich. Um diese beisammenhalten zu können, ließ sich der Präsident schließlich eine riesenhafte Sicherheitsnadel anfertigen, an der er sie nun gesammelt um den Hals tragen konnte. Der edlen Überlegenheit Botafogos angemessen wurde die im doppelten Sinn Sicherheit gebende Nadel aus Gold hergestellt.
Die Spieler Botafogos waren selbst vor körperlichen Übergriffen ihres Vereinsvorsitzenden, natürlich im Dienste der gemeinsamen guten Sache, nicht sicher. Um zu verhindern, dass seine Spieler vergiftet werden konnten, bereitete der Präsident den Spielern das Essen eigenhändig vor. Ist über die Kochkünste Senhor Rochas nichts bekannt, so ist doch überliefert, dass dieser seine Finger beim Kochen im Haar des ihm jeweils nächststehenden Spielers reinigte.
Was im Verdacht stand, auf irgendeine geheimnisvolle Weise Botafogos Erfolg zuträglich zu sein, wurde gnadenlos durchexerziert. Und selbstverständlich auch vice versa: 1945 träumte der Botafogo nahestehende Sportjournalist Geraldo Romualdo da Silva, dass der Klub im nächsten Spiel über ein Unentschieden nicht hinauskommen würde. Als Botafogo sogar das Spiel verlor, wurde umgehend angeordnet, den somnambulen Unglücksraben vom Träumen abzuhalten. Wie dies zu bewerkstelligen war? Ganz einfach: Die Vereinsführung buchte dem Journalisten am Abend vor den Spielen einen Platz im besten Kasino der Stadt, Angestellte des Klubs holten diesen zur Sperrstunde ab und unterhielten den Journalisten ununterbrochen bis zum Spielbeginn. Mit Schlaf war es in dieser Saison nichts für da Silva, zumindest nicht am Wochenende.
Galt Carlito Rocha infolge derartiger Exzesse 1948 als der abergläubischste Vereinsboss Brasiliens, so führte ihm der Zufall in jenem Jahr seinen kongenialen Partner zu, mit dem gemeinsam Carlito Rocha fortan das legendärste Tandem in der Geschichte sportlichen Aberglaubens bildete: Biriba, einen Promenadenmischling von magischer Prominenz.
Das Debüt des berühmtesten Vierbeiners der Fußballhistorie fand in einem an sich unspektakulären Rahmen statt. Einem Ersatzspieler Botafogos namens Macaé war der herrenlose Straßenköter zugelaufen, just an einem Tag, als Botafogos Reserve ein ansonsten recht bedeutungsloses Spiel gegen Bonsucesso, eine unterklassige Mannschaft aus Rio, austrug. Da Macaé auf die Schnelle nicht wusste, wohin mit dem Hund, nahm er diesen mit zum Spiel. Lange Zeit hielt der Hund brav neben der Ersatzbank aus, bis er plötzlich bei einem Angriff Botafogos wie von der Tarantel gestochen auf den Platz in Richtung gegnerisches Tor stürmte. Der Schlussmann Bonsucessos griff, durch die Tatsache irritiert, dass sich neben den gegnerischen Stürmern und dem Ball noch ein Hund in seinem Strafraum aufhielt, an einem harmlosen Schuss vorbei. Macaé mag zunächst im Boden versunken sein, da er auf sein neues Haustier nicht besser acht gegeben hatte, zumal bei diesem Testspiel der unberechenbare Präsident zuschaute. Doch in dem Moment da der Schiedsrichter das Tor gab, stand für Präsident Carlito Rocha eines fest: Diesen Hund hatte der Himmel geschickt. Der Botafogo gewogene Fußballgott hatte Gestalt angenommen – als schwarz-weiß gemusterter Bastard. Daran konnte kein Zweifel bestehen, schließlich trug der Hund in seinem Fell die Vereinsfarben.
Hatte Macaé zunächst mit einigem Ärger gerechnet, so durfte er sich stattdessen einer plötzlich eingetretenen und nachhaltigen Wichtigkeit für seinen Verein erfreuen. Zwar nicht als Spieler, so aber doch als persönlicher Betreuer des magischen Hundes, der innerhalb kürzester Zeit das Maskottchen des Vereins wurde. Biriba, so ordnete der Präsident an, hatte fortan jedem Botafogo-Spiel beizuwohnen.
Tatsächlich stellte sich unter Biribas Ägide ein deutlicher Aufwärtstrend der Mannschaft ein. Um die magische Wirkung des Hundes zu befördern, bekam Biriba vom Mannschaftskoch Botafogos auf Weisung Rochas vor jedem Spiel ein Festmahl zubereitet. Manche Spieler mochten munkeln, der Hund werde besser versorgt als sie selbst, doch der Erfolg gab Carlito Rocha recht, wenn man auch nicht von einem wissenschaftlich validen Kausalzusammenhang sprechen konnte.
Biriba war bald nicht mehr nur als Glücksbringer wichtig, in engen Partien kam der Hund auch zu spektakulären Sondereinsätzen: Drohte ein Spiel zuungunsten Botafogos zu kippen, ließ Präsident Rocha den munteren Mischling aufs Feld jagen. Nach der nötigen Spielunterbrechung, um den Hund einzufangen, fand der Gegner nicht selten nicht mehr zu seinem Spiel-Rhythmus.
Читать дальше