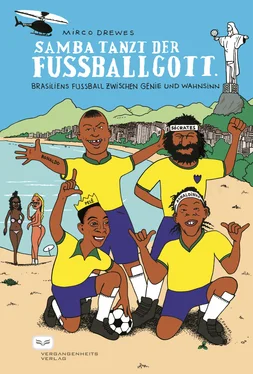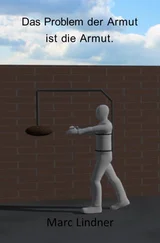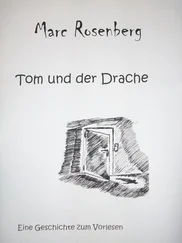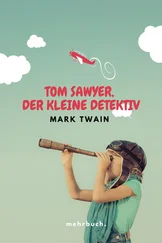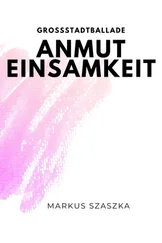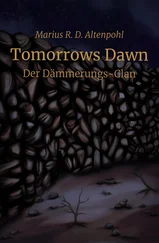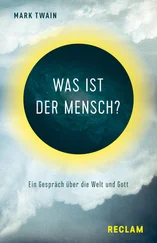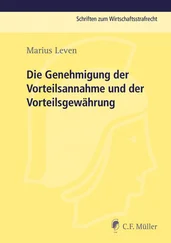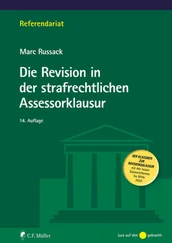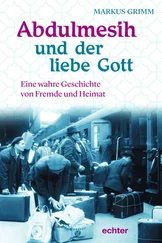Wenn sich das Geschäft mit dem Fußball einem weltweiten Umsatzvolumen von jährlich 300 Milliarden Dollar annähert, sollte dessen sozial-pädagogische Bedeutung nicht nur Thema für Sonntagsreden sein, sondern mit entsprechenden Mitteln gefördert werden. In all seiner Widersprüchlichkeit, Schönheit, Grausamkeit und Komplexität bleibt der Fußball in erster Linie ein kultureller Ausdruck vieler Gesellschaften in der ganzen Welt.
Brot oder Spiele?
Dass der Ausdruck der die Gesellschaft prägenden Gegensätze und Paradoxien in Brasilien besonders deutlich ausfällt, zeigt auch die Ausstattung mit ansprechenden Fußballstadien, die sich unzählige ansonsten sehr arme Gemeinden leisten – und dies nicht selten nicht einmal gegen den Willen der Einwohner. Vorreiter des fast massenweisen Baus von Fußballstadien war während der 1970er-Jahre die Militärregierung, die mit prachtvollen Fußballarenen Symbole des Nationalstolzes errichten wollte. 1978 verfügte Brasilien laut dem Guiness-Buch der Rekorde über 27 Stadien mit einem Fassungsvermögen von mindestens 45.000 Zuschauern und fünf Stadien, die mehr als 100.000 Zuschauer aufnehmen konnten. Die Mentalität des „Hast du was, bist du was“ wurde und wird bis heute auch von kleinen und wirtschaftlich marginalen Gemeinden gelebt.
Alex Bellos berichtet über die kleine Stadt Brejinho im staubtrockenen und glutheißen Nordosten des Landes. 1993 war die Gegend von einer anhaltenden Dürreperiode betroffen, deren Folgen für die ärmere Bevölkerung Ausmaße einer humanitären Katastrophe hätte annehmen können. Öffentlich organisierte Notfallhilfe mit Lebensmittellieferungen konnte das Schlimmste verhindern. Die allgemeine Not in der Region führte bei den lokalen Politikern zu der Einsicht, dass es vor allem an einem mangele: einer schmucken Fußballarena!
Im Jahr der Dürrekatastrophe ließ Bürgermeister João Pedro die Arbeiten am Bau eines Stadions für 10.000 Zuschauer beginnen. Der Ort Brejinho kam zu jener Zeit, die ländliche Umgebung bereits mitgerechnet, übrigens auf 4.000 Einwohner.
Der Bürgermeister, ganz brasilianischer Fußballvisionär, begründete seine kurios bis wahnsinnig anmutende Maßnahme gleichermaßen mit Nachhaltigkeit wie auch mit dem Willen seiner Einwohner: „Ich habe nicht bloß an die Gegenwart gedacht. Ich machte etwas, das für lange Zeit bleiben wird. Die Menschen hier wollten mehr als alles andere ein Stadion. Ich versprach ihnen, dass ich es für sie bauen werde. Und ich hielt mein Versprechen.“ Das Stadion benannte João Pedro nach seinem verstorbenen Schwiegersohn, Dr. Antônio Alves de Lima.
Das Bemerkenswerte: Diese Geschichte ist nicht bloß ein Beispiel politischen Größenwahns oder reiner Anmaßung, denn die Menschen Brejinhos sind ihrem Bürgermeister dankbar. Sie tauften das Stadion eigenmächtig und liebevoll Tonhão (= der große Antonio) und verzichten zugunsten fußballerischen Glamours gern auf Investitionen in die Infrastruktur, die die strukturelle Armut mildern könnten. Das völlig deplatziert scheinende moderne Stadion inmitten der sandigen Wüstenei verfügt über eine komfortable Bar und sogar eine Rundfunklounge für eventuelle Radioübertragungen. Im Gespräch mit Alex Bellos blickt der Sportsekretär Brejinhos zurück auf die Zeit der Schmach: „Früher schämten wir uns, dass wir kein richtiges Stadion hatten. Wir baten und bettelten.“ Wie jener João Vilarim den Ausgang der Geschichte einordnet, kann man sich denken: „Endlich kam der Bürgermeister zur Vernunft!“
Das Vermächtnis des Stadions verhalf dem zweiten Schwiegersohn des Bürgermeisters zur Nachfolge auf diesem Posten. José Vanderlei begegnet aufklärerisch denkenden Menschen auf deren Einwände, ein Stadionbau in einer verarmten Region sei doch sehr anrüchig, wenn nicht korruptionsverdächtig, auf ganz eigene und an einer womöglich zynischen Realität geschulten Art: „Okay, wir haben 75.000 Dollar ausgegeben. Ein anderer Bürgermeister hätte vielleicht nichts getan, und die 75.000 Dollar wären auch so einfach weg gewesen.“
José Vanderlei gewann seine Wahl übrigens mit dem Versprechen, dass Fassungsvermögen der Tribüne von 3.000 Plätzen (etwa ein Sitzplatz pro Einwohner) auf 10.000 Plätze zu erhöhen. Die drei vorhandenen Kassenhäuschen wurden bisher einmal benutzt, wegen der Armut der Bevölkerung erhebt der Amateurverein normalerweise keine Eintrittspreise.
Welch interessante Bauprojekte die brasilianische Liebe zum Fußball hervorbringen kann, zeigt ebenfalls eindrucksvoll das Stadion in der Stadt Macapá in dem zu 90 Prozent mit Urwald bedeckten Bundesstaat Amapá. Das 1990 eingeweihte Stadion wird „Zerão“ genannt, die „große Null“. Der Grund: Die Mittellinie verläuft genau über dem Äquator. Nach dem Münzwurf vor einem Spiel werden die Kapitäne vom Schiedsrichter gefragt, auf welcher Erdhalbkugel sie beginnen wollen. Eine Mannschaft beginnt auf der südlichen, die andere auf der nördlichen Hemisphäre.
Vor so viel Entschlossenheit zum Fußballwahnsinn erscheinen die nach dem Bau des Stadions zutage getretenen Mängel als Randerscheinungen. Den Bauherren war es bei der Errichtung ihres Prestigeobjekts weniger um solide Planung zu tun als um rasche Fertigstellung. So riss der erstbeste tropische Sturm, beileibe keine Seltenheit in diesen Breitengraden, das Dach des Stadions fort.
Heute ragen die acht Stützpfeiler aus Beton als nackte Säulen in den Himmel. Mit einer grundsätzlichen Sichtbehinderung im Stadion müssen die Besucher ohnehin leben: Die Flutlichtmasten stehen im Innenraum des Stadions direkt um das Spielfeld. Dass es für die ausführende Firma der erste Stadionbau war, erübrigt sich zu erwähnen.
Zwischen Sprecher- und Trainerkabine
Was den Dilettantismus authentisch macht, ist die dahinterstehende Motivation, die in der Sache selbst liegt. Frei von derartigen Hemmschuhen wie einer soliden Grundlage für das eigene Handeln lassen sich auch Selbstzweifel leichter beiseite wischen. Und wo Populismus auf ein empfängliches Publikum trifft, können die merkwürdigsten Wege eingeschlagen werden. Aus dieser Gemengelage lassen sich die Karrieren so mancher Rundfunkreporter Brasiliens erklären.
Das Radio hatte seit den 1950er-Jahren nicht unwesentlich zur Entwicklung des Fußballs zum unbezweifelbaren Nationalsport beigetragen. Für die nicht geringe Zahl an Analphabeten im Brasilien jener Zeit war die Radioübertragung die einzige Möglichkeit, über das Fußballgeschehen im riesigen Land auf dem Laufenden zu bleiben. Der journalistische Umgang mit dem Sport war von Anfang an eher auf leidenschaftliche Dramatisierung gepolt als auf nüchterne Berichterstattung.
Der Fußball in Brasilien sprach eine eigene Sprache. Noch heute klingen südamerikanische Fußballkommentatoren in europäischen Ohren wie Schamanen oder Derwische, wie enttäuschte Liebhaber oder ekstatische Enthusiasten. Das weltberühmte, opernhaft intonierte „Gol“, angemessen ausgeschrieben mit mindestens zehn „o“, wurde 1942 vom Reporter Rebelo Júnior erfunden und trat einen Siegeszug durch die südamerikanische Fußballwelt an. Júniors Kollege Raul Longas heulte bei jedem Tor Ewigkeiten wie eine Sirene ins Mikrofon. Dies hatte den einfachen Grund darin, dass der kurzsichtige Sportbeobachter von seinem Platz aus nie erkennen konnte, welcher Spieler den Treffer erzielt hatte. Aus der Not ein Markenzeichen machend heulte er solange infernalisch herum, bis ihm ein Mitarbeiter den Namen des Torschützen schriftlich anreichte. Den Rundfunkreportern lagen die Massen zu Füßen. Und die Journalisten, die sich als Sprachrohr der Fans verstanden, lebten ihre Leidenschaft frei von jeglicher Zurückhaltung aus.
Der beliebteste Sportreporter der 1940er-und 1950er-Jahre, Ary Barroso, komponierte nebenher äußerst erfolgreich Songs, u. a. für die populäre Sambasängerin Carmen Miranda, war Schriftsteller, Politiker und Fernsehstar. Als Komponist war er Anfang der 1940er-Jahre derart erfolgreich, dass Walt Disney ihm die musikalische Leitung einer Filmproduktion anbot. Mit der Begründung, „Was soll ich in Kalifornien, wo Flamengo nicht ist?“, lehnte er das lukrative Angebot ohne zu zögern ab. Die Liebe zu seinem Verein war das Einzige, das zählte. Diese Leidenschaft erkannte man auch daran, dass der musikalische Barroso Tore Flamengos, statt diese schnöde anzusagen, mit einer triumphalen Fanfare auf der Mundharmonika begleitete. Gegnerische Treffer hatten ein tonloses ausgenudeltes Gekrächze des Instruments zur Folge. Doch bemerkenswerter als seine originelle Performanz war, wie Barroso den Einflusskreis seines Berufszweigs vergrößerte: Nicht nur, dass er eine Übertragung eines Flamengo-Spiels nach einem Treffer für mehrere Minuten unterbrach, um aus seiner Kabine auf den Platz zu stürmen und mit den Spielern zu jubeln; Barroso erstritt eigenmächtig das Privileg des brasilianischen Reporters, jederzeit am Spielfeld Interviews führen zu dürfen.
Читать дальше