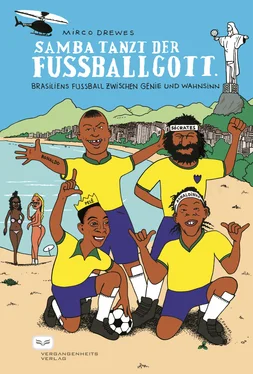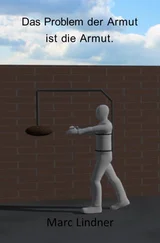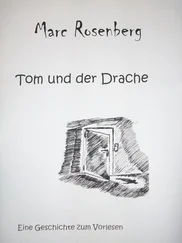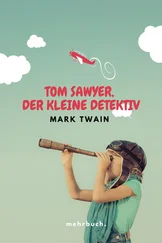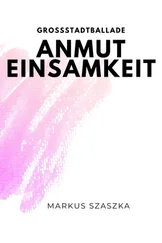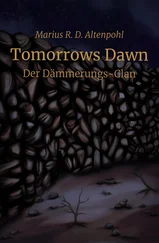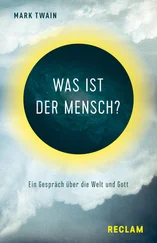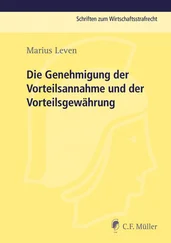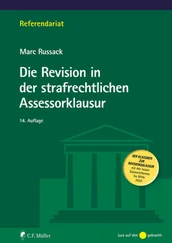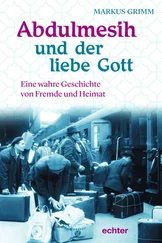An die Traditionen der extrovertierten und unberechenbaren Radioreporter anknüpfend etablierte sich bald die Radialista, eine Mischung aus Show und Sportübertragung, die dem Wunsch nach Spektakel perfekt entsprach und vielen ihrer Macher eine Karriere auch jenseits des Sports einbrachte. Der Populärste der Radialistas war gewiss Washington Rodrigues. Dass er kein Problem mit ungewöhnlichen Herausforderungen hatte, erkannte man daran, dass er vor wichtigen Spielen schon mal den Ball interviewte. Die Quadratur des Kreises gelang ihm schließlich, als er von der Radiotribüne, traditionell ein Ort der fußballerischen Besserwisserei, direkt auf die Trainerbank des Traditionsvereins Flamengo wechselte.
1995 ging es mit Flamengo sportlich bergab. Dessen Präsident, übrigens selbst ein ehemaliger Radialista, kam in seiner Not auf die populistische Idee, dem Flamengo-Fan und Radiokritiker Washington Rodrigues den Trainerposten anzubieten. Dieser sagte ohne zu zögern zu. Im Gespräch mit Alex Bellos bekundete er, zwar kein ausgewiesener Fachmann zu sein, aber mit der nötigen Chuzpe ausgestattet fügte er hinzu, dass jeder Brasilianer wisse, wie Fußball funktioniere.
Nach kurzer Zeit musste er jedoch feststellen, dass seine Kompetenzen wohl nicht ausreichten, um den Zampano zu geben, und so entschied er sich, im Herzen doch Journalist, seine Spieler zu interviewen. Rodrigues befragte seinen Kader nach den Gründen für den sportlichen Niedergang und stellte nach der Auswertung dieser Interviews einige Vorschläge vor, aus denen die Spieler die beste taktische Marschroute auswählen durften. „Fußballtaktik ist wie ein Büffet. Wenn da vierzig Gerichte vor dir stehen, probierst du vielleicht vier oder fünf. Du isst nicht alle vierzig.“
In den deutschen Profiligen schreibt der DFB verbindlich die Fußballlehrer-Lizenz für die Trainer vor. Man mag sich fragen, wozu diese Humorlosigkeit gut ist, wo es doch so einfach sein kann. Nörgelt im Fernsehen ein sogenannter Experte zu viel herum, setze man diesen einfach auf die Trainerbank. Soll er es doch besser machen. Nach diesem Prinzip der ungefragten Wortmeldung bewirbt sich unverdrossen Lothar Matthäus, der in Brasilien bekanntlich anderthalb Monate trainiert hat (wovon er freilich 30 Tage wegen Schiedsrichterbeleidigung gesperrt war), auf die meisten freien Trainerstühle.
Ein weiteres Problem in der Wahrnehmung des Radialistas stellte sich bald heraus: An seine Vogel-Perspektive von der Pressetribüne aus gewohnt, war Rodrigues nicht in der Lage, das Spiel seiner Mannschaft von der Seite aus zu lesen. Kurzerhand bat er den brasilianischen Verband, einen Fernseher neben seine Trainerbank stellen zu dürfen, um auf diesem die Live-Übertragung der Flamengo-Spiele, die drei Meter von ihm entfernt stattfanden, sehen zu können. Der Brasilianische Verband wand sich mit diesem Anliegen an die FIFA, die jedoch zu diesem merkwürdigem Antrag schlechterdings den eigenen Statuten keine rechtsverbindliche Anweisung entnehmen konnte. Achselzuckend bekam Rodrigues seinen Wunsch genehmigt und schaute fortan auf der Trainerbank die Spiele seiner Mannschaft auf einem kleinen Fernseher.
In den vier Monaten seiner Amtszeit stabilisierte sich Flamengo immerhin so sehr, dass Rodrigues 1998 erneut für vier Monate als Aushilfstrainer einspringen durfte. Die professionelle Trainergilde dürfte die Episoden mit dem Radiofritzen, als Coach aus dem hohlen Bauch heraus, skeptisch betrachten. Washington Rodrigues wurde durch diese persönliche Erfahrung eine gewisse Demut vor dem Beruf des Trainers zuteil: „In vierzig Jahren lernte ich nicht so viel wie in jenen acht Monaten. Ich sah die Spieler zum ersten Mal in einem anderen Licht, was sie die Woche über machen, wie sie leben. Ich musste einsehen, dass vieles, was ich früher gesagt oder geschrieben hatte, falsch war. Es tut mir wirklich leid, und heute bin ich mit Kritik an Trainern viel vorsichtiger.“ Immerhin, möchte man sagen, wenn auch der Trainerberuf leichten Schaden genommen haben mag, so wurde zumindest ein wilder Sportreporter gezügelt.
Pilgergänge und das Blau der Jungfrau
Die Kreativität, mit der Brasilianer alle Möglichkeiten ausloten, ihrem Verein zum Erfolg zu verhelfen, zeigt sich auch in den absurden Exzessen, die der Aberglaube hervorbringt. Im religiösen Synkretismus Brasiliens gehen der Katholizismus, die besonders in den letzten Jahren wachsenden evangelikalen Sekten, traditionelle Religionen wie Voodoo oder Candomblé und der „ganz normale“ Aberglauben tolle Bündnisse ein.
Traditionell beten Katholiken bestimmte Heilige an, um Beistand bei konkreten Lebensproblemen zu erhalten. Im Gegenzug geloben die Gläubigen symbolische Bußetaten zu vollbringen. In einem Land, in dem der Fußball im Gefühl der Menschen vielleicht das zentrale Lebensproblem ist, welchem man mit der allergrößten Hingabe begegnet, mag der Pilgergang Didis, der mit Brasilien 1958 und 1962 Weltmeister wurde und bürgerlich Valdir Pereira hieß, nicht überraschen. Im Jahr 1957 gelobte Didi öffentlich, dass er zu Fuß vom Maracanã-Stadion zum Klubhaus Botafogos wandern würde, wenn Gott seinem Team die Meisterschaft schenken würde. Ein kräftiges „Amen“ und den erteilten Segen des Fußballgottes später durfte Didi tatsächlich zu seiner Pilgerschaft antreten. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass ihn 5.000 Fans auf seiner Wanderung begleiteten. Als er am Klubhaus ankam, trug er nichts mehr am Leib als die Unterhose. Unterwegs hatten sich die Fans tatkräftig um Souvenirs bemüht. Vor der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden verzichtete Didi auf öffentliche Schwüre.
Legendär ist der Wallfahrtsort Juazeiro do Norte im nordöstlichen Bundesstaat Ceará. Jedes Jahr pilgern zwei Millionen Menschen in die 250.000-Einwohner-Stadt. Die Legende des Ortes geht zurück auf das Jahr 1899, in welchem sich bei der Kommunion des legendären Priesters Cicero die Hostie im Mund einer Laienschwester in Blut verwandelt haben soll. Solch Wunderwerk lockt natürlich neben christlichen Pilgern auch den abergläubischen Fußballliebhaber an, der es für geraten hält, sich mit dem (Fußball-)Gott gut zu stellen.
Mittlerweile weist die Kultstätte einen Devotionalienraum auf, in welchem sich Tausende Exvotos, kleine Opfergaben, für erbrachte Gunst von oben befinden. Fans, Spieler und Vereinsfunktionäre aller sportlichen Ebenen legen im Fußballtempel Trikots, Schuhe, Fotos, Haarbüschel, Totems und allen erdenklichen symbolischen Krimskrams ab, der dort gesammelt wird. Der riesige begehbare Devotionalienschrein trägt den Namen „Raum der Wunder“. Dem Abergläubischen beweist jede der Gaben selbstverständlich das Gelingen der Anbetung. Neben dem Raum der Wunder werden im „Nippesbasar“ die Kultgegenstände nach einer pietätsvollen Inkubationszeit wieder verhökert. Die ehemals profanen Gegenstände kommen mit geheiligter Aura wieder in den Umlauf.
Von nicht weniger magischer Aura umgeben ist die Pilgerstätte Aparecida do Norte im Bundesstaat São Paulo. Deren Geschichte beginnt im Jahr 1717, als Fischer in einem Netz eine Terrakotta-Statuette der heiligen Jungfrau fanden. Der Erzählung nach füllte sich der kaum Wasser führende Fluss nach der Bergung der Aparecida („unverhofft Erschienene“) getauften Dame mit Fischen. Die heilige Unverhoffte wurde seit dem 19. Jahrhundert mit einem blauen Samtmantel behangen ausgestellt und für so zahlreiche Wunder verantwortlich gemacht, dass der stetig anschwellende Pilgerstrom im Jahr 1955 mit dem Bau der Basílica de Nossa Senhora Aparecida gleich die Errichtung des zweitgrößten katholischen Gotteshauses erforderlich machte.
Die sich bald ergebende Verbindung dieser Heiligen zum Fußball mag dem rational denkenden und säkularisierten Europäer absurd erscheinen, für Brasilianer ist sie es keineswegs. Im WM-Endspiel 1958 hatte Brasilien gegen Gastgeber Schweden anzutreten, welcher wie Brasilien in Gelb antrat. Die abergläubischen Spieler der Seleção waren wegen der Tatsache, dass man plötzlich auf die blauen Ausweichtrikots zurückgreifen musste, schwer beunruhigt. Kurz vor dem Anpfiff stürmte der Leiter der brasilianischen Delegation, Paulo Machado de Carvalho, in die Kabine und erklärte den Spielern, dass das Blau im Gegenteil ein gutes Zeichen von oben sei, denn die Aparecida trage schließlich auch: Blau.
Читать дальше