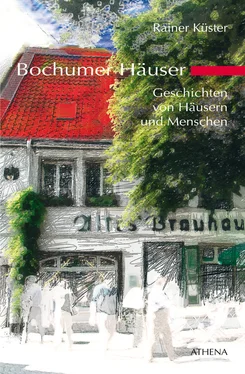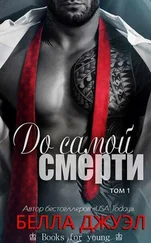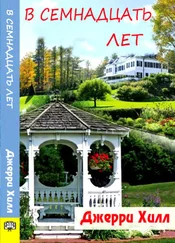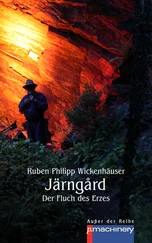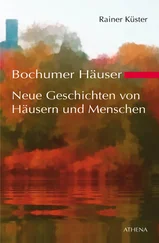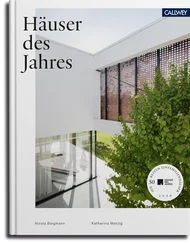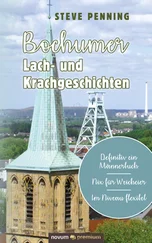Eberhard Brand kommt als Letzter die Treppe herab. Er trägt schwer an seiner Aktentasche. Ein Deutschlehrer nimmt häufig eine volle Aktentasche mit nach Hause. Das ist eben so ein Lehrerschicksal. Aber Eberhard Brand unterrichtet nicht nur an der Goethe-Schule. Er ist auch Vorsitzender der Bochumer »Kortum-Gesellschaft«, und als solcher kennt er sich aus in Bochum wie wenige andere, hat er ein Gespür für Bochumer Häuser.
Wir stehen vor der Villa Nora, Kortumstraße 156, der gediegenen Dependance der Goethe-Schule. Hundert Jahre sind diese Mauern alt. Vor einiger Zeit wurden sie als Denkmal geschützt. Auch heute noch wirkt die Villa bombastisch, pompös mit den beiden Giebelvorlagen und den Erkern an der Straßenfront, mit dem kompliziert gekurvten Dach und der spätgotischen Ornamentik. Wie mag das Gebäude vor hundert Jahren gewirkt haben, als die damals gerade neu angelegte Straße noch Kaiser-Wilhelm-Straße hieß?
Wir betreten die Villa durch den Herrschaftseingang mit seinem repräsentativen Treppenhaus. Daneben gibt es noch den Dienstboten- und Lieferanteneingang, sogar mit einem eigenen Treppenhaus, das allerdings deutlich bescheidener gestaltet ist. Vierzig Räume besitzt diese hochherrschaftliche Villa. In einigen dieser Räume residiert heute die Oberstufe der Goethe-Schule. Das war natürlich nicht immer so. Wer baut schon Villen für Gymnasiasten? Eberhard Brand kennt die wechselvolle Geschichte des Hauses.
Das Adressbuch der Stadt Bochum gibt eine erste Auskunft. Das Haus Kaiser-Wilhelm-Straße 24 wird erstmals im Jahre 1899 genannt. Sein Erbauer und Eigentümer heißt Heinrich Köhler; auch der Beruf ist im Adressbuch angegeben. Er lautet ganz schlicht und lakonisch »Generaldirektor«. Wenn Köhler zusammen mit seiner Ehefrau vom Erker des Herrenzimmers hinunterschaute, dann fiel sein Blick auf die »Partie am Kaiser-Wilhelm-Denkmal«, so wird der Platz auf alten Postkarten bezeichnet. Heute stehen hier die Autos der Goethe-Schüler und die Fahrräder der Lehrer.
Wer war dieser Heinrich Köhler? Wer war seine Frau, nach der noch heute die Villa benannt wird?
Es beginnt mit einer Bilderbuchkarriere, nicht untypisch für die Zeit und die Region. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts war Heinrich Köhler in führender Position für den Bochumer Verein tätig gewesen, hatte unter Jacob Mayer, dem Gründer des Unternehmens, das Bessemerwerk geleitet. Dann war er zur Konkurrenz gewechselt und hatte schließlich im Jahre 1889 in Bochum-Weitmar ein eigenes Unternehmen, die »Westfälischen Stahlwerke« gegründet. Man produzierte Eisenbahnmaterialien, vornehmlich Radsätze, Federn, Weichen. Fünfzehn Jahre lang stand Heinrich Köhler an der Spitze des Unternehmens. Den geschäftlichen Höhepunkt erlebte das Werk um die Jahrhundertwende. Doch dann ging es abwärts, es folgten Rückschläge, Zeiten der Ertraglosigkeit. Im Dezember 1904 nahm Köhler seinen Abschied aus der Firma, wohl aufgrund der schwierigen geschäftlichen Situation. Im »Märkischen Sprecher« wird der Abschied des Generaldirektors Köhler ausführlich dargestellt und gewürdigt:
»Gestern Abend brachten etwa 1200 Angestellte (Beamte und Arbeiter) der Westfälischen Stahlwerke dem in den Ruhestand tretenden Generaldirektor einen Fackelzug dar, der sich um 7 ¼ Uhr von der Fabrikanlage in Bährendorf zur Köhlerschen Villa an der Kaiser-Wilhelm-Straße bewegte. Dort hielt Dreher Wortmann eine Ansprache, ausklingend in ein Hoch auf Herrn Generaldirektor Köhler; der letztere erwiderte mit einem Hoch auf die Westfälischen Stahlwerke. Die Gesangsabteilung trug mehrere Lieder vor. Bei einer Nachfeier in der Tonhalle, an der auch die Familie Köhler teilnahm, brachte Herr Prokurist Brinkmann das Kaiserhoch aus.«
Drei Jahre später, im Jahre 1907, stirbt Heinrich Köhler im Alter von siebzig Jahren, »plötzlich infolge Herzlähmung«, wie es in der Todesanzeige heißt. Beerdigt wird er in der Köhlerschen Gruft auf dem Friedhof an der Blumenstraße in Bochum. Wer jetzt den Friedhof aufsucht, findet die Gruft im ältesten Teil. Dort erhebt sich noch heute über der Grabstätte ein hoher Sandsteinsockel, der die Bronzebüste Heinrich Köhlers trägt.
Hat dieser Heinrich Köhler im gesellschaftlichen Leben Bochums eine Rolle gespielt? Eberhard Brand hat nachgeforscht. Das Ergebnis ist seltsam negativ. Heinrich Köhler ist nicht unter den Mitgliedern der noblen »Gesellschaft Harmonie« zu finden; sein Name taucht auch nicht in den Repräsentanten-Listen der Industrie- und Handelskammer zu Bochum auf, obwohl Köhler von seinem Stand als Hütten- oder Generaldirektor das Prestige gehabt haben müsste, um in den genannten Institutionen engagiert zu sein. Woran mag diese Zurückhaltung gelegen haben? Eberhard Brand gibt zu bedenken:
»Der Grund für eine diesbezügliche Abstinenz Heinrich Köhlers dürfte wohl in der Tatsache zu suchen sein, dass er sich als permanenter Konkurrent des mächtigen und einflussreichen Bochumer Vereins behaupten musste, dessen leitende Herren nicht nur die ökonomische Situation in Bochum beherrschten; sie gaben in Bochum auch in gesellschaftlicher Hinsicht weithin den Ton an. Köhler, der abtrünnige ehemalige Mitarbeiter, Köhler, der unbequeme Emporkömmling, Köhler, der mit einer schwierigen, exzentrischen Frau Verheiratete, passte offensichtlich nicht so ganz in die spezifische Bochumer Gemengelage. Und daran änderte auch seine hochherrschaftliche Villa in der Kaiser-Wilhelm-Straße nichts.«
Die »schwierige, exzentrische« Frau, von der Brand spricht, ist Amélie Köhler, geborene Würzburger, die im Januar 1907 »im namenlosen Schmerz« hinterbliebene Ehefrau Heinrich Köhlers. Seit wann sich diese Frau selbst Nora nennt, seit wann sie Nora genannt werden will, ist nicht genau bekannt.
Nora, das ist um die Jahrhundertwende ein Name von literarischem Gewicht. Im Jahre 1879 publiziert der norwegische Dichter Henrik Ibsen sein Drama »Nora oder Ein Puppenheim«. In diesem Stück geht es auch, aber keineswegs nur um Emanzipation. Der eigentliche Konflikt sitzt tiefer. Das Thema des Dramas ist die unheilbare Vertrauenskrise zwischen zwei Eheleuten. Nora, die Ehefrau des Rechtsanwalts Helmer, möchte ein erfülltes, verantwortliches Leben an der Seite ihres Mannes und als Mutter ihrer Kinder führen. Aber Helmer behandelt sie wie eine Unmündige, er degradiert sie zu einer Marionette, ihr Heim ist ein Puppenheim.
Was mag vorgefallen sein in diesem Hause, in der Villa Köhler, dass sich Frau Amélie Köhler diesen Namen gab, dass sie sich mit dieser dramatischen Figur identifizierte? Die Nora des Theaterstücks nimmt am Ende ihre Reisetasche und verlässt Ehemann und Kinder, weil sie nicht mehr daran glaubt, dass sich irgend etwas ändert, nicht mehr daran glaubt, dass »etwas Wunderbares« geschieht. Ibsens Nora entbindet ihren Mann ihr gegenüber jeglicher Verpflichtung. »Auf beiden Seiten muss volle Freiheit herrschen.« Das Stück endet mit dem Dröhnen einer Tür, die zugeschlagen wird.
Im Hause Köhler blieben die Türen offen; Amélie Köhler hat ihren Mann nicht verlassen, blieb bei ihm bis zum Ende; der Schmerz ist schließlich namenlos, er wird nicht formuliert, bleibt unausgesprochen.
Ist das Spiel mit dem Namen nur eine Marotte, eine literarische Koketterie? Oder noch ganz anders: Verbirgt sich etwa hinter der Änderung des Namens ein raffiniertes Versteckspiel? Ist es gar nicht Amélie Köhler, die sich mit Ibsens Nora identifiziert? Will sie nur ihren Gatten treffen, den sie auf diese Weise zu Ibsens Helmer macht? Zu diesem Ehemann, dessen Eitelkeit und Feigheit, dessen Selbstgerechtigkeit ihr unerträglich sind? Diesem Spießer, der seinen gesellschaftlichen Aufstieg genau genommen seiner Frau zu danken hat, der aber zu borniert ist, dies zu erkennen? Ist mit der Umbenennung im Grunde Heinrich Köhler gemeint? Immerhin würde dies erklären, wieso noch eine zweite Nora Platz im Hause Köhler hatte, nämlich die eigene Tochter, die nun wirklich diesen Taufnamen erhielt.
Читать дальше