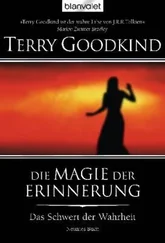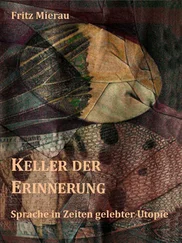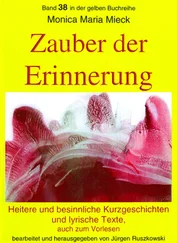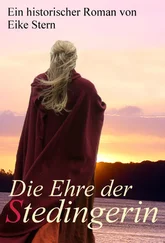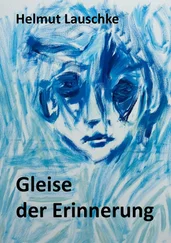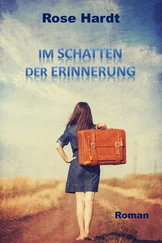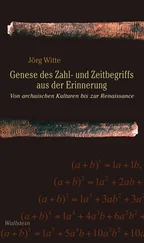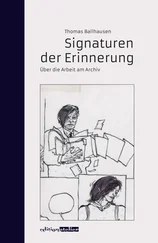Einen ersten Erfolg konnte die kollektive Überfremdungsangst 1918 mit dem vorübergehenden Grenzschluß verbuchen, der für die östlichen Grenzen des Deutschen Reichs mit dem ausdrücklichen Hinweis auf eine von den Flüchtlingen drohende Verseuchungsgefahr angeordnet wurde. 1920 machte sich der sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin, Ernst, genau die Sorgen, von denen seine Nachfolger heute wieder gequält werden: »Die Ostjudenplage wird, da es sich hier nicht nur um lästige, sondern höchst gefährliche Ausländer handelt, in ihrer jetzigen Duldung und wohlwollenden Behandlung künftighin politisch, wirtschaftlich und gesundheitlich die furchtbarsten Gefahren zeitigen.« Deshalb legte er als Behördenchef nicht nur eine besondere Einsatzfreude bei den legalen Pogromen, den Razzien, an den Tag, sondern empfahl auch, was rund sechzig Jahre später unter die »Reihe von anderen Maßnahmen« fiel: das Sammellager, die Abschiebehaft. Beide sind Einrichtungen einer modernen Entdeckung: der Heimat. Wem nicht zwangsweise wieder zu einer solchen verholfen werden konnte, indem man ihn meist in den sicheren Tod repatriierte, dem blieb als einzige Heimat das Lager.
Unter welchem bis ins Detail reichenden Wiederholungszwang die Gegenwart steht, beleuchtet der folgende Zeitungsbericht über eines der 1921 außerhalb Berlins errichteten Internierungslager: »Vor einigen Tagen ist im Lager Stargard eine mit 80 Mann belegte Baracke abgebrannt. Da absolut keine Löschmittel zur Verfügung standen, die Wachmannschaften offenbar, entgegen ihrer Pflicht, nicht rechtzeitig einsprangen, brannte die ganze Baracke nieder. Da die Baracke verschlossen war, sprangen die Internierten zum Fenster heraus. Sie wurden daraufhin von den Wachmannschaften beschimpft und zum Teil mit Kolbenschlägen mißhandelt. Am folgenden Tage beim Appell wurde den Internierten angedroht, daß sie, falls nochmals eine Baracke in Brand geraten würde, nicht mehr herausspringen dürften, sie sollten ruhig verbrennen.«
Im November 1923 wurde die Frage des sozialdemokratischen Abgeordneten Davidsohn »Wann findet – wenn das so weiter geht – zu Berlin oder sonstwo in Deutschland der erste fidele Judenpogrom statt?« beantwortet: der Mob zog prügelnd und plündernd durch das Berliner Scheunenviertel. »Der Nazismus stieß seinen ersten Schrei aus«, schrieb Döblin. Hier wurde geprobt, was später, als alle mitmachen durften, Programm wurde. Die Sozialdemokraten taten nichts, was den Ehrentitel »Judenschutztruppe«, den ihr die Nazis verliehen, hätte rechtfertigen können, und die Kommunisten waren gerade dabei, die Faschisten als Hilfstruppen der Revolution zu gewinnen. Nie war der Antisemitismus und der Ausländerhaß später wütender als in den Jahren zwischen 1919 und 1923, in denen die Ostjuden als Objekt der Einübung auf Kommendes dienten. Die Rücksichten, die noch deutschen Juden galten, fielen weg. Nach 1933 wurde der Mob an die Kandare genommen und der Antisemitismus in staatliche Regie. Die wilden Pogrome von 1923 waren also das Vorspiel zu dem ein Jahrzehnt später bürokratisch exekutierten »Antisemitismus der Vernunft« (Hitler), der schließlich die industrielle Massenvernichtung vorbereitete.
Die ostjüdischen Flüchtlinge nach 1918 waren die Verkörperung einer unerlaubten Schande: sie hatten nicht einmal den Krieg verloren. Sie waren einfach da. Sie waren zwischen den Fronten gewesen, das beleidigte die Soldaten; sie kamen aus den Zwischenräumen der Gesellschaft, das provozierte die Deklassierten, und sie waren die Parias der Geschichte, das verziehen ihnen die besiegten Deutschen, die sich als Proletarier unter den Völkern fühlten, nicht. Von der Propaganda des nationalen Befreiungskampfes gegen die Siegermächte, dessen Parolen oft bis aufs Wort identisch sind mit den patriotischen Bekenntnissen der Friedensbewegung, führte ein direkter Weg zum Pogrom: weil die »auswärtigen Fronvögte« – wie es damals hieß – nicht greifbar waren, hielten sich die »Unterlinge« – wie es heute (bei Hochhut) heißt – an die Ostjuden, von denen das »besetzte Land« ersatzweise befreit werden sollte; und 1938 konnte man über das Berliner Scheunenviertel, das mittlerweile »befreites Gebiet« war, in der bebilderten Rückschau einer Nazibroschüre lesen: »In dem von Ostjuden besetzten Gebiet Berlins mußte sich der Deutsche wie im Feindesland fühlen. Er wurde beobachtet, umlungert, verfolgt.«
Dem Haß auf die Ostjuden korrespondierte aber auch ein bis zur Hochstimmung gesteigertes Interesse an ostjüdischer Kultur. Von der Euphorie, mit welcher ostjüdische Tradition von einem – sehr kleinen und meist aus Intellektuellen bestehenden – Teil der deutschen Juden rezipiert und spöttisch nach einem ihrer Hauptergriffenen Bubertät genannt wurde, soll hier nicht die Rede sein, sondern von der Faszination, die sie auf die nichtjüdischen Deutschen ausübte. Auf die Ostjuden wurde dabei projiziert, was die Deutschen sich anschickten herzustellen: die Volksgemeinschaft. Aus der Vorstellung des wandernden Juden wurden die Veranstaltungen des marschierenden Deutschen, aus dem Bild der völkischen Reinheit und der Vermehrungsfreudigkeit, an dem beispielsweise auch Bebel Gefallen gefunden hatte, wurden die Nürnberger Gesetze und die Nazistiftung für Mutter und Kind, der Lebensborn.
In einer Eloge auf den Maler Hermann Struck, den er während des Ersten Weltkriegs in Wilna kennengelernt hatte, schrieb ein begeisterter Deutscher: »Ich erlebte an ihm und an der Umwelt die Kraftquelle des Judentums, die es über die Diaspora der Jahrtausende erhalten hat: die Einheit von Volkstum und Religion, Nationalität und Glauben und erlebte zugleich die dichte, völlig unzersetzte Atmosphäre, die hier noch um Gottesdienst und religiöses Handeln, um Kult und liturgische Bräuche waren. Die Stärke des Ostens gegenüber dem vielfach zerfallenen Westen wurde hier im jüdischen Bereich fühlbar.«
Ganz ähnliche Motive liegen der modischen nostalgischen Beschäftigung mit der Geschichte der Ostjuden heute zugrunde. Dieses Interesse ergänzt das jahrelang offiziell gehegte Stereotyp von den deutschen Juden als allesamt nobelpreisverdächtig durch ein analoges Klischee: aus Einstein wird Tewje, der Milchmann. Man trifft in jeder nächstbesten Wohngemeinschaft auf die verklärenden melancholischen Photographien von Vishniac als Poster und muß sich die neueste Platte mit jiddischen Liedern anhören mit dem Hinweis, sie sei von einer deutschen Gruppe, die aus der »Liedermacherbewegung« komme, produziert. Dieser Zusammenhang ist nicht zufällig: die mörderische Vergangenheit wird als Kulturgeschichte begriffen. Daß Menschen dabei umgebracht worden sind, spielt allenfalls am Rande eine Rolle, wie das Wort vom »Ethnozid« oder vom »kulturellen Holocaust« verrät. Da die ostjüdische Kultur hierdurch außerdem grenzüberschreitend mit der deutschen wiedervereinigt und regermanisiert wird als Teil einer untergegangenen Kulturvielfalt – im Unterschied zur beklagten Kolonialisierung durch die Coca-Cola-Kultur –, sind die Opfer eigentlich die Deutschen, denen man etwas getan hat, als die Juden umgebracht wurden. So werden aus sinnlos Ermordeten sinnstiftende Tote, die das Lebensgefühl der deutschen Selbstfindung stärken.
III.
Vierzig Jahre nach Kriegsende befinden sich die Deutschen nach den Worten ihres Bundespräsidenten an der Schwelle zum gelobten Land: »Vierzig Jahre sollte Israel in der Wüste bleiben, bevor der neue Abschnitt mit dem Einzug ins verheißene Land begann. Vierzig Jahre waren notwendig für einen vollständigen Wechsel der damals verantwortlichen Vätergeneration.« Diese ausgeborgte Verheißung hatten die Deutschen nach der internationalen Blamage ihrer Versöhnungsfeiern 1985 bitter nötig, denn Bitburg und Belsen stehen nicht für ein vierzigjähriges Pariadasein der Bundesrepublik, das nun zu Ende ging, sondern dort wurde der Bankrott der deutschen Nachkriegspolitik offenkundig. Vierzig Jahre nach der militärischen Kapitulation des deutschen Reichs legte die Republik ihren moralischen Offenbarungseid ab; wozu es damals der alliierten Armeen und besserer Waffen bedurft hatte, das wurde 1985 von einer der gleichgeschalteten Meinung in der Bundesrepublik unbekannten Wunderwaffe erzwungen: der Waffe der Kritik und einer funktionierenden Öffentlichkeit im demokratischen Ausland, welche die Selbstdarstellung des »neuen Deutschland« als Propagandalüge entlarvten.
Читать дальше