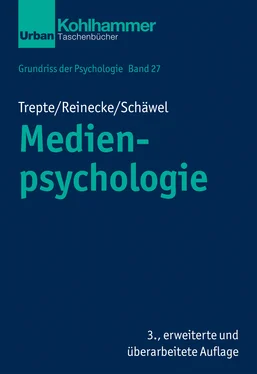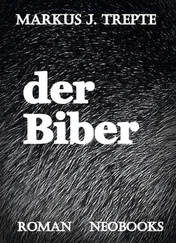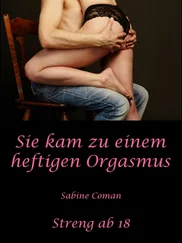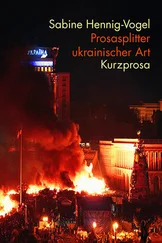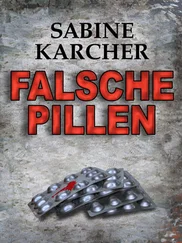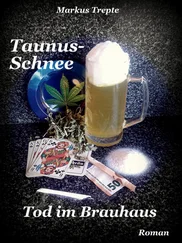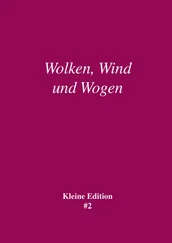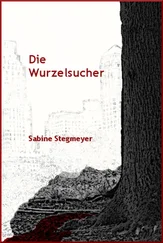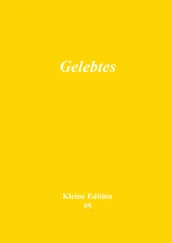Wie fühlen sich Menschen, die sich gegen die Nutzung sozialer Netzwerkseiten im Clearnet entschieden haben und stattdessen unter einem Pseudonym ein soziales Netzwerk im Darknet nutzen? Wenn ein Forschungsfeld wenig bekannt ist und exploriert werden soll, wenn situative Strukturen sowie Prozesse des Erlebens und Verhaltens besonders tiefgehend analysiert werden sollen, so eignen sich qualitative Verfahren.
Qualitative Methoden sehen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Einzelfall vor. Die qualitative Forschung ist induktiv, schließt also von Beobachtungen des Einzelfalls auf allgemeinere Zustände, Prozesse oder Typen. Die Rekonstruktion und das Verstehen des Einzelnen bzw. eines bestimmten Phänomens stehen im Vordergrund. Basierend darauf werden Aussagen über Zusammenhänge, Ursache-Wirkungsbeziehungen oder Verhaltensmuster getroffen.
Die qualitative Forschung hat zum Ziel, die Realität in ihrer vollen Komplexität zu beobachten, zu beschreiben und zu verstehen. Es geht darum, die Bedeutungszuschreibungen und Sinngebungen handelnder Subjekte nachzuvollziehen. Im Vordergrund steht die sogenannte Rekonstruktion, also die genaue Aufarbeitung der beobachteten Prozesse mit dem Ziel einer realitätsgetreuen Abbildung (Gläser & Laudel, 2020).
Während quantitative Verfahren (z. B. standardisierte Befragungen oder psychophysiologische Methoden) Merkmale mithilfe von vorher festgelegten Indikatoren erfassen und sie dadurch quantifizierbar machen, werden mit qualitativen Verfahren diese Indikatoren im Material rekonstruiert und beschrieben.
Eine systematische Grundlage und Leitlinie der qualitativen Forschung ist die Grounded Theory-Methode (Glaser & Strauss, 1967). Sie fasst Ziele, Vorgehensweisen und methodologische Ausgangsüberlegungen der qualitativen Forschung zusammen. Sie beinhaltet, dass theoretische Vorannahmen und in der qualitativen Studie gefundene Erkenntnisse gleichermaßen relevant sind und verknüpft werden und dass qualitative Forschung als ein iterativer Prozess zu verstehen ist. In vielen aktuellen methodologischen Überlegungen sind Ideen der Grounded Theory wiederzufinden. Das Ziel der Grounded Theory-Methode ist, systematisch Theorien zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es weitere theoretische Zugänge der Rekonstruktion und Theoriebildung (vgl. im Überblick Mikos & Wegener, 2017).
Zu den qualitativen Verfahren zählen beispielsweise das qualitative (Leitfaden-)Interview, das narrative Interview, die Gruppendiskussion (als eine spezifische Form der Befragung), die teilnehmende Beobachtung, biografische Methoden, Medientagebücher, Kinderzeichnungen und die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2016; Mikos & Wegener, 2017). In der Medienpsychologie sind hauptsächlich qualitative Interviews vertreten und diesen möchten wir uns deshalb im Folgenden widmen.
Das qualitative Interview wird auch als Leitfaden-, Expert:innen- oder problemzentriertes Interview bezeichnet und ist eine Form der mündlichen Befragung, bei der Einzelpersonen zielgerichtet hinsichtlich einer bestimmten Forschungsfrage bzw. Problemstellung befragt werden (Gläser & Laudel, 2020). Die Befragung kann dabei z. B. in Form eines halb-strukturierten Interviews durchgeführt werden, wobei der Interviewer oder die Interviewerin einem Gesprächsleitfaden folgt, in dem zentrale Fragestellungen festgehalten sind. Das Gespräch ist dabei aber nicht auf einen festen Ablauf festgelegt und kann vom Leitfaden abweichen. Auch nicht-strukturierte Formen der Befragung sind möglich (z. B. das narrative Interview), bei dem die Befragten aufgefordert werden, zu einem bestimmten Thema frei zu erzählen, und größtmöglichen Spielraum bei der Ausgestaltung der Erzählung haben. Maßgebend ist hier nicht die Strukturierung des Interviews durch die Forschungsfrage, sondern die Strukturierung erfolgt durch die interviewten Personen selbst. Sie orientieren sich am Ablauf ihrer eigenen Geschichte. Frageformen des problemzentrierten und des narrativen Interviews können kombiniert werden.
Eine spezielle Variante der qualitativen Befragung, die auch in der Medienpsychologie Anwendung findet, ist die sogenannte Think-aloud-Technik. Die Think-aloud-Technik wird beispielsweise zur Analyse von Problemlöseprozessen eingesetzt.
Bei der Think-aloud- Technik werden Befragte aufgefordert, ihre Gedanken laufend zu verbalisieren, um kognitive Prozesse, z. B. während der Rezeption einer Fernsehsendung oder während der Internetnutzung, nachvollziehbar zu machen (Bilandzic, 2017).
Die systematische und regelgeleitete Planung, Durchführung und Auswertung der qualitativen Interviews sind essenziell. Darüber hinaus gibt es verschiedene methodologische Ansätze zur Durchführung qualitativer Forschung.
Bei der Planung einer qualitativen Interviewstudie müssen persönliche, theoretische und empirische Vorannahmen expliziert werden. Das qualitative Forschungsparadigma geht davon aus, dass Erfahrungen der Befragten durch die Forscher:innen rekonstruiert werden. Voraussetzung hierzu ist, dass die persönlichen Erfahrungen, theoriegeleiteten Vorannahmen und empirischen Eindrücke der Forscher:innen ebenfalls vorab explizit gemacht werden, um sie klar von den Erfahrungen der Befragten abgrenzen bzw. zu diesen in Beziehung setzen zu können. Neben der Sensibilität für diese vorhergehenden Erfahrungen muss die Interviewstudie so geplant und die Fragen so formuliert sein, dass sie maximal offen für überraschende und neue Perspektiven auf die Forschungsfrage sind. Diese Offenheit ist der Kern qualitativer Forschung und ermöglicht ein tiefergehendes Verstehen.
Die Durchführung der qualitativen Interviewstudie erfordert ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen. Die Forschenden entscheiden, wie die Kontaktaufnahme organisiert ist, ob sie persönlich oder telefonisch befragen, welche Interviewsituation sie wählen (z. B. Forschungslabor, Konferenzraum, öffentlicher Ort, private Räume der Interviewten) und wie das Interview aufgezeichnet wird (z. B. Tonaufnahme vs. ex-post-Transkript). Situative Aspekte wie die soziale Interviewsituation beeinflussen die Offenheit, das Vertrauen, die Tiefe der Antworten und nehmen damit indirekt Einfluss auf die Forschungsergebnisse.
Es gibt viele verschiedene Verfahren der Auswertung qualitativer Verfahren, die mit unterschiedlichen theoretischen Grundannahmen einhergehen: qualitative Inhaltsanalyse, Konversationsanalyse, dokumentarische Methode oder interpretative Ethnografie (vgl. im Überblick Mikos & Wegener, 2017). Die gängigste Vorgehensweise in der Medienpsychologie ist die qualitative Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, 2020; Mayring, 2016). Ziele der qualitativen Inhaltsanalyse sind die Zusammenfassung des Materials, die Strukturierung und schließlich Erklärung. Wichtig ist auch immer die Analyse der Antworten, die nicht gegeben wurden, also herauszufinden, welche Erwartungen der Forschenden nicht erfüllt wurden. Die inhaltsanalytische Auswertung erfolgt in der Regel computergestützt mittels Software wie beispielsweise ATLAS.ti oder MAXQDA. Die Regeln und der Prozess der Auswertung werden für die Studie eigens entwickelt (vgl. Beispiele für verschiedene Vorgehensweisen in Mayring, 2016). Verbindendes Element der vielen verschiedenen qualitativen Auswertungsmethoden ist, dass Wörter, Sätze oder Äußerungen im Textmaterial identifiziert und markiert werden, die zueinander und zur übergeordneten Dimension passen oder neue Aspekte ansprechen. Die Dimensionen werden entweder im Verlauf der Textanalyse identifiziert (induktive Kategorienbildung) oder zuvor anhand der Theorie festgelegt (deduktive Kategorienbildung). Diese miteinander in Beziehung stehenden Äußerungen werden dann geordnet, um vorab festgelegte Dimensionen besser zu verstehen und neue theoretische Dimensionen und Ansatzpunkte zu formulieren. Diese Dimensionen werden in einen theoretischen Bezug gesetzt, um Ursache-Wirkungsbeziehungen, Typen, Rezeptionsmodalitäten oder Zusammenhänge zu erkennen. Aus diesen Beziehungen wird das Material insgesamt interpretiert und anschließend theoretisch begründet bzw. die Theorie neu formuliert. Dieses systematische Vorgehen ist ein iterativer, selbstlernender Prozess: Wenn die Interviewtranskripte einmal durchgearbeitet und die Dimensionen theoretisch formuliert wurden, dann geht man das Material erneut durch, um die Zuordnung der Äußerungen zu prüfen und die Definition der Dimensionen zu überdenken und ggf. anzupassen.
Читать дальше