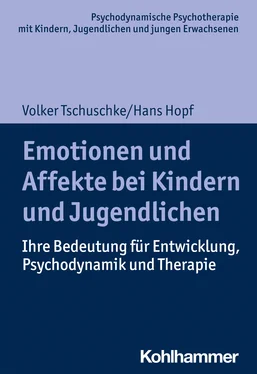Sehr frühe Annahmen zum Zusammenhang zwischen »Seelenbewegungen« und Körper lassen sich bereits auf Aristoteles zurückführen, der eine untrennbare Einheit zwischen beiden sah (Aristoteles, 2011). Ebenso sah Darwin (2013) emotionale Ausdrucksformen als ungelernt und anlagebedingt an, als Mitgift der Evolution im »struggle for survival«.
Auch Freuds Auffassungen von den Gefühlen und vom Affekt basieren auf körperlichen Vorgängen. Freud präzisierte seine Theorien erstmals 1892 in »Ein Fall von hypnotischer Heilung« und sah im sogenannten »Erwartungsaffekt«, der an bestimmte Vorstellungen geknüpft ist, einen verunglückten Kompromiss aufgrund eines ungelösten Konfliktes (GW I, 1892). Seine frühen Auffassungen vom Affekt basieren auf dem Konzept seiner Triebtheorie. Im Kern der Theorie werden Affekte konflikttheoretisch hergeleitet, insofern sie einem Lust-Unlust-Spannungsverhältnis entspringen. Diesem frühen Modell zufolge entstehen Affekte in Situationen, in denen die Triebenergie, mit der Vorstellungsinhalte besetzt sind, nicht in motorische Interaktionen übergeführt oder nicht erfolgreich unterdrückt werden können.
Auch Watson – der Begründer des Neobehaviorismus – ging davon aus, dass Emotionen ungelernte Reaktionsmuster, mithin erbbiologisch angelegte Phänomene seien (Plutchik, 1980). Wie eine unkonditionierte Reaktion seien sie genetisch angelegt und erfolgten mit ziemlicher Konstanz und Regelmäßigkeit auf bestimmte Reize hin. Auch dem US-amerikanischen Psychoanalytiker Rapaport zufolge existieren bereits bei der Geburt angeborene Abfuhrkanäle für Affekte, die ab bestimmten Schwellenwerten für die Abfuhr genutzt würden (Rapaport, 1942; 1953; Plutchik, 1980; Zepf, 2000).
Weitere namhafte Emotionsforscher wie Sylvan S. Tomkins gingen von speziesspezifischen Anlagen, »programmierten« Emotionen, aus. Sein bekanntester Schüler, Carroll B. Izard, legte seinem Emotionsbegriff ebenfalls eine genetische Sichtweise zugrunde. Emotionen waren für ihn primär mimische Gesichtsausdrücke, die eine neurologische Basis haben. Wie sein Lehrer Tomkins ging auch er zunächst von subkortikalen Zentren mit genetisch festgelegten »Programmen« für einzelne Emotionen aus. Individuen lernten nicht, ängstlich oder depressiv zu sein, sie lernten lediglich die Schlüsselreize, die die Gefühle von Angst oder Depression hervorriefen (Izard, 1977). Wie Tomkins auch ging Izard von einer kleinen Anzahl von anlagebingten »Basisemotionen« aus.
Magda B. Arnold war in ihrer Zeit die erste Theoretikerin, die sich von den James-Lange- und Cannon-Bard-Gefühlstheorien (s. weiter unten) distanzierte und eine kognitive Richtung einschlug. Auch sie nahm zwar angeborene Reaktionsmuster an, die aber durch Lernprozesse modifiziert werden könnten (Arnold, 1960). Sie kritisierte die Emotionstheorien ihrer Zeit, indem sie die Wichtigkeit längerer Beobachtungszeiträume von kleinen Kindern einforderte. Laborforschungen taugten nichts, Kinder reagierten über längere Zeiträume mit unterscheidbaren emotionalen Mustern auf vergleichbare Auslöser, was die Bedeutung der individuellen Modifizierbarkeit von Emotionen hervorhebe.
Der Emotionstheoretiker Robert Plutchik zählt zu den bedeutendsten Emotionsforschern der jüngeren Zeit. Grundsätzlich geht er von einem evolutionären Standpunkt der Emotionsentstehung aus. Emotionen sind diesem Darwin’schen Denkmodell folgend in der Phylogenese durch Selektionsprozesse entstanden und haben somit eine genetische Grundlage (Plutchik, 1955; 1957; 1958; 1980).
Plutchik postuliert acht verschiedene wesentliche Basisemotionen: Furcht, Ärger, Traurigkeit, Ekel, Überraschung, Freude, Vertrauen und Erwartung. Wie Arnold kritisiert er die artifizielle Laborforschung, die keine Validität für sich in Anspruch nehmen könne. In Laboren würden Individuen meist mit Elektroschocks gestresst oder lauten Geräuschen, um nachfolgend durch introspektive Befragungen zu erfahren, was diese Individuen gespürt hatten. Dass solche Erinnerungen – bereits künstlich und wirklichkeitsfremd verformt durch experimentelle Anordnungen – darüber hinaus dann kognitiven und Abwehrprozessen unterliegen und somit keine Gültigkeit mehr beanspruchen können, kam Forschern damals nicht in den Sinn (und auch heute nur selten).
Otto F. Kernberg, einer der bedeutendsten psychoanalytischen Theoretiker der Gegenwart, stuft Affekte als genetisch festgelegte Dispositionen für bestimmte Verhaltensweisen ein (1998). Im Kontext internalisierter Objektbeziehungen entwickeln sich nach Kernberg die dispositionell vorgegebenen Affekte im Zuge der Reifung der Persönlichkeit. Affektdispositionen seien primäre Motivationssysteme, nicht Triebe wie bei Freud.
Rainer Krause ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Emotionstheoretiker, der mit seiner Arbeitsgruppe ebenfalls sehr umfangreiche Emotionsforschungen betrieben und affektiv-mimische Gesichtsausdrücke empirisch auf ihre kommunikativen Funktionen hin untersucht hat (2012). Auch er geht von angeborenen, kulturinvarianten primären Affekten aus. »Affekte« beziehen sich ihm zufolge auf körperliche Reaktionen und deren Empfindungen, ohne bewusste Repräsentanz und Erleben, während sich »Gefühl« auf ein bewusstes Wahrnehmen und Erleben situativ hervorgerufener Gegebenheiten zurückführen lasse.
4.2 Triebe und Körperreize – Ursprünge der Emotionen?
Wie bereits dargelegt, basiert Freuds Modell auf der Annahme, dass Triebspannungen bei der Entstehung von Affekten entscheidend seien. Er war zu seiner Zeit nicht alleine mit seiner körperbezogenen Auffassung von Emotionen und Affekten, wie die Psyche zu Beginn des letzten Jahrhunderts generell von Psychiatern und Ärzten als grundsätzlich körperverankert angesehen wurde – wenn auch dualistisch – (z. B. Kretschmers Konstitutionspsychologie, 1977), was in weit zurückreichenden Auffassungen vom menschlichen Charakter wurzelte (Hippokrates, 460 bis 377 v. Chr.; Galenus von Pergamon 129 n. Chr.).
Einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Verständnis von Gefühlen stellten die Annahmen von William James und Carl Lange dar. Ihrer Theorie zufolge basieren Gefühle grundsätzlich auf Körpereizen. Der US-amerikanische Psychologe William James von der Harvard University entwickelte die Theorie in seinem Werk »Principles of Psychology« (1890). Körperliche Reaktionen erfolgen demnach direkt auf äußere, aufregende Ereignisse hin, und das Gefühl dieser körperlichen Veränderungen sei die Emotion. Wie genau die Körperwahrnehmung das Gefühl dann produziert, wird in seiner Theorie nicht näher erläutert. Zeitgleich mit James propagierte der dänische Neurophysiologe Carl Lange (1887/2013) einen theoretisch sehr ähnlichen Standpunkt. Die durch die Theorie aufgeworfene und ungeklärte Frage der James-Lange-Theorie – ähnlich dem Henne-Ei-Problem – lautet: Was kommt zuerst?
Auch Walter B. Cannon studierte und lehrte an der Harvard University, allerdings später als James. Cannon und sein Doktorand Bard verwarfen basale Annahmen der James-Lange-Theorie, indem sie der Auffassung waren, dass der Ausfall von Feedback über viszerale Reize offensichtlich keine Auswirkungen auf einen emotionalen Ausdruck hatte. Somit hatte der Körper ihrer Theorie zufolge keine entscheidende Beteiligung am emotionalen Erleben.
Clark L. Hull (1952) ging – wie Freud – von einer Triebtheorie aus, derzufolge alle menschlichen Handlungen »energetisiert« seien durch Triebe. Seine Motivationstheorie basierte auf mathematischen und quantitativen Elementen, die gleichwohl in sich nicht fehlerfrei blieb und weiter keine große Beachtung fand. Allerdings bahnte Hull der Entwicklung einer mathematischen Lerntheorie den Weg und somit auch der später daraus hervorgegangenen Verhaltenstherapie. Eine ebenfalls sehr abstrakt-radikale Position nahm Burrhus F. Skinner ein. Alles, was gefühlt werde, basiere nicht auf einer irgendwie gearteten nichtphysikalischen Welt eines Bewusstseins, Geistes oder sonstigen mentalen Lebens. Was wir Menschen fühlten, gehe nicht auf Introspektion zurück. Stattdessen könnten wir uns nur verstehen, indem wir unsere genetische und umgebungsabhängige Geschichte betrachteten. Mentalistische Sichtweisen hätten die Psychologie beschädigt. Falls das, was ein Individuum tue, auf irgendwelche inneren Prozesse zurückgeführt werde, sei jegliche weitere Untersuchung sinnlos. Diese extrem radikale Position führte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Aufschwung der Lerntheorie als eines Gegenentwurfs zur – aus Sicht von Skinner – spekulativen Sichtweise psychodynamischer oder humanistischer Theorien vom Menschen und zum Aufschwung der frühen Verhaltenstherapie.
Читать дальше