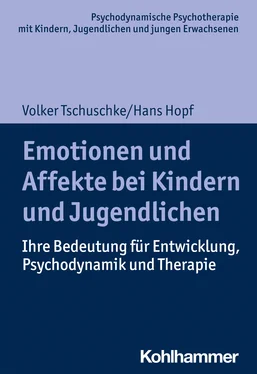Bei aller Vernunft, die von letztlich fast allen Philosophen als Ziel propagiert wird, konzedieren sie gleichwohl mehrheitlich, dass ein vernünftiges, rationales Denken alleine dem Menschen nicht zu seinem Glück verhelfen könne. So ist für Schopenhauer nicht die bloße Reflexion wichtig, nicht alleine das »prüfende und vergleichende Nachdenken«, sondern »… gränzenloses Mitleid mit allen lebenden Wesen ist der festeste und sicherste Bürge für das sittliche Wohlverhalten …« (Schopenhauer, 2019; S. 207). »Mitleid« ist der zentrale Begriff des Schopenhauer’schen Ethik-Entwurfs, ein Mitleid – mit dem psychologischen Wissen von heute würde man dies als Mitfühlen, als Empathie bezeichnen –, das voraussetzungslos, ohne jegliche egoistischen Hintergedanken oder Motive, aus reiner Selbstlosigkeit handele. Mitleid sei Menschlichkeit im besten Sinne.
»… es ist das alltägliche Phänomen des Mitleids, d. h. der ganz unmittelbaren, von allen anderweitigen Rücksichten unabhängigen Theilnahme zunächst am Leiden eines Andern und dadurch an der Verhinderung oder Aufhebung dieses Leidens, als worin zuletzt die Befriedigung und alles Wohlseyn und Glück besteht. Dieses Mitleid ganz allein ist die wirkliche Basis aller freien Gerechtigkeit und aller ächten Menschenliebe« (Schopenhauer, 2019, S. 186).
Die Grundtriebfedern menschlichen Handelns sieht Schopenhauer im Egoismus, in der Bosheit und eben im Mitleid. Dass es sich hierbei nicht um Kognitionen, sondern um basale Gefühle handelt, erklärt sich von selbst.
Kierkegaard sieht den Mut zur Liebe als die entscheidende innere Haltung an, um eigene Ängste bewältigen und frei wachsen zu können (Kierkegaard, 2003). Ein Gefühl wie die Liebe sei unabdingbar wichtig für die eigene Existenz. Selbstliebe und Liebe des Nächsten seien untrennbar miteinander verknüpft.
»Niemand kann hoffen, ohne zugleich zu lieben, er kann nicht für sich selber hoffen, ohne zugleich zu lieben, denn das Gute hängt unendlich zusammen; liebt er aber, so hofft er zugleich für andere. Und im gleichen Maße, wie er für sich selber hofft, ganz im gleichen Maße hofft er für andere; denn ganz im gleichen Maße, wie er für sich hofft, ganz im gleichen Maße ist er der Liebende« (Kierkegaard, 2003, S. 282).
Selbst der stets mit Rationalität und Vernunft in Verbindung gebrachte Immanuel Kant legt seinem kategorischen Imperativ, dass der Mensch stets moralisch richtig und so handeln solle, so dass dieser Leitspruch jederzeit zum Gesetz werden könne, Gefühle zugrunde. Zwar benötige der Mensch dazu seine Vernunft und seine Erfahrung – also rational-kognitive Elemente –, die Vernunft jedoch könne nur wirken, wenn sie vom Gefühl der Achtung und dem Wunsch nach Liebe getragen sei (Kant, 2016).
Der Skeptiker Nietzsche jedoch sah in erster Linie den Intellekt durch Affekte bedroht. Er sah in Affekten eine Gefahr für das klare Denken, ganz ähnlich den Stoikern. Mit seiner negativistischen Äußerung »Wettstreit der Affekte und Überherrschaft eines Affekts über den Intellekt« (Nietzsche, 1980, S. 421) klingt eine Dimension des menschlichen Empfindens an, die den Affekt in seinem Grundcharakter von Gefühlen und Emotionen unterscheidet.
Während Philosophen und Denker sich damit befassten, wie wohl die durch Emotionen hervorgerufenen Gemütszustände zustande kamen, befassten sich die Vertreter der biologischen und medizinischen Wissenschaften von jeher mit den körperlichen Symptomen emotionaler Reaktionen (Scherer, 1990). Angefangen mit Hippokrates und von Galen, die sich mit den Körpersäften in Verbindung mit dem Charakter und den Emotionen befassten, über Darwins Evolutionstheorie, die Gemeinsamkeiten der Abstammung in Erscheinung, Verhalten und eben auch Gefühlen postulierte, über Cannon und Bards körperlich begründete Emotionstheorie bis hin zu Kretzschmers Konstitutionspsychologie im frühen 20. Jahrhundert – stets wurde der Körper als Ausgangspunkt und Ursache von Emotionen angesehen (Hippokrates & Fuchs, 1897; Galenus, 2019).
2.2 Gefühl, Emotion, Affekt – Definitionsversuche
Es wurden verschiedene Begrifflichkeiten genannt, die man alle eher dem Bereich des Empfindens, Fühlens oder »Spürens« zuordnen würde als dem des Denkens, z. B. Mitleid, Mut, Liebe, Achtung. In der Tat werden selbst in der Fachliteratur die Begrifflichkeiten uneinheitlich verwendet, so dass ein begrifflicher Wirrwarr herrscht. Begriffe wie »Gefühl, »Emotion«, »Stimmung«, »Erregung«, »Affekt« werden durcheinandergeworfen, so dass man oft nicht wissen kann, was der Verfasser genau meint. Die verschiedenen Begriffe bezeichnen nicht dasselbe; sie versuchen, unterschiedliche Befindlichkeiten zu kennzeichnen, die aufgrund ihres zeitlichen Umfangs, dem Ausmaß ihrer Intensität sowie der Art ihrer Qualität für ganz unterschiedliche innere Zustände stehen.
»Die Frage, was ein Gefühl sei, vor 100 Jahren von W. James (1884) gestellt, ist bis heute aktuell und unbeantwortet. Die Komplexität des Gegenstands, nämlich das Gefühl als Erlebnis, Gefühl als (Ausdrucks-)Verhalten und Gefühl als Kovariat von neurophysiologischen Strukturen und Prozessen erschwert aus nahliegenden Gründen eine tiefgreifende Theorienbildung« (Ewert, 1983, S. 397).
Die Vielfalt der verwendeten sprachlichen Begriffe für emotionale Phänomene zeigt zum einen eine Uneinheitlichkeit im Verständnis von Erlebensweisen und Probleme mit der Eingrenzung und Präzisierung des Emotionskonzepts, zum anderen aber auch, dass es eher eine mangelnde Klarheit in der Konzeptualisierung der Theorien gibt als in grundlegenden Meinungsverschiedenheiten über die zugrunde liegenden Prozesse (Scherer, 1990).
In der empirischen Forschung geht man im Allgemeinen davon aus, dass eine »Stimmung« einen zeitlich dauerhafteren inneren Zustand des Individuums beschreibt (»die Stimmung im Büro ist heute nicht die beste«). Stimmungen sind Gefühlserlebnisse von diffusem Charakter (Ewert, 1983). Inwieweit »Gefühl« und »Emotion« dasselbe meinen, darüber besteht kein allgemeiner Konsens; jedenfalls werden sie als zeitlich deutlich eingegrenzter angesehen als »Stimmung«.
Bindungstheoretiker verwenden den Begriff »Emotion« zur Kennzeichnung biologischer Grundmuster im Sinne Darwins und »Gefühl« als Bezeichnung für das Bewusstwerden von Individuen über innere Zustände, die sie dann kommunizieren (Grossmann & Grossmann, 2008). Psychiatrische Sichtweisen dagegen unterscheiden nicht nach der Bedeutung von Empfinden, sondern nach Dauer und Intensität.
»Gefühle heißen einzelne eigentümliche wurzelhafte Seelenbewegungen. Affekte nennt man augenblickliche komplexe Gefühlsverläufe von großer Intensität und auffallenden körperlichen Begleit- und Folgeerscheinungen. Stimmungen nennt man das Zumutesein oder die innere Verfassung bei länger dauernden Gefühlszuständen, die dem gesamten Seelenleben für die Dauer ihres Bestehens eine eigene Färbung geben« (Jaspers, 1973, S. 91; Hervorh. b. Autor).
Die Hirnforscher Gluck, Mercado und Myers (2010) definieren Emotion als
»… ein Gesamt von drei unterschiedlichen, aber wechselseitig miteinander verbundenen Reaktionsarten: physiologische Reaktionen, manifeste (beobachtbare) Verhaltensweisen und bewusstes Empfinden. Zu den physiologischen Reaktionen, die mit Emotion zusammenhängen, gehören Veränderungen des Herzschlags, erhöhte Transpiration, beschleunigte Atmung und dergleichen. Beispiele für manifeste Verhaltensweisen sind Gesichtsausdruck, Tonfall und Körperhaltung. Mit einer Emotion zusammenhängende bewusste Empfindungen sind z. B. die subjektive Erfahrung von Traurigkeit und Glück« (Gluck, Mercado & Myers, 2010, S. 389).
Darüber, dass ein »Affekt« eine spontane, zeitlich sehr eng begrenzte heftige Gefühlsregung ist, besteht hingegen allgemeiner Konsens. Bischof (2008) unterscheidet »Emotion« von »Affekt«, indem er vor allem die Rolle der kognitiven Kontrolle bei Emotionen betont, die bei Affekten fehle.
Читать дальше