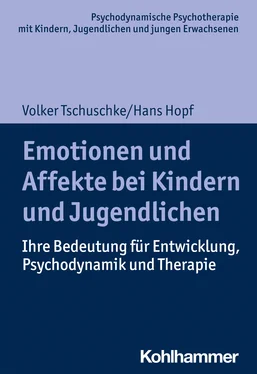Der große mittelalterliche Philosoph Thomas von Aquin definierte Emotionen als ›etwas, das die Seele antreibt‹ in Richtung auf etwas Gutes oder Schlechtes. Ohne emotionale Impulse keine Aktionen!« (Roth, 2001, S. 263; Hervorh. b. Autor).
Der Kleinkindforscher René Spitz (1980) hebt die Bedeutung von Emotionen und Affekten für die Gedächstnisleistung hervor.
»Bei den Tieren haben die Verhaltensforscher unter den Bedingungen emotionaler Belastung (stress) eine enorme Beschleunigung der Erinnerungsspeicherung beobachtet.
Bei den … besprochenen Affektphänomenen ist die Rolle der zugrunde liegenden Triebregung (deren Indikator der Affekt ist) in der Entwicklung von Denkvorgängen von großem Interesse« (Spitz,1980, S. 162 f.).
Dies gilt aber ebenso für intensive positive emotionale Eindrücke (Roth, 1996).
Laux und Weber (1990) sehen sogar eine enge Nachbarschaft zwischen den Begriffen »Stress« und »Emotion« und diskutieren Emotion unter der Überschrift »Bewältigung von Emotionen«. Emotionen dienten der Bewältigung von Belastungs- und Stresssituationen, wie sie auch durch gegebene Bewältigungsressourcen modifiziert würden.
• Es gibt keine einheitliche Emotionstheorie.
• Keine der bekannten philosophischen Sichtweisen vom Altertum bis zur Aufklärung negierte die Bedeutung von Emotionen bzw. Affekten im menschlichen Leben.
• Emotionen und Affekte werden als Teil der menschlichen Natur gesehen.
• Bezüglich der Bewertungen allerdings gehen die Meinungen auseinander: Die meisten Philosophen betonen die unverzichtbare Notwendigkeit von Emotionen für ein glückliches Leben, die anderen sehen speziell in Affekten eine Gefahr.
• Affekte werden von einigen philosophischen Richtungen bzw. Philosophen als den Menschen in die Irre führend angesehen, den Intellekt bedrohend, weshalb sie am besten durch die Entwicklung von Tugend und Beherrschung vermieden werden sollten.
• Affekte werden als eine deutlich von Emotionen abgrenzbare Kategorie angesehen, insofern sie sich weitgehend einer bewussten Kontrolle entziehen.
• Gefühle bzw. Emotionen kommen durch hochkomplexe innerorganismische Aktivitäten zustande, an der verschiedene »organismische Subsysteme« beteiligt sind, was eine einheitliche Erklärung und Definition für den Bereich des subjektiven, gefühlshaften Erlebens unmöglich macht.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Bischof, N. (2008). Psychologie. Ein Grundkurs für Anspruchsvolle. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Damasio, A. R. (2018). Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. 9. Auflage. Berlin: List.
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2002). Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta.
Scherer, K. R. (1990). Theorie und aktuelle Probleme der Emotionspsychologie. In: K. R. Scherer (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Psychologie der Emotion – Motivation und Emotion (S. 1–38). Band 3. Göttingen: Hogrefe.
• Die meisten Philosophen postulierten, dass Affekte kultiviert werden müssten. Welche Begriffe verwendeten sie?
• Bei welchem Philosophen schließen sich Intellekt und Affekte gegenseitig aus?
• Welcher Philosoph sieht eine grundlegende Ethik erst durch was gewährleistet?
3 Zur Evolution von Gefühlen
3.1 Darwin und das Bild vom Menschen
Den größten Einfluss auf das heutige Wissen über die Natur der Lebewesen und damit auch des Menschen allerdings hatte Charles Darwin. Er belegte nicht nur als Erster aufgrund anatomischer Gemeinsamkeiten oder großer Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Arten die gemeinsame Abstammung aus vorangegangenen Lebensformen, sondern er unterstellte auch gemeinsame Wurzeln von Intelligenz, Denkfähigkeiten, Gedächtnis und Gefühlen (Darwin, 1859; 1877; 2013; Plutchik, 1980). Der Ausgangspunkt seiner Entdeckungen war die Beobachtung, dass es bestimmte Formen des Anpassungsverhaltens gibt, die alle Organismen als Reaktion auf spezielle Ereignisse in ihrer Umgebung zeigen, selbst die einfachsten Lebensformen. Die Umgebung aller Organismen kreiere die gleichen Probleme, z. B. die Notwendigkeit der Identifikation von Beute und Räuber, Freund und Feind oder Nahrung (Pluchik, 1980). Emotionen seien körperliche Reaktionen, im Inneren wie im Verhalten nach außen, um die basalen Überlebensprobleme zu bewältigen, die die Umgebung hervorrufe. Gefühle stellten Lösungsversuche des Organismus dar, Kontrolle über bestimmte Ereignisse zu gewinnen, die im Zusammenhang mit dem Überleben des Organismus stünden.
Darwins Beobachtungen und Schlussfolgerungen zur Verwandschaft emotionaler Reaktionsweisen bei verschiedenen Lebensformen beziehen sich auf körperliche Reaktionsweisen wie auch auf emotionale Ähnlichkeiten.
»Beim Menschen lassen sich einige Formen des Ausdrucks, so das Sträuben des Haares unter dem Einflusse des äuszersten Schreckens, oder des Entblöszenz der Zähne unter der rasenden Wuth, kaum verstehn, ausgenommen unter der Annahme, dasz der Mensch früher einmal in einem viel niedrigeren und thierähnlichen Zustande existirt hat. Die Gemeinsamkeit gewisser Ausdrucksweisen bei verschiedenen, aber verwandten Species, so die Bewegungen derselben Gesichtsmuskeln, während des Lachens beim Menschen und bei verschiedenen Affen, wird etwas verständlicher, wenn wir an deren Abstammung von einem gemeinsamen Urerzeuger glauben.
[…]
Um eine so gute Grundlage als nur möglich zu gewinnen und nun, unabhängig von der gewöhnlichen Meinung, zu ermitteln, in wie weit besondere Bewegungen der Gesichtszüge und eigenthümliche Geberden wirklich gewisse Seelenzustände ausdrücken, habe ich die folgenden Mittel als die nützlichsten befunden. An erster Stelle sind Kinder zu beobachten: denn sie bieten, wie Sir Ch. Bell bemerkt, viele seelische Erregungen, ›mit auszerordentlicher Kraft‹ dar; während im späteren Leben mehrere unsrer Ausdrucksarten ›aufhören, der reinen und einfachen Quelle zu entspringen, aus welcher sie in der Kindheit hervorgehen‹« (Darwin, 2013, S. 11 f.).
Darwin stellte grundlegende Prinzipien auf, die seiner Auffassung nach am besten die Ausdrucksformen und Gebärden erklären, die vom Menschen und niederen Tieren unter dem Einfluss unterschiedlicher »Seelenbewegungen und Gefühle« unwillkürlich gebraucht würden und anlagebedingt seien.
»Dasz die hauptsächlichsten ausdruckgebenden Handlungen, welche der Mensch und die niedern Thiere zeigen, jetzt angeboren oder angeerbt sind, – d. h. dasz sie nicht von dem Individuum gelernt worden sind – wird von jedermann zugegeben. Ein Erlernen oder Nachahmen hat mit mehreren derselben so wenig zu thun, dasz sie von dem frühesten Tagen der Kindheit an durch das ganze Leben hindurch vollständig auszer dem Bereiche der Controle liegen: so z. B. die Erschlaffung der Arterien in der Haut und die erhöhte Herzthätigkeit beim Zorn. Wir können Kinder, nur zwei oder drei Jahre alt und selbst blindgeboren, vor Scham erröthen sehen« (Darwin, 2013, S. 322).
Junge wie alte Individuen sehr unterschiedlicher Ethnien drückten die gleichen Seelenzustände durch die gleichen Bewegungen bei Menschen wie bei Tieren aus.
»Die bei weitem größere Zahl der Bewegungen des Ausdrucks, und alle die bedeutungsvolleren, sind, wie wir gesehen haben, angeboren und vererbt, und von diesen kann man nicht sagen, dasz sie vom Willen des Individuum abhängen. Nichtsdestoweniger waren alle die unter unser erstes Gesetz Fallenden ursprünglich zu einem bestimmten Zwecke ausgeführt worden – nämlich um irgend einer Gefahr zu entgehen, irgend eine Noth zu erleichtern oder irgend ein Verlangen zu befriedigen« (Darwin, 2013, S. 324).
Читать дальше