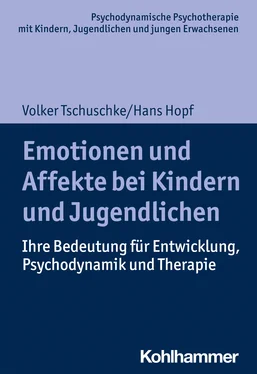Und:
»Ich habe mit ziemlich detaillierter Ausführlichkeit zu zeigen mich bemüht, dasz alle die hauptsächlichsten Ausdrucksweisen, welche der Mensch darbietet, über die ganze Erde dieselben sind. Diese Thatsache ist interessant, da sie ein neues Argument zu Gunsten der Annahme beibringt, dasz die verschiedenen Rassen von einer einzigen Stammform ausgegangen sind. … Es ist bei weitem wahrscheinlicher, dasz die vielen Punkte groszer Ähnlichkeit in den verschiedenen Rassen Folge der Vererbung von einer einzigen elterlichen Form sind, welche bereits einen menschlichen Charakter angenommen hatte« (Darwin, 2013, S. 330 f.).
Darwin ging von einer gemeinsamen Abstammung aus, Ausdrucks- und Verhaltensmuster sah er als angeboren und als Folgen von Vererbung an.
»Die Bewegungen des Ausdrucks im Gesicht und am Körper, welcher Art auch ihr Ursprung gewesen sein mag, sind an und für sich selbst für unsere Wohlfahrt von groszer Bedeutung. Sie dienen als die ersten Mittel der Mittheilung zwischen der Mutter und ihrem Kinde; sie lächelt ihm ihre Billigung zu und ermuthigt es dadurch auf dem rechten Wege fortzugehen, oder sie runzelt ihre Stirn aus Missbilligung« (Darwin, 2013, S. 335).
3.2 Basisemotionen und ethnologische Sichtweisen
Die Darwin’sche Sichtweise der vererbten Anlage und zu automatischen, ganz spezifischen gemütshaften Reaktionen auf bestimmte Umgebungsanforderungen hat sich in den Emotionstheorien auf breiter Ebene niedergeschlagen. In der psychologischen Literatur zu Emotionstheorien geht man davon aus, dass es sogenannte »Basisemotionen« gibt, die universell und für alle Menschen, Ethnien und Kulturen Gültigkeit besitzen (Zimbardo & Gerrig, 2004). Die allgemein gehandelten Basisemotionen seien Wut, Angst, Ekel, Erschrecken, Freude, Überraschung und Trauer. Diese Aufzählung differenzieller, angeborener Emotionszustände wird u. a. auf den Emotionsforscher Paul Ekman zurückgeführt, der emotionale Regungen anhand von menschlichen Gesichtsausdrücken seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts beforscht. In neuerer Zeit geht Ekman von fünf Basisemotionen aus (Ekman, 1992): Freude, Trauer, Zorn, Furcht und Ekel.
»Diese elementaren Emotionen sind in bezug auf folgende neun Eigenschaften charakterisiert: distinktive universale Signale, Vorkommen auch bei nicht-menschlichen Primaten, distinktive Physiologie, distinktive universale Aspekte in Auslöservorgängern, Kohärenz der emotionalen Reaktionen, schnelles Einsetzen, kurze Dauer, automatische Bewertung und unerbetenes Auftreten (Ekman, 1992)« (Fonagy et al., 2008, S. 80; Zitat dort).
Unter evolutionärer Perspektive stellt der gefühlshafte Ausdruck (speziell der Affekt) ein Signal für eine bestimmte Verhaltensbereitschaft dar (Steimer, 2005, S. 313). Die evolutionäre Sicht betont den Überlebensvorteil von Verhalten und Ausdruck, und dazu gehört der kommunikative Charakter der Ausdrucksformen, der dazu dient, an Freund und Feind Signale auszusenden, die für den Sender überlebensnotwendig sind, ihn schützen (Signale von Aggressions- und Kampfbereitschaft, Gefahr für den Angreifer) oder ihm dienlich sein sollen (Signale bezüglich Paarungsbereitschaft, Nahrung, Sicherheit).
Ethnologische Forschungen von Benedict (1934) und Mead (1939) vertraten schon früh die Auffassung, dass zwischen verschiedenen Kulturen enorme Unterschiede hinsichtlich der Formen des Gefühlsausdrucks bestünden. Unterschiedliche Kulturen lehrten ihre Mitglieder unterschiedliche Regeln über angemessene Verhaltensweisen und wie Emotionen in verschiedenen sozialen Kontexten und Situationen zu zeigen seien (Gluck et al., 2010). Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass die Fähigkeit zum Emotionserleben und -ausdruck anlagebedingt ist und auf evolutionär unverzichtbaren Gegebenheiten fußt, die Formen des emotionalen Erlebens und des Emotionsausdrucks hingegen aber sozial und kulturell vermitteltet sind.
• Bestimmte basale Gefühle werden als evolutionsbedingt aufgefasst und sind ethnien- und kulturübergreifend erkennbar.
• Gefühle und Emotionen erfüllen verschiedene Funktionen, vor allem dienen sie als Signale für die Umgebung und haben für die Arten – also auch den Menschen – einen Überlebensvorteil.
• Aufgrund der Ähnlichkeit basaler Emotionsausdrücke ging Darwin von einer gemeinsamen Abstammung aus, so dass Ausdrucks- und Verhaltensmuster als angeboren und somit vererbt betrachtet werden müssten.
• Ethnologische und Hirnforscher dagegen betonen kulturelle Unterschiede in emotionalen Ausdrucksformen, die darauf hindeuteten, dass nicht alles am emotionalen Ausdruck erbbiologisch vorgegeben, sondern vieles erfahrungs- und lernabhängig sei.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Darwin, C. (2013). Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren. Bremen: Bremen University Press.
Plutchik, R. (1980). Emotion. A psychoevolutionary synthesis. New York, NY: Harper & Row.
Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. (2004). Psychologie. 16. Auflage. München: Pearson.
• Wie sieht das Verhältnis zwischen Körper und Emotion bei Darwin aus?
• Ist die Universalität basaler emotionaler Ausdrucksformen erbbiologisch festgelegt, oder kann auch eine kulturelle Überformung erfolgen?
• Wie kann man sich erklären, dass sich – trotz gemeinsamer Abstammung – in verschiedenen Kulturen unterschiedliche emotionale Ausdrücke entwickeln?
4 Emotionstheorien
4.1 Theorien zur erbbiologischen Anlage von Emotionen
Theorien, die von einer anlagebedingten, also vererbten Fähigkeit zu Gefühlsausdrücken ausgehen, stehen naturgemäß der Darwin’schen Auffassung von einem gemeinsamen Stammbaum des Gefühlsausdrucks und seinen Erscheinungsformen nahe. Wenn nun alle Lebewesen einen gemeinsamen Ursprung haben – was heute wissenschaftlich nicht mehr angezweifelt werden kann –, dann muss auch von einer Verwandtschaft von bestimmten Verhaltens- und Ausdrucksweisen ausgegangen werden, so dass eine gewisse Universalität auch bei den Gefühlsausdrücken zu unterstellen ist. Wie Darwin überzeugend nachgewiesen hat, handelt es sich beim Ausdruck von Gefühlen nicht um eine beliebige Spielart, sondern um überlebensnotwendige und – im Laufe langer Entwicklungszeit – überlebensoptimierte Formen des Ausdrucks von Gemütszuständen, die zwar kulturell mehr oder weniger überformt werden können, die aber in ihrem Grundcharakter vermutlich eher identischer als ähnlicher Natur sein dürften.
Überlebensnotwendige Fähigkeiten von Organismen gehören also zur genetischen Grundausstattung, die nicht einfach abgelegt werden können. Aus dieser Sicht muss es auch gleiche oder ähnliche Ausdrucksformen geben, die nicht vom jeweiligen individuellen Lebewesen oder von der sozial-kulturellen Umgebung kreiert worden sind und allgemein verstanden werden. Speziell beim Menschen gelangt man aber schnell zu der Frage, ob es nicht auch individuelle Formen des Gefühlsausdrucks gibt, dass also die Art und Weise des Gefühlsausdrucks nicht grundsätzlich starr und vorgegeben ablaufen muss, sondern dass auch individuelle Überformungen gefühlshafter Ausdrücke möglich werden, ohne den Grundcharakter der evolutionär erworbenen und für ein Überleben notwendigen Bedürfnisse zu verlieren.
Theoretiker des anlagebedingten Erklärungsansatzes von Gefühlsausdrücken kommen aus den verschiedensten psychologischen Schulen und Sichtweisen, sie reichen von evolutionär-anthropologisch orientierten Motivations- und Persönlichkeitsforschern bis hin zu lerntheoretisch-verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Theoretikern. Sie alle gehen mal mehr, mal weniger von anlagebedingten, erblichen Ursprüngen menschlicher Gefühlsausdrücke aus. Basale Gefühle haben sich im Laufe der Evolution in primitiver oder differenzierterer Form bei allen Arten entwickelt und haben ihrer Auffassung nach einen adaptiven Charakter, weil sie im Überlebenskampf von unverzichtbarer Notwendigkeit sind. Aus dieser Perspektive kann es dann auch keine Frage mehr sein, ob Gefühle und Empfindungen anlagebedingt vorgegeben sind oder nicht. Die grundsätzliche Fähigkeit zum emotionalen Empfinden und zum Ausdruck desselben ist es zweifelsfrei immer, es stellt sich lediglich die Frage, inwieweit Emotionen modifiziert und zu differenzierteren Erlebens- und Ausdrucksweisen ausgeformt werden können, wodurch dies erfolgt und wovon dies abhängt. Außerdem stellt sich die Frage, ob bestimmte Emotionen, die nicht ursprünglich erbbiologisch mitgegeben wurden, nicht auch ausschließlich sozial und kulturell vermittelt werden können. Die Fähigkeit zur Ausformung bestimmter Emotionen oder Affekte dürfte zweifelsfrei eine genetische Mitgift sein, die Formen seelischen Ausdrucks hingegen könnten von relativ primitiven, rein anlagebedingten Ausdrucksweisen bis hin zu hoch differenzierten, phylogenetisch und ontogenetisch ausgebildeten reichen.
Читать дальше