Literatur zur vertiefenden Lektüre
Eccles, J. C. (1987). Die Großhirnrinde. In: K. R. Popper & J. C. Eccles (Hrsg.), Das Ich und sein Gehirn (S. 283–308). München: Piper.
Kolb, B. & Whishaw, I. Q. (1996). Neuropsychologie. 2. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
Roth, G. (1996). Das Gehirn des Menschen. In: G. Roth & W. Prinz (Hrsg.), Kopf-Arbeit. Gehirnfunktionen und kognitive Leistungen (S. 119–180). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
Roth, G. (2001). Fühlen – Denken – Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
• Welcher Bereich des Gehirns ist überwiegend für die Entstehung von Emotionen wichtig?
• Was wird auch als »Organ der Zivilisation« bezeichnet?
• Welches Organ des Mittelhirns ist eine zentrale Umschaltstelle für alle Informationen an den Neocortex?
• Welcher Teil des Cortex dient als entscheidende Schaltstelle zum limbischen System?
• Wann entsteht aus Sinnesreizen subjektive emotionale Bedeutung?
• Wo im Gehirn laufen lebensnotwendige Funktionen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ab?
• Welche ist die Hauptbewertungsinstanz – im Hinblick auf die emotionale Bedeutung – des limbischen Systems?
Teil II Die Bedeutung von Gefühlen in Philosophie und Wissenschaft
2 Begriffsklärungen und Definitionen
2.1 Körper und Gefühle – Philosophische Erklärungsansätze
Das Wesen der Gefühle beschäftigte die Philosophie bereits sehr früh. Empfinden und Verhalten von Tieren und Menschen waren zu allen Zeiten eine Herausforderung für Philosophen, Dichter und Wissenschaftler (Scherer, 1990).
»Nahezu alle großen Philosophen haben den Emotionen wesentliche Teile ihres Werkes gewidmet: die Großen der klassischen griechischen Philosophie, insbesondere Plato und Aristoteles; die Philosophen der Stoa; die Philosophen und Rhetoriker der römischen Schulen, wie etwa Cicero; Kirchenväter wie Augustinus, die Vertreter der scholastischen Philosophie des Mittelalters, so etwa Thomas von Aquin; die Philosophen des 17. Jahrhunderts, insbesondere Descartes und Spinoza; die Philosophen der Aufklärung, insbesondere Kant; und eine große Zahl von Philosophen der Neuzeit, in besonderem Maße Sartre« (Scherer, 1990, S. 1).
Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) gilt heute als der erste Philosoph, der eine vollständige Theorie der Affektentwicklung vorstellte (Aristoteles, 2011; 2017; Fonagy et al., 2008; Höffe, 2009). Nach ihm kann die Seele in einen vernunftbegabten und einen Teil ohne Vernunft unterteilt werden. Letzterer bestehe aus dem vegetativen Teil, den der Mensch mit allen anderen lebenden Geschöpfen teile. Als vernunft- und sprachbegabtes Wesen verfüge er aber auch über Gemütsbewegungen, die er nicht verhindern, jedoch kontrollieren könne. »Tugend« ist ein wichtiger Begriff bei Aristoteles. Sie sei erforderlich, um mit aufkommenden Affekten »richtig« umzugehen, nämlich indem der Mensch sie beherrsche.
»Da es nun drei Dinge in der Seele gibt, Affekte, Fähgkeiten und Eigenschaften, wird wohl die Tugend eines von ihnen sein. Als Affekte bezeichne ich Begierde, Zorn, Furcht, Mut, Neid, Freude, Liebe, Hass, Sehnsucht, Eifersucht, Mitleid und allgemein alles, was von Lust und Unlust begleitet wird. Fähigkeiten sind das, wodurch wir für diese Affekte empfänglich genannt werden, wie etwa das, wodurch wir fähig sind zu zürnen und Unlust oder Mitleid zu empfinden. Die Eigenschaften wiederum sind es, durch die wir uns zu den Affekten richtig oder falsch verhalten; so verhalten wir uns etwa dem Zorn gegenüber falsch, wenn wir allzu heftig oder schwach zürnen, richtig aber, wenn wir es mit Mittelmaß tun; ebenso ist es auch mit den übrigen Affekten« (Aristoteles, 2017, S. 41 f.).
Bemerkenswert sind die weit vor der heutigen Zeit erfolgten differenzierten Überlegungen zur Psychologie von Emotionen und Affekten und das Erkennen der komplexen Zusammenhänge zwischen Körperreaktionen wie z. B. Lust-Unlust-Empfinden, damit in Verbindung stehenden Emotionen und Abwehrprozessen (bei Aristoteles Kontrolle durch Tugend).
Dagegen kritisierten die Stoiker Aristoteles; sie gingen davon aus, Affekte seien nicht zu kontrollieren, sie entzögen sich der Kontrolle und seien daher nicht kultivierbar (Fonagy et al., 2008). Ihnen zufolge sei der Mensch vom Logos der Natur geleitet. Allein der Geist und das Denkvermögen könnten den Menschen dahin führen, am »göttlichen Logos« teilzuhaben. Durch ein ständiges Bemühen um Selbstformung und -kontrolle könne der Mensch zur Selbstgenügsamkeit und Unerschütterlichkeit gelangen. Die stoische Ruhe ermögliche es, Affekte am besten zu vermeiden, um so zur »Selbstvervollkommnung« zu gelangen.
»Die Stoiker betrachteten die Affekte als falsche Urteile und daher als korrumpierende Faktoren, die uns vom rechten Wege abbringen. Deshalb ist es unsere Pflicht, uns von ihnen zu distanzieren und uns zu bemühen, einzig auf der Grundlage der Vernunft zu handeln. Wenn es uns gelingt, der überwältigenden Macht der Affekte zu widerstehen, können wir Gleichmut und Selbstgenügsamkeit entwickeln, die es uns erlauben, ein glückliches und vernunftgemäßes Leben zu führen« (Fonagy et al., 2008, S. 77).
Fonagy et al. stellen eine interessante Verbindung her, indem sie den Einfluss der Stoa auf die römische Kirche betonen, »… die den Affekten und dem Körper feindlich gegenüberstand …« (S. 77). Affekte machen dem Emotionsphilosophen DeSousa (1987) zufolge für die römische Kirche fünf der sieben Todsünden aus: Hoffart, Wolllust, Neid, Völlerei, Zorn und Trägheit, während drei der vier Kardinaltugenden – Weisheit, Besonnenheit, Tapferkeit – nur auftreten könnten, wenn der Mensch sich gegen seine emotionalen Versuchungen zur Wehr setze. Man kann hier noch heute unschwer die konservative Haltung der römisch-katholischen Kirche gegenüber dem menschlichen Gefühlsleben und seinen Verbindungen zu körperlichen Regungen erkennen.
Der französische Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler René Descartes hat den bis heute nachhaltigsten Einfluss auf das abendländische Denken zum Verhältnis von Körper und Geist bzw. Seele genommen. Er schuf einen Dualismus, der bis heute das Denken und Handeln in der naturwissenschaftlich begründeten Medizin prägt.
»… da Descartes das Denken bekanntlich für eine Tätigkeit hielt, die sich völlig losgelöst vom Körper vollzieht, behauptet er in dieser Äußerung die radikale Trennung von Geist, der ›denkenden Substanz‹ (res cogitans) und dem nichtdenkenden Körper, der Ausdehnung besitzt und über mechanische Teile verfügt (res extensa)« (Damasio, 2018, S. 329; Hervorh. dort).
Damasio sieht in der »abgrundtiefen Trennung von Körper und Geist«, wie sie Descartes vorgenommen habe, einen »großen Irrtum« (s. hierzu ausführlich Abschnitt III;  Teil III). Auch der britisch-österreichische Philosoph Sir Karl R. Popper kritisierte Descartes’ Auffassung vom Menschen als Maschine, eines von mechanistischer Kosmologie beherrschten Apparats, die keinen Raum lasse für ein lebendiges Wesen mit Seele (Popper, 1987).
Teil III). Auch der britisch-österreichische Philosoph Sir Karl R. Popper kritisierte Descartes’ Auffassung vom Menschen als Maschine, eines von mechanistischer Kosmologie beherrschten Apparats, die keinen Raum lasse für ein lebendiges Wesen mit Seele (Popper, 1987).
Eine Brücke zwischen Aristoteles und der Stoa schlug der portugiesische Philosoph Spinoza, der beide Positionen miteinander vereinte, indem er seiner radikalen Philosophie ethische Ziele zugrundelegte (Spinoza, 2017). Der Mensch solle insbesondere die illusorischen Lebensziele vom einzig Wahren differenzieren. Der Begriff der »Substanz« spielt bei ihm eine überragende Rolle. Er verstand darunter das, was in sich sei und durch sich begriffen werde; so sah er Gott als die einheitliche und ewige Substanz an. Eine Substanz benötige keine weitere Ursache, sie sei Ursache ihrer selbst, wie eben Gott auch. Denken (Geist) und Ausdehnung (Materie) sind für Spinoza zwei verschiedene »Attribute« der Substanz. Wie Descartes sah Spinoza einen Gegensatz zwischen Geist und Materie, allerdings konstruierte er nicht wie Descartes einen Dualismus, sondern einen Monismus. Geist und Materie seien keine gegensätzlichen Substanzen, sondern verschiedene Attribute einer einzigen Substanz (psychophysischer Parallelismus).
Читать дальше
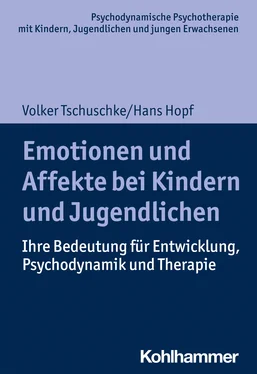
 Teil III). Auch der britisch-österreichische Philosoph Sir Karl R. Popper kritisierte Descartes’ Auffassung vom Menschen als Maschine, eines von mechanistischer Kosmologie beherrschten Apparats, die keinen Raum lasse für ein lebendiges Wesen mit Seele (Popper, 1987).
Teil III). Auch der britisch-österreichische Philosoph Sir Karl R. Popper kritisierte Descartes’ Auffassung vom Menschen als Maschine, eines von mechanistischer Kosmologie beherrschten Apparats, die keinen Raum lasse für ein lebendiges Wesen mit Seele (Popper, 1987).










