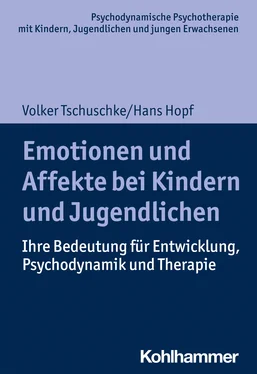Philip Zimbardo und Richard J. Gerrig sind die Autoren des bekanntesten Psychologie-Lehrbuchs. Beide forschten an der Stanford University zu unterschiedlichen psychologischen Fragestellungen. Sie sind der Auffassung, dass Triebe interne Zustände des Organismus bewirken, die bestimmte physiologische Prozesse in Gang setzten. Daraus ergebe sich das Motiv für lebende Organismen, einen Zustand der Homöostase bzw. des Gleichgewichts wiederherzustellen (2004). Auch das traditionell immer wieder aktualisierte Dorsch-Lexikon der Psychologie definiert das Affektsystem als mit Organempfindungen verknüpft (Bergius, 2014, S. 102).
4.3 Abschließende Bemerkungen
Aus evolutionsbiologischer Perspektive ist das Ziel allen Verhaltens die Sicherstellung der Fortpflanzung und Weitergabe der eigenen Gene. Entsprechend gibt es im Verhalten von Tieren relativ starre Koppelungen von Reizen und Reaktionen, für die im Nervensystem Mechanismen auf genetischer Basis bereitstehen, wie die ethologische Forschung gezeigt hat (Lorenz, 1967; Tinbergen, 1951). Das Verhalten von Tieren folgt meist dem Reiz-Reaktionsschema (S = stimulus, R = reaction). Das Verhalten von Säugetieren allerdings ist bereits komplexer als das von beispielsweise Amphibien oder Insekten.
»Jeder Hundehalter ist wahrscheinlich mit Recht davon überzeugt, daß sein Tier Emotionen, z. B. Freude und Traurigkeit erlebt. Zwar sind die Instinktbewegungen, wie sie von den Ethologen auch im Verhalten von Säugern beschrieben wurden (vgl. Eibl-Eibesfeld, 1978; Ewer, 1976; Lorenz, 1937; Tinbergen, 1951), dadurch gekennzeichnet, dass bei einer entsprechenden inneren ›Gestimmtheit‹ und dem Vorhandensein eines ›Auslösereizes‹ eine relativ starre Bewegungsabfolge, die eigentliche ›Instinkthandlung‹, ausgelöst wird. Beim sogenannten Appetenzverhalten, das der eigentlichen Instinkthandlung vorausgeht, zeigt sich aber auch schon unterhalb der Organisationsstufe der Säugetiere eine größere Variabilität und Abhängigkeit von der Lerngeschichte des Individuums.
Das Verhalten von Säugetieren und besonders von Primaten, ist zudem im Vergleich mit den anderen Klassen der Vertebraten und der Invertebraten durch eine größere Flexibilität auch bei den Endhandlungen ausgezeichnet. Ein bestimmter Reiz löst häufig nicht mehr ein bestimmtes Verhalten aus, sondern bestimmt nur die allgemeine Richtung des Verhaltens« (Schneider & Dittrich, 1990, S. 44; Hervorh. bei den Autoren).
Die auf genetischen Annahmen fußenden Theorien zum Gefühlsleben beim Menschen reichen von relativ starren Reiz-Reaktionsmodellen – bei denen sich der Mensch im Prinzip nicht vom Tier unterscheidet – bis zu sehr differenzierten, individuumsbezogenen Erfahrungs- und Lernhintergründen, allerdings auf der Basis einer biologisch mitgegebenen genetischen Ausstattung, die die grundsätzliche Reaktionsrichtung aufgrund eines bestimmten Reizes oder einer bestimmten Situation vorgibt.
Emotionen konnten erst auf einer Stufe der Entwicklung der Arten vorteilhaft werden, auf der starre Verknüpfungen von Reiz-Reaktionsschemata zugunsten einer größeren Verhaltensvariabilität (Entscheidungsfreiheit) aufgegeben wurden (Schneider & Dittrich, 1990).
• Die Mehrzahl aller Emotionstheorien geht davon aus, dass Gefühle anlagebedingt sind und nicht erworben werden bzw. dass es zumindest angeborene Dispositionen für Gefühlsempfindungen gebe.
• Daneben gibt es Theorien, die die Abhängigkeit der Emotionen von Triebspannungen betonen, in der Mehrheit psychoanalytische Annahmen.
• Fast alle Emotionstheorien postulieren eine Körperabhängigkeit der Emotionen, indem Triebspannungen und Körperreize Gefühle auslösen.
• Die Emotionsforschung zeigt, dass alle Lebewesen über eine basale Ausstattung an emotionalen Reaktionsweisen verfügen, dass sich aber bei komplexeren Lebensformen auch größere Variationsbreiten für emotionale Ausdrucksweisen finden lassen.
• Diese komplexeren emotionalen Reaktionsweisen sind auf die evolutionär herausgebildete Vergrößerung des Neocortex zurückzuführen – und einer damit einhergehenden intellektuellen Leistungsfähigkeit – , sie sind aber untrennbar mit einer parallel laufenden Herausdifferenzierung emotionaler Reaktionsweisen verbunden, die ihrerseits auf die intellektuelle Fortentwicklung rückwirkt.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Darwin, C. (2013). Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren. Bremen: Bremen University Press.
Plutchik, R. (1980). Emotion. A psychoevolutionary synthesis. New York, NY: Harper & Row.
Schneider, K. & Dittrich, W. (1990). Evolution und Funktion von Emotionen. In: N. Birbaumer, C. F. Graumann, M. Irle, J. Kuhl, W. Prinz & F. E. Weinert (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Band 3. K. R. Scherer (Hrsg.), Psychologie der Emotion – Motivation und Emotion (S. 41–114). Göttingen: Hogrefe.
Zepf, S. (2000). Allgemeine psychoanalytische Neurosenlehre, Psychosomatik und Sozialpsychologie. Bibliothek der Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag.
• Gibt es Unterschiede zwischen Triebspannungen und Körperreizen?
• Wie entstehen Emotionen der Mehrheit der Theorien zufolge?
• Wie erfolgt die Übersetzung von gefühlten Triebspannungen oder Körperreizen in Emotionen?
• Wie ist der Unterschied in den emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen im Vergleich zum Tier zu erklären?
Teil III Wie entstehen Gefühle?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.