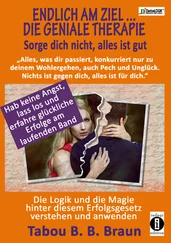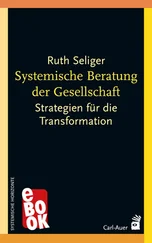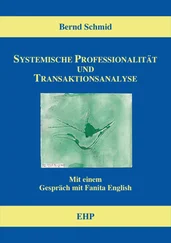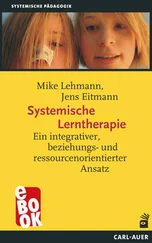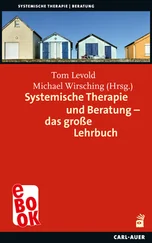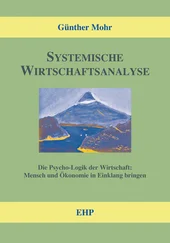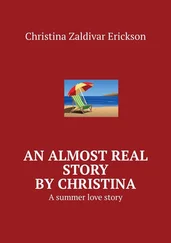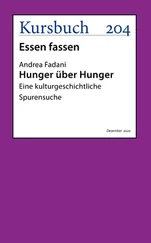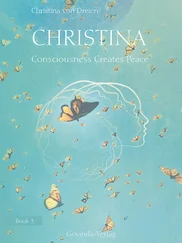2 Verwandtschaft mit anderen Verfahren
2.1 Historisches
Die Geschichte der Psychotherapie ist bis in die 1950er Jahre v. a. geprägt durch die Psychoanalyse, mit vielfacher Verwandtschaft zur Existentiellen und Humanistischen Psychotherapie (Hunger und Schweitzer 2020). Neben vielen Erfolgen gab es aber auch immer Patientinnen und Patienten, die nicht profitierten. So entwickelten sich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Systemischen Therapie und Verhaltenstherapie alternative Psychotherapieverfahren. Während die Verhaltenstherapie sich auf die Forschungsergebnisse der Allgemeinen Psychotherapie, speziell der Lernpsychologie, konzentrierte, widmete sich die Systemische Therapie familiendynamischen Prozessen in Abgrenzung und Ergänzung der zuvor im Mittelpunkt psychoanalytischer Arbeit stehenden psychodynamischen Prozessen, in denen auch die Vertreterinnen und Vertreter der frühen Modelle ( 
Kap. 1.1 1.1 Frühe Modelle: Familientherapie und Mehrgenerationenperspektive (ca. 1950–1980) Leitidee: Das Individuum wird ergänzt um seine Familie. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre dominierte in den US-amerikanischen und europäischen Ländern die Psychoanalyse. Jedoch gab es auch immer wieder Personen, denen nicht ausreichend geholfen werden konnte. Erste alternative Veränderungen zeigten sich im Einbezug des Herkunftssystems, um über den bis dato stark individuumszentrierten Ansatz hinaus bedeutsame Unterschied in der Erklärung und Behandlung dysfunktionaler Dynamiken zu setzen.
) noch grundständig professionalisiert worden waren. So ergibt sich historisch sinnstiftend die Erweiterung psychoanalytischer Ideen über die Psyche eines Individuums auf die sozial-kollektive Psyche einer Familie als mehrpersonalem sozialen System und unter Einbezug transgenerationaler bis hin zu gesellschaftsdynamischen Prozessen. Eine stärkere Grenzziehung systemtheoretischer Erkenntnistheorien und Interventionen zu andern Psychotherapieschulen erfolgte erst ab den 1960er und 1980er Jahren, v. a. in den Ansätzen der Kybernetik 1. und 2. Ordnung und der nachfolgenden Modelle (  Kap. 1.2,
Kap. 1.2,  Kap. 1.3,
Kap. 1.3,  Kap. 1.4).
Kap. 1.4).
2.2 Gemeinsamkeiten
2.2.1 Transdisziplinarität in systemtherapeutischen Ansätzen
Die Systemische Therapie verkörpert einen transdisziplinären Ansatz und ist seit jeher offen für Einflüsse anderer Psychotherapieverfahren. Insbesondere spiegeln sich Aspekte der psychoanalytischen Bindungstheorie, der Lerntheorie bis hin zu sozial-ökologischen und entwicklungspsychologischen Aspekten in den verschiedenen systemtherapeutischen Ansätzen wider. Im Folgenden seien einige ausgewählte Beispiel zur Verdeutlichung dargestellt. Eine umfassende Übersicht ist bei von Sydow et al. (2007) zu finden.
Die Attachment Based Family Therapy (ABFT) (Diamond et al. 2003) integriert Aspekte der Bindungstheorie (Bowlby 1969, 1973, 1980), Emotionsfokussierten Therapie (Auszra et al. 2016) und Kontextuellen Familientherapie (Böszörményi-Nagy et al. 2015) (  Kap. 1.1.1). Sie richtet sich an Familien mit Jugendlichen, die unter einer depressiven Störung leiden. Zunächst wird auf die Identifikation und Bearbeitung bindungsrelevanter Familienkonflikte aus Vergangenheit und Gegenwart fokussiert. Aufbauend auf einem verbesserten Bindungsstatus der Familie als Ganzem wird anschließend die Bezogene Individuation (
Kap. 1.1.1). Sie richtet sich an Familien mit Jugendlichen, die unter einer depressiven Störung leiden. Zunächst wird auf die Identifikation und Bearbeitung bindungsrelevanter Familienkonflikte aus Vergangenheit und Gegenwart fokussiert. Aufbauend auf einem verbesserten Bindungsstatus der Familie als Ganzem wird anschließend die Bezogene Individuation (  Kap. 1.1.2) des betroffenen sozialen Systems gestärkt. Themen der ABFT umfassen u. a. die Arbeit mit übermäßiger elterlicher Kritik, fehlender Motivation der Jugendlichen, elterlichem Stress, ineffektivem Erziehungsstil, dysfunktionaler Affektregulation und negativem Selbstkonzept spezifischer Familienmitglieder sowie der Familie als Ganzem.
Kap. 1.1.2) des betroffenen sozialen Systems gestärkt. Themen der ABFT umfassen u. a. die Arbeit mit übermäßiger elterlicher Kritik, fehlender Motivation der Jugendlichen, elterlichem Stress, ineffektivem Erziehungsstil, dysfunktionaler Affektregulation und negativem Selbstkonzept spezifischer Familienmitglieder sowie der Familie als Ganzem.
Mehrzählige Beispiele existieren mit Bezügen zu lerntheoretischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Die Behavioral Family Systems Therapy (BFST) (Robin und Foster 1989) wurde zur Behandlung von Familien mit Jugendlichen, diagnostiziert mit einer Essstörung, entwickelt und wird inzwischen auch bei Diabetes genutzt. Sie fokussiert darauf, (sub-)systemische Verstrickungen und Hierarchieumkehr innerhalb eines betroffenen sozialen Systems zu erkennen und zu verändern. Es wird mit Problemlöse- sowie Kommunikationsfertigkeitstrainings, Reframings und mit kognitiven Dysfunktionen einzelner Systemmitglieder sowie der Familie als Ganzem gearbeitet. Unrealistische Überzeugungen bzgl. des Essverhaltens sowie fehlgeleiteter Körperwahrnehmungen werden durch kognitive Restrukturierungen bearbeitet. Strategische Interventionen dienen der Modifizierung von Beziehungsmustern. Die Funktional Family Therapy (FFT) (Sexton 2009) verbindet systemisch-strukturelle Familientherapie mit behavioristischen Ansätzen. Erneut werden dysfunktionale Kommunikations- und Interaktionsmuster eines betroffenen sozialen Systems insgesamt erarbeitet und verändert. Die FFT geht davon aus, dass jedes Familienmitglied über tief verinnerlichte Erfahrungen verfügt, die sein Verhalten in Beziehung zu anderen Menschen positiv wie auch negativ prägen. Das betroffene soziale System wird dabei unterstützt, soziale Negativität in den familiären Interaktionen zu minimieren und die Kommunikationen positiver sowie funktionaler zu gestalten. Verschiedene Settings (z. B. Klinik, Wohnung) dienen der kontextsensiblen Erprobung sowie Stabilisierung veränderten Verhaltens und Steigerung seiner ökologischen Validität. Die FFT ist einer der ältesten schulenintegrativen Ansätze. Gleichzeitig ist ihre Zuordnung zur Familientherapie in der Systemischen Therapie vs. Verhaltenstherapie am wenigsten eindeutig. Die Systemic Behavioral Family Therapy (SBFT) (Brent et al. 1997) ist eine Kombination der FFT und BFST, mit Fokus auf der Identifikation dysfunktionaler Verhaltensmuster analog der FFT in der ersten Therapiephase und Training adaptiver Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten analog der BFST in der zweiten Phase.
Ein Beispiel für die Verbindung systemtherapeutischer, verhaltenstherapeutischer und sozial-ökologischer Ansätze verkörpert die Multisystemic Therapy (MST) (Henggeler und Borduin 1990, Henggeler und Schoenwald 1998, Henggeler und Swenson 2005). Die Bedingungen der beschriebenen Probleme werden multikausal rekonstruiert und in ihren verschiedenen sozialen Kontexten angegangen. So bezieht sie über den familiären Kontext hinaus soziale Umwelten wie Schule und Peers in den Therapieprozess ein, ganz i. S. des ökosystemischen Ansatzes (Bronfenbrenner 1981), der sozial-ökologischen Theorie (Henggeler et al. 1990) und der sozialen Lerntheorie (Bandura 1977, Rotter 1954). Die MST arbeitet primär systemtherapeutisch und nutzt Elemente der anderen Ansätze zu ihrer Ergänzung. Es handelt sich um ein ambulantes Therapieangebot, welches ähnlich hochfrequent wie die Bedürfnisangepasste Behandlung im Offenen Dialog (  Kap. 11.3.2) mit einem 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche erreichbaren Therapeutensystem v. a. in der natürlichen Umgebung des betroffenen sozialen Systems und damit ausgesprochen ökologisch valide stattfindet.
Kap. 11.3.2) mit einem 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche erreichbaren Therapeutensystem v. a. in der natürlichen Umgebung des betroffenen sozialen Systems und damit ausgesprochen ökologisch valide stattfindet.
Читать дальше