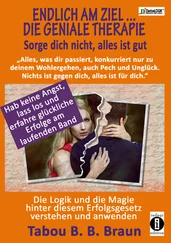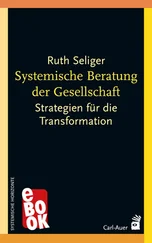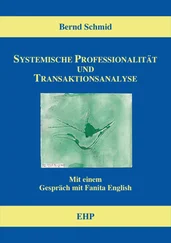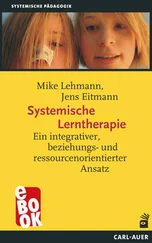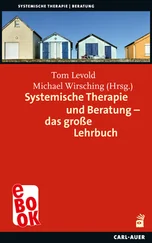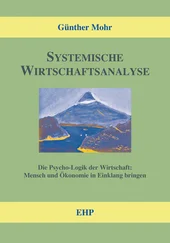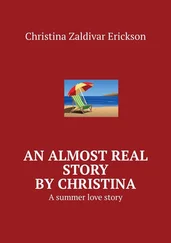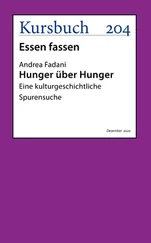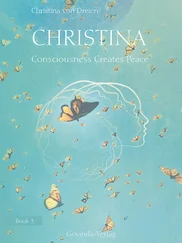1.3.4 Herrschende und unterdrückte Geschichten
Die Wegbereiter des Narrativen Ansatzes, der australische Sozialarbeiter und Psychotherapeut Michael White (1948–2008) und der neuseeländische Psychotherapeut David Epston (1944), folgten der Grundannahme, dass jede Geschichte (Narration) einen Erfahrungsgehalt verkörpert und Erfahrungen durch Geschichten erinnert werden (Bruner 1992). Es ist nicht die Erfahrung an sich, die Menschen prägt, sondern die Erzählung, die sie um eine Erfahrung konstruieren, ein sozialer Prozess, der Aufmerksamkeit von wichtigen Systemmitgliedern binden will (z. B. sexuelle Belästigung). Wirklichkeit besteht aus miteinander geteilten Geschichten (soziale Realitäten), Erzählungen organisieren Beziehungen und damit die Wahrnehmung von scheinbaren Wirklichkeiten. Wie Familienmitglieder miteinander klarkommen ist in hohem Maße davon abhängig, ob die erzählten Geschichten gemeinsam geteilt oder gegenseitig bekämpft werden. Insofern bilden Geschichten systemspezifische interne Erfahrungsmodelle. Die therapeutische Arbeit mit Geschichten ermöglicht, verändernde Erfahrungen zu machen. Es geht darum, aus welchen Geschichten welche familiären Glaubenssätze (Familiencredo) entstehen, wie diese Geschichten das eigene und familiäre Leben beherrschen und wo sie stärken sowie schwächen. Professionelle Neugierde und eine unbedingte Haltung des Nicht-Wissens dienen dazu, auch in vertrauten Geschichten Momente zu finden, in denen nicht alles wie erwartet gelaufen ist. Sie können als mögliche Ausgangspunkte für eine alternative (Lösungs-)Erzählung dienen.
1.4 Nachfolgende Modelle: Bindung, größere Systeme und Ordnungen (ab ca. 1990)
Leitidee: Familien werden ergänzt um andere Familien, und die Systemische Therapie wird emotionaler.
Mit den 1990er Jahren erschienen die größten theoretischen Debatten geführt und die Systemische Therapie konsolidiert. Es beginnt eine Zeit einerseits der Rückbezüglichkeit auf Kernannahmen der Psychotherapie, z. B. die Bindungstheorie, und andererseits der Erweiterung systemischer Grundkonzepte, z. B. in der Arbeit mit größeren Systemen wie in der Multifamilientherapie ( 
Kap. 8.4
) oder den Systemaufstellungen ( 
Kap. 5.6.5
). Es zeichnete sich eine »emotionale Wende« (v. Schlippe und Schweitzer 2016, S. 64) ab, die sowohl das Therapiegeschehen als auch Transferleistungen in den lebenspraktischen Alltag eines betroffenen sozialen Systems betraf.
1.4.1 Bindung und Emotion
Bereits die frühen Modelle der systemischen Therapie beinhalteten psychoanalytisch geprägte Bindungskonzepte ( 
Kap. 1.1 1.1 Frühe Modelle: Familientherapie und Mehrgenerationenperspektive (ca. 1950–1980) Leitidee: Das Individuum wird ergänzt um seine Familie. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre dominierte in den US-amerikanischen und europäischen Ländern die Psychoanalyse. Jedoch gab es auch immer wieder Personen, denen nicht ausreichend geholfen werden konnte. Erste alternative Veränderungen zeigten sich im Einbezug des Herkunftssystems, um über den bis dato stark individuumszentrierten Ansatz hinaus bedeutsame Unterschied in der Erklärung und Behandlung dysfunktionaler Dynamiken zu setzen.
). Daran anknüpfend, die Bindungstheorie von John Bowlby (1969, 1973, 1980), Konzepte der Emotionsfokussierten Therapie nach Leslie Greenberg (Auszra et al. 2016) integrierend und das therapeutische Vorgehen strukturell-strategisch rahmend, entwickelten die US-amerikanischen Psychotherapeuten Guy Dimanond, Lynne Siqueland und Gary Dimanond die Attachment Based Family Therapy (ABFT) (Diamond et al. 2003) (  Kap. 2.2). Sie arbeitet mit der gesamten Familie, auch wenn v. a. über Jugendliche die Eintrittskarte (ticket to admission) (Goldberg und Bridges 1988) gezogen wird. Im Fokus steht die bewusste Adressierung bindungsrelevanter Themen und emotionaler Zustände, die von den verschiedenen Systemmitgliedern als noch nicht passend gelöst und mitverantwortlich für aktuelle familiäre Konflikte verstanden werden. Zentral erscheint die Erfragung der oftmals diversen intra- und interpersonalen Strategien zur Emotionsregulation (z. B. bindungsorientiere Frage an einen Vater: »Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Familie im jugendlichen Alter gemacht, wenn sie Distanzierungs- ebenso wie Kontaktwünsche ihnen bedeutsamen Menschen gegenüber gezeigt haben?«; emotionsorientierte Frage an einen Sohn: »Wenn Dein Vaters sich bei trotzigem Verhalten Deinerseits zurückzieht, wie geht es Dir dann? Was fühlst Du? Was würdest Du gerne machen oder ihm sagen?«). Ziel ist die Stärkung eines bezogen-autonomen Selbstverständnisses und daraus resultierender passender Verhaltensweisen jedes Familienmitglieds im Kontakt mit den anderen Mitgliedern des betroffenen sozialen Systems.
Kap. 2.2). Sie arbeitet mit der gesamten Familie, auch wenn v. a. über Jugendliche die Eintrittskarte (ticket to admission) (Goldberg und Bridges 1988) gezogen wird. Im Fokus steht die bewusste Adressierung bindungsrelevanter Themen und emotionaler Zustände, die von den verschiedenen Systemmitgliedern als noch nicht passend gelöst und mitverantwortlich für aktuelle familiäre Konflikte verstanden werden. Zentral erscheint die Erfragung der oftmals diversen intra- und interpersonalen Strategien zur Emotionsregulation (z. B. bindungsorientiere Frage an einen Vater: »Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Familie im jugendlichen Alter gemacht, wenn sie Distanzierungs- ebenso wie Kontaktwünsche ihnen bedeutsamen Menschen gegenüber gezeigt haben?«; emotionsorientierte Frage an einen Sohn: »Wenn Dein Vaters sich bei trotzigem Verhalten Deinerseits zurückzieht, wie geht es Dir dann? Was fühlst Du? Was würdest Du gerne machen oder ihm sagen?«). Ziel ist die Stärkung eines bezogen-autonomen Selbstverständnisses und daraus resultierender passender Verhaltensweisen jedes Familienmitglieds im Kontakt mit den anderen Mitgliedern des betroffenen sozialen Systems.
1.4.2 Ökosystemik und größere Systeme
Mit dem sich zunehmend wandelnden Verständnis von Familie wurde immer mehr die moderne Familie als zu kleine Einheit wirksamer Veränderung gesehen. Zunächst durch den US-amerikanischen Familientherapeuten Peter Laqueur (1972) und später in Europa durch die deutschen Psychotherapeuten Eia Asen (*1946) und Michael Scholz (*1941) entwickelt, machte die Multifamilientherapie (Asen und Scholz 2019) ( 
Kap. 8.4
) verstärkt die ökosystemische Eingebundenheit von Familien explizit. Sie basiert auf der Annahme, dass Menschen sich solidarisieren, wenn sie erleben, dass andere mit ähnlichen Hoffnungen, Wünschen und Problemen leben. Probleme, die einen Gegensatz zur wahrgenommenen Norm darstellen, werden oft als scham- und schuldbesetzt erlebt. Die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls und die Normalisierung eines für den Fortbestand des sozialen Systems zentralen Themas stabilisieren den Selbstwert des betroffenen sozialen Systems. Die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache für das Erlebte, die Spiegelung eigener Sichtweisen und gegenseitige Unterstützung werden als Wirkmechanismen zur Flexibilisierung betroffener sozialer Systeme verstanden. Im therapeutischen Geschehen macht eine Familie den Anfang und bringt sich mit einem Problem ein. Durch Intensivierung der Interaktionen zwischen den Gruppenfamilien, durch Erkennen, Fokussieren und Bearbeiten anknüpfender intra- und interfamiliärerer Prozesse, Subsystembildungen (z. B. Mütter) bis zum Herausnehmen einzelner Individuen wird jedoch nicht nur das eingebrachte Anliegen bearbeitet, sondern profitieren multiple Familien von der Gruppe als einem neue Erfahrungen ermöglichenden Ökosystem.
Bindung an größere Systeme spielte auch für den deutschen Ordenspriester und Psychoanalytiker Bert Hellinger (1925–2008) eine bedeutsame Rolle. In der Auseinandersetzung mit der Frage, warum ein Mensch etwas tut, was einem anderen schadet, und sich (scheinbar) gut dabei fühlt, beschrieb er Ursprungsordnungen, die in sozialen Systemen wirken. Sie wurden von dem deutschen Psychoanalytiker und Psychotherapeuten Gunthard Weber (*1940) verschriftlicht (Hellinger 1995) und in ihrer Weiterentwicklung systemisch-konstruktivistisch ebenso wie phänomenologisch gerahmt (Weber et al. 2005). Zugehörigkeit wird zum ersten Ordnungsprinzip (Heuristik), um den Fortbestand eines sozialen Systems zu sichern. Das Konzept erscheint eng verbunden mit dem historisch geprägten Bindungsbegriff in den frühen Modellen ( 
Kap. 1.1 1.1 Frühe Modelle: Familientherapie und Mehrgenerationenperspektive (ca. 1950–1980) Leitidee: Das Individuum wird ergänzt um seine Familie. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre dominierte in den US-amerikanischen und europäischen Ländern die Psychoanalyse. Jedoch gab es auch immer wieder Personen, denen nicht ausreichend geholfen werden konnte. Erste alternative Veränderungen zeigten sich im Einbezug des Herkunftssystems, um über den bis dato stark individuumszentrierten Ansatz hinaus bedeutsame Unterschied in der Erklärung und Behandlung dysfunktionaler Dynamiken zu setzen.
), erweitert diesen aber deutlich systemisch, in dem nicht nur biologische und legale Familienverständnisse betrachtet werden, sondern auch solche, die an der Entstehung eines Systems beteiligt waren. So machten (verstorbene) Herzensbindungen (vielleicht) Platz für die aktuelle Ehefrau. Ebenso werden Verhältnisse einbezogen, die sich besonders um den Systemerhalt verdient gemacht haben, wie z. B. Pflege- und Adoptivfamilien. Bei Ausschluss bedeutsamer Systemmitglieder entsteht eine Lücke im System, die zumeist von Mitgliedern nachfolgender Generationen versucht wird zu schließen (z. B. wütendes Verhalten einer Tochter gegenüber dem Vater in (un-)bewusster Loyalität zur Mutter, die nicht voll und ganz geliebt wird). Zeitliche Reihenfolge wird zum zweiten Ordnungsprinzip und berücksichtigt generationsbezogene Strukturen und Grenzen, ähnlich den strukturell-strategischen Ansätzen der Kybernetik 1. Ordnung (  Kap. 1.2). So erscheint z. B. Partnerschaft vor Elternschaft, Eltern vor Kindern, ältere vor jüngeren Geschwistern. Aber auch die inverse Zeitfolge zwischen (Sub-)Systemen ist wichtig, wenn jüngere Systeme Vorrang vor älteren Systemen erhalten, wie z. B. in der Phase einer Familiengründung. Ausgleich von Geben und Nehmen wird zum dritten Ordnungsprinzip und erinnert an Konzepte des Kontenausgleichs und der Delegation in den frühen Modellen (
Kap. 1.2). So erscheint z. B. Partnerschaft vor Elternschaft, Eltern vor Kindern, ältere vor jüngeren Geschwistern. Aber auch die inverse Zeitfolge zwischen (Sub-)Systemen ist wichtig, wenn jüngere Systeme Vorrang vor älteren Systemen erhalten, wie z. B. in der Phase einer Familiengründung. Ausgleich von Geben und Nehmen wird zum dritten Ordnungsprinzip und erinnert an Konzepte des Kontenausgleichs und der Delegation in den frühen Modellen ( 
Kap. 1.1 1.1 Frühe Modelle: Familientherapie und Mehrgenerationenperspektive (ca. 1950–1980) Leitidee: Das Individuum wird ergänzt um seine Familie. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre dominierte in den US-amerikanischen und europäischen Ländern die Psychoanalyse. Jedoch gab es auch immer wieder Personen, denen nicht ausreichend geholfen werden konnte. Erste alternative Veränderungen zeigten sich im Einbezug des Herkunftssystems, um über den bis dato stark individuumszentrierten Ansatz hinaus bedeutsame Unterschied in der Erklärung und Behandlung dysfunktionaler Dynamiken zu setzen.
). Reziprozität und soziale Austauschbeziehungen sichern den Fortbestand eines Systems, mit der Schwierigkeit, dass der Wert der ausgetauschten Güter (z. B. Materielles, Leistungen, Gefühle) sehr unterschiedlich eingeschätzt werden kann. Mehr Geben als Nehmen, ebenso wie mehr Nehmen als Geben, bedingt zwar Bindung, jedoch im Schlechten. Kargheit im Geben und Nehmen bedingt Einsamkeit und Isolation. Hellinger (1995) hat eine Vielzahl weiterer Ordnungen beschrieben. Seine starre Vertretung dieser Ordnungen rief jedoch viele Kontroversen hervor (Haas 2009). Umso bedeutsamer erscheint ihr modernes Verständnis als Heuristiken vs. universelle Gesetzmäßigkeiten ( 
Kap. 5.6.5
).
Читать дальше