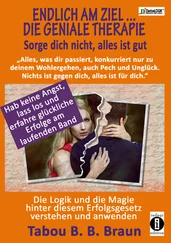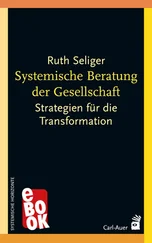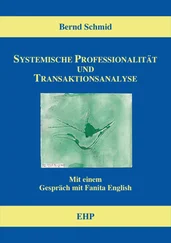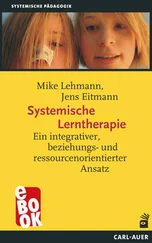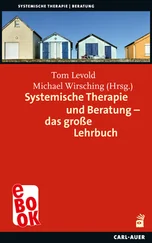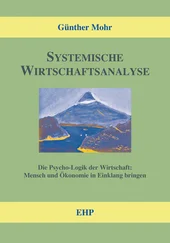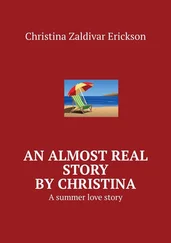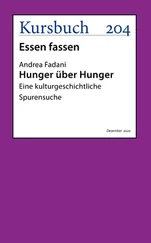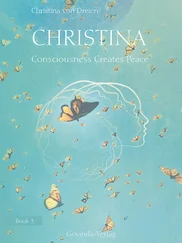1.3 Kybernetik 2. Ordnung: Reflexion von Wirklichkeitskonstruktionen (ca. 1980–1990)
Leitidee: Die Systemische Therapie beginnt, ihre Beobachtungen zu beobachten.
Um der Wehrpflicht in den Jahren des Ersten und Zweiten Weltkriegs zu entgehen, reisten viele Anthropologinnen und Anthropologen zu Forschungszwecken in entlegene Länder wie z. B. Indonesien. Zunehmend machte sich die Sorge breit, inwiefern ihre Interpretationen als Beobachtungen 2. Ordnung mit der z. B. im Ritual verkörperten Bedeutungszuschreibung als Beobachtungen 1. Ordnung übereinstimmten (Bateson 1941; Sullivan 1999). Diese Überlegungen legten einen der Grundsteine für die progressive und intellektuelle Bewegung der Kybernetik 2. Ordnung (Synonym: Beobachtung 2. Ordnung). Sie ist eng verbunden mit dem österreichischen Physiker, Kybernetiker und Philosophen Heinz von Förster (1911–2002), den Fragen der Selbst-Referenz und Selbst-Rückbezüglichkeit Zeit seines Lebens umtrieben. Wenn wir die Kommunikations- und Interaktionsmuster sozialer Systeme untersuchen, dann kommunizieren und interagieren wir stets bereits mit ihnen. Die Idee einer objektiven Realität wird ersetzt durch den Eigenwert rekursiv-denkender Systeme (v. Förster 1948). Es geht zunehmend um das, wie etwas in einem sozialen System passiert (Kybernetik 2. Ordnung), und weniger um das, was in einem sozialen System passiert (Kybernetik 1. Ordnung), vielmehr also darum, wie sich menschliche Kommunikation reziprok regelt und weniger darum, dass sie es tut, und dass wir sowohl für das eine als auch das andere Verantwortung übernehmen müssen (v. Förster und Ollrogge 2008).
1.3.1 Metakommunikation und Expertise des Nicht-Wissens
Der angloamerikanische Biologe, Anthropologe und Strukturfunktionalist, Sozialwissenschaftler, Kybernetiker und Philosoph Gregory Bateson (1904–1980) beschäftigte sich schon früh mit Beschreibungen von der Welt, die er gleichzeitig als Interpretation unserer Wahrnehmung (Beobachtungen 1. Ordnung; Kommunikation) verstand (Bateson 1941, 1983). In ihrer Übertragung auf das Therapiegeschehen stellen Beschreibungen von Therapeutensystemen über die Welt von betroffenen sozialen Systemen daher Interpretationen von Interpretationen (Beobachtungen 2. Ordnung; Metakommunikation) dar. Notwendigerweise stellt sich die Frage, was wir über unser Gegenüber wirklich wissen können (objektive Realität). Wissen erscheint auf der Basis stets individuell interpretierter Wahrnehmungsphänomene stets auch sozial konstruiert (subjektive Realität). Systemischen Therapeutinnen und Therapeuten ist bewusst, dass im Gespräch mit betroffenen sozialen Systemen in ihnen selbst auch eine Wirklichkeit entsteht, die (meist) nicht deckungsgleich ist mit der Wirklichkeit ihres Gegenübers. Es ist ihnen bewusst, dass sie mitverantwortlich sind in der Erschaffung einer mit dem betroffenen sozialen System geteilten Realität. Daher wird der therapeutische Prozess i. S. des Radikalen Konstruktivismus ( 
Kap. 3.6.1
) und der Kybernetik 2. Ordnung als eine Begegnung zweier Expertensysteme verstanden: das betroffene soziale System als Experte für sein Leben und wie es dieses gestalten möchte; das Therapeutensystem als Experte für den Prozess und die Auswahl geeigneter Frage- sowie Interventionstechniken. Wichtig ist, die therapeutische Expertise (professionelle Expertise des Nicht-Wissens) als eine anregende Wirklichkeitskonstruktion zu rahmen, um mit dem betroffenen sozialen System in einen offenen, professionell neugierigen und wertschätzenden Dialog zu kommen. Ziel ist die Einführung eines Unterschieds, der als bedeutsam wahrgenommen wird. Metakommunikation dient der Erfüllung dieses Ziels, indem sie die Aufmerksamkeit aller Beteiligten, inkl. des Therapeutensystems, auf eine höhere Ebene richtet. Dabei ist explizite Metakommunikation (z. B. lautsprachliche Reflexion des aktuellen Beziehungsgeschehens) von impliziter Metakommunikation (z. B. räumlich: Sexualität im elterlichen Schlafzimmer, Spielen mit den Kindern im Wohnzimmer) zu unterscheiden. Die Bedeutsamkeit eines eingeführten Unterschieds misst sich an seiner Relevanz (Nützlichkeit) für das betroffene soziale System.
Lebewesen als Systeme produzieren und reproduzieren sich und ihre Bestandteile (Elemente) über Stoffwechselprozesse selbst. In der Logik der Selbstorganisation erscheinen sie immer geordneter, je mehr sie sich selbst überlassen werden. In dieser Feststellung vereinen sich zwei Traditionen des systemischen Denkens: die organismische Biologie mit ihrem Interesse an den biologischen Formen von Lebewesen und die Kybernetik mit ihrem Interesse an der Steuerung von Systemen. Historisch richtungsweisend sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten der chilenischen Biologen und Neurowissenschaftler Umberto Maturana (*1928) und Francisco Varela (1946–2001). Sie schlugen die Analogie von den Prozessen des Lebens zu den Prozessen der Kognition, und wechselten den Fokus von der Frage nach dem Sein, d. h. der Existenz einer objektiven Realität unabhängig vom Beobachter, zur Frage nach dem Tun, d. h. den (bedeutsamen) Unterscheidungen, die Beobachter wahrnehmungsbezogen treffen (Maturana 1985). Auch psychische Systeme können als aus sich selbst heraus bestehend (Reifung), in Rückbezug jeder Operation auf sich selbst (Selbstreferenz) und somit als in sich geschlossene Systeme verstanden werden (Autopoiese). Autopoietische Systeme haben klare Grenzen (z. B. Familie), bestehen aus konstitutiven Elementen (z. B. Systemmitglieder, Gedanken, Gefühle, Neurotransmitter), deren Wechselwirkungen die Eigenschaften des Gesamtsystems bestimmen (z. B. unsicher-ängstliches System) und deren Komponenten reziprok aus Komponenten der Einheit selbst oder durch Transformation von externen Elementen durch interne Komponenten hergestellt werden (z. B. der Vater blickt skeptisch auf die Berufswahl seines Sohnes, der Sohn ebenfalls; beide wollen im Guten auch mit Blick auf den Anderen entscheiden, nur haben sie bisher wenig darüber gesprochen, was »gut« für den Anderen bedeutet). Kommunikation in sozialen Systemen dient der Verhaltenskoordination durch strukturelle Koppelung der beteiligten Elemente untereinander und mit den sie umgebenden Umwelten. Jede Kommunikation wird als wirksame Handlung verstanden, mit dem Ziel, den Fortbestand eines Systems in seiner Umgebung zu sichern, um so einen Raum zu schaffen, die systemimmanente Welt weiter hervorbringen zu können. Gleichfalls erscheint damit die Unterscheidbarkeit einer objektiven Realität von subjektiver Illusion unlösbar, und auch nicht länger zielführend. Es stellen sich Zweifel an einer gezielten und planmäßigen Veränderbarkeit von Systemen. Umso bedeutsamer werden kommunikative Austauschprozesse.
1.3.3 Potential und Lösung
Der US-amerikanische Sozialarbeiter, Musiker und Psychotherapeut Steve de Shazer (1940–2005) und die US-amerikanische Psychotherapeutin Insoo Kim Berg (1934–2007), ein Ehepaar, setzten mit ihrem lösungsorientierten Ansatz (Berg und Steiner 2003, de Shazer und Berg 1994) eine radikale Gegenbewegung zu der historisch lang fokussierten Problemorientierung, die zumeist auf der Hintergrundbühne ( 
Kap. 5.5.1
) geführt wurde. Konsequent blickten sie in ihrer therapeutischen Arbeit mit den betroffenen sozialen Systemen in die Zukunft. Leitidee ist, dass die Erzählung einer persönlichen Geschichte auf unseren Geisteszustand wirkt: sprechen wir über Probleme, erzeugen wir Probleme; sprechen wir über Lösungen, erzeugen wir Lösungen. Das ist bereits in den Konzepten der neuronalen Plastizität verankert (Hebb 1949). So wird Erzählen positiver Geschichten eine zentrale systemtherapeutische Interventionsmöglichkeit und eröffnet wichtige therapeutische Erfahrungen ( 
Kap. 1.3.4 1.3.4 Herrschende und unterdrückte Geschichten Die Wegbereiter des Narrativen Ansatzes, der australische Sozialarbeiter und Psychotherapeut Michael White (1948–2008) und der neuseeländische Psychotherapeut David Epston (1944), folgten der Grundannahme, dass jede Geschichte (Narration) einen Erfahrungsgehalt verkörpert und Erfahrungen durch Geschichten erinnert werden (Bruner 1992). Es ist nicht die Erfahrung an sich, die Menschen prägt, sondern die Erzählung, die sie um eine Erfahrung konstruieren, ein sozialer Prozess, der Aufmerksamkeit von wichtigen Systemmitgliedern binden will (z. B. sexuelle Belästigung). Wirklichkeit besteht aus miteinander geteilten Geschichten (soziale Realitäten), Erzählungen organisieren Beziehungen und damit die Wahrnehmung von scheinbaren Wirklichkeiten. Wie Familienmitglieder miteinander klarkommen ist in hohem Maße davon abhängig, ob die erzählten Geschichten gemeinsam geteilt oder gegenseitig bekämpft werden. Insofern bilden Geschichten systemspezifische interne Erfahrungsmodelle. Die therapeutische Arbeit mit Geschichten ermöglicht, verändernde Erfahrungen zu machen. Es geht darum, aus welchen Geschichten welche familiären Glaubenssätze (Familiencredo) entstehen, wie diese Geschichten das eigene und familiäre Leben beherrschen und wo sie stärken sowie schwächen. Professionelle Neugierde und eine unbedingte Haltung des Nicht-Wissens dienen dazu, auch in vertrauten Geschichten Momente zu finden, in denen nicht alles wie erwartet gelaufen ist. Sie können als mögliche Ausgangspunkte für eine alternative (Lösungs-)Erzählung dienen.
). Um Lösungen zu finden, braucht es keine Ursachenerklärung. Verstehen hilft nur begrenzt: Wer in einem brennenden Haus steht fragt weniger, wie das Feuer entstanden ist, als vielmehr nach dem Fluchtweg. Menschen verfügen bereits über alle Ressourcen, die sie zur Problemlösung brauchen. Oftmals braucht es nur ein genaueres Hinschauen, um sie zu finden, eine Frage zu ihrer Versprachlichung oder eine Erlaubnis zu ihrer Nutzung (Potentialhypothese).
Читать дальше